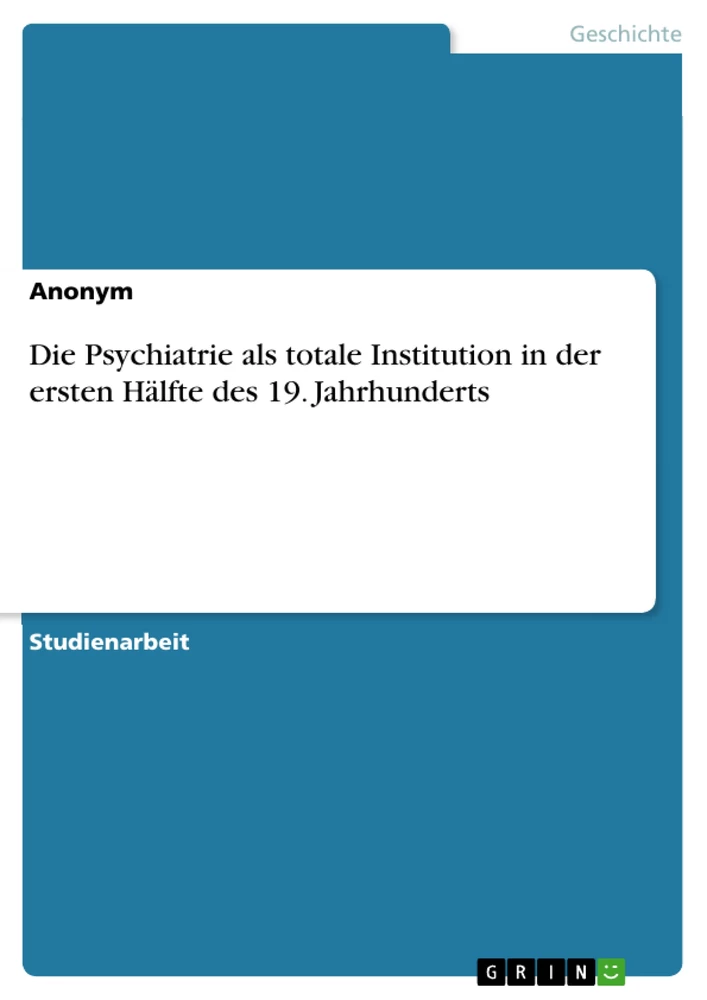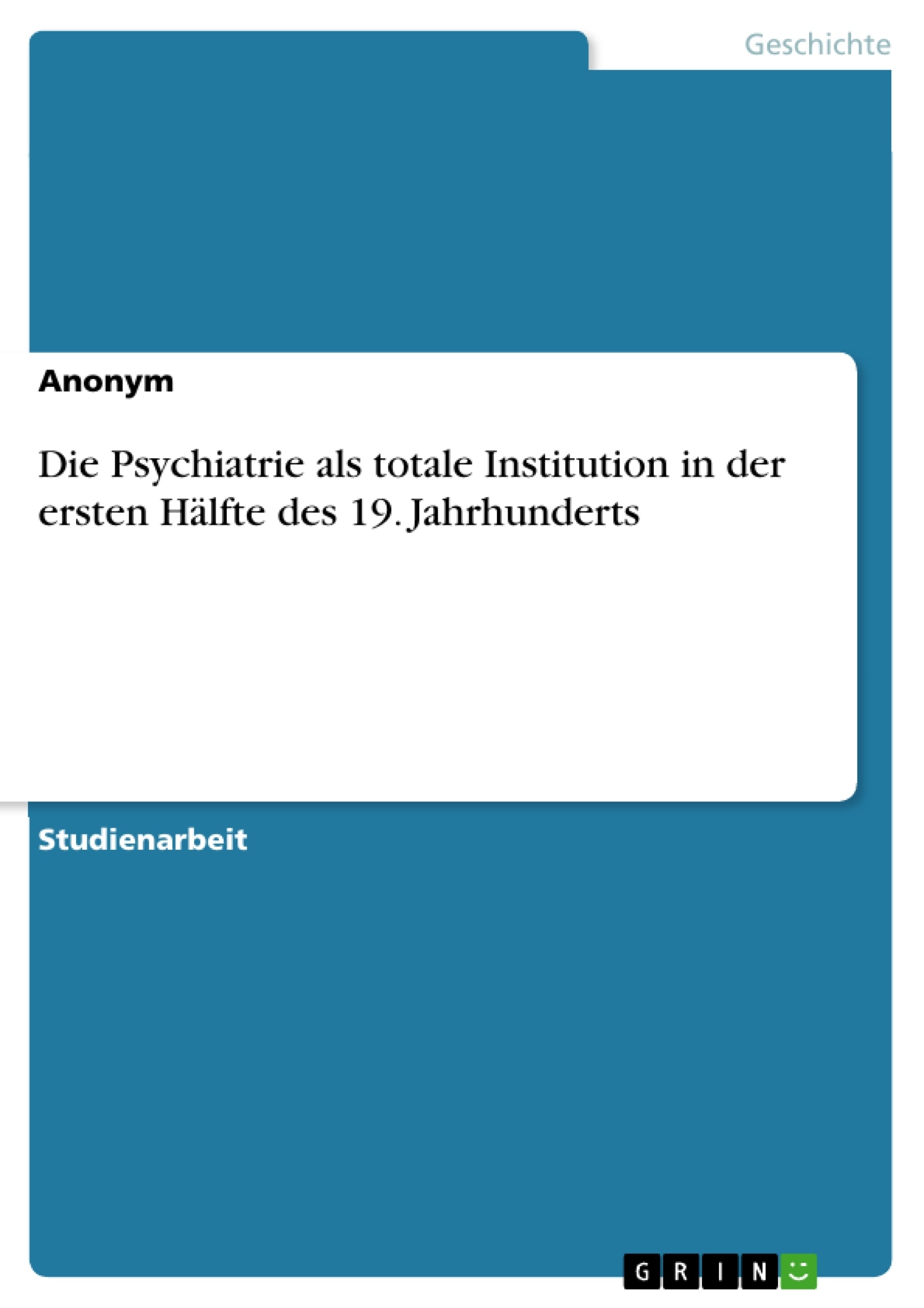In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren psychiatrische Anstalten im Rahmen von Erving Goffmans Konzept der "totalen Institution" relevant. Die zentrale Leitfrage dabei lautet: Wie lässt sich mit Goffmans Theorie die Anstalt als 'totale Institution' analysieren und lassen sich diese Merkmale in der Psychiatrie Sonnenstein-Pirna wiederfinden?
Im Rahmen dieser Arbeit wird dabei vorrangig die Theorie Goffmans betrachtet. Er beschreibt darin die soziale Realität und die Interaktionen in totalen Institutionen, wozu auch psychiatrische Anstalten gehören. Seine Konzepte wie Entindividualisierung, Rollenverlust und Stigmatisierung haben die Forschung stark beeinflusst. Für den zeitlichen Rahmen erfolgt im 2. Kapitel ein kurzer historischer Abriss der Geschichte der Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Nach dieser Betrachtung erfolgt zunächst eine intensivierte Betrachtung der Theorie zur totalen Institution von Erving Goffman und die Herausarbeitung einiger Kernmerkmale seiner Definition. Nach dieser theoretischen Betrachtung beschäftigt sich das fünfte Kapitel mit der Vorzeigeanstalt Sonnenstein-Pirna und überprüft die Theorie Goffmans anhand der herausgearbeiteten Hauptmerkmale an der praktischen Lebensrealität dieser Institution. Mit einem kurzen Einblick in eine zeitgenössische Quelle im sechsten Kapitel wird der praxisnahe Einblick abgerundet. Im Fazit werden dann die theoretischen und praktischen Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Erving Goffman und seine Theorie der „totalen\" Institution
- Die Psychiatrie Sonnenstein- Pirna
- Räumliche Gestaltung
- Psychiatriealltag Sonnenstein-Pirna
- Quellenanalyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Psychiatrie als "totale Institution" in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die Merkmale einer "totalen Institution" anhand der Theorie von Erving Goffman und stellt diese anhand der psychiatrischen Anstalt Sonnenstein-Pirna dar. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Psychiatrie im 19. Jahrhundert, fokussiert auf die institutionellen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf die Lebensrealität der Patienten.
- Die Entstehung und Entwicklung der psychiatrischen Institution im 19. Jahrhundert
- Die Theorie der "totalen Institution" nach Erving Goffman
- Die Psychiatrie Sonnenstein-Pirna als Beispiel einer "totalen Institution"
- Die Auswirkungen der institutionellen Psychiatrie auf die Lebensrealität der Patienten
- Die Rolle der Quellenanalyse im Kontext der psychiatrischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Psychiatrie im 19. Jahrhundert ein und stellt die Forschungsfrage: Wie lässt sich die Psychiatrie Sonnenstein-Pirna mit Hilfe von Goffmans Theorie der "totalen Institution" analysieren?
Das zweite Kapitel skizziert den historischen Kontext der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und zeigt die Entwicklung von der Verwahrung geistig Erkrankter hin zu einer institutionalisierten Behandlung.
Im dritten Kapitel wird die Theorie von Erving Goffman zur "totalen Institution" vorgestellt und seine zentralen Konzepte wie Entindividualisierung, Rollenverlust und Stigmatisierung erläutert.
Kapitel vier widmet sich der psychiatrischen Anstalt Sonnenstein-Pirna. Es werden die räumliche Gestaltung und der Alltagsablauf in der Anstalt anhand der Theorie Goffmans analysiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Quellenanalyse, die Einblicke in die Lebensrealität der Patienten bietet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der psychiatrischen Geschichte im 19. Jahrhundert, insbesondere mit der Entwicklung von psychiatrischen Anstalten, der "totalen Institution" als Konzept, der Analyse von Erving Goffman, den Lebensbedingungen der Patienten und der Rolle der Quellenanalyse.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Die Psychiatrie als totale Institution in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1437341