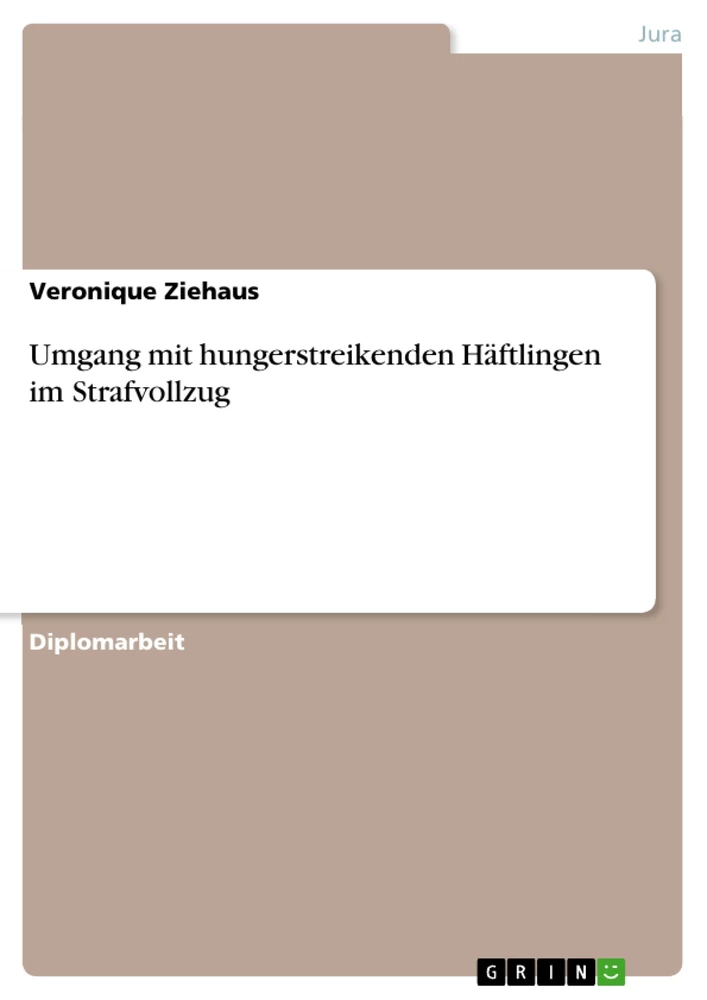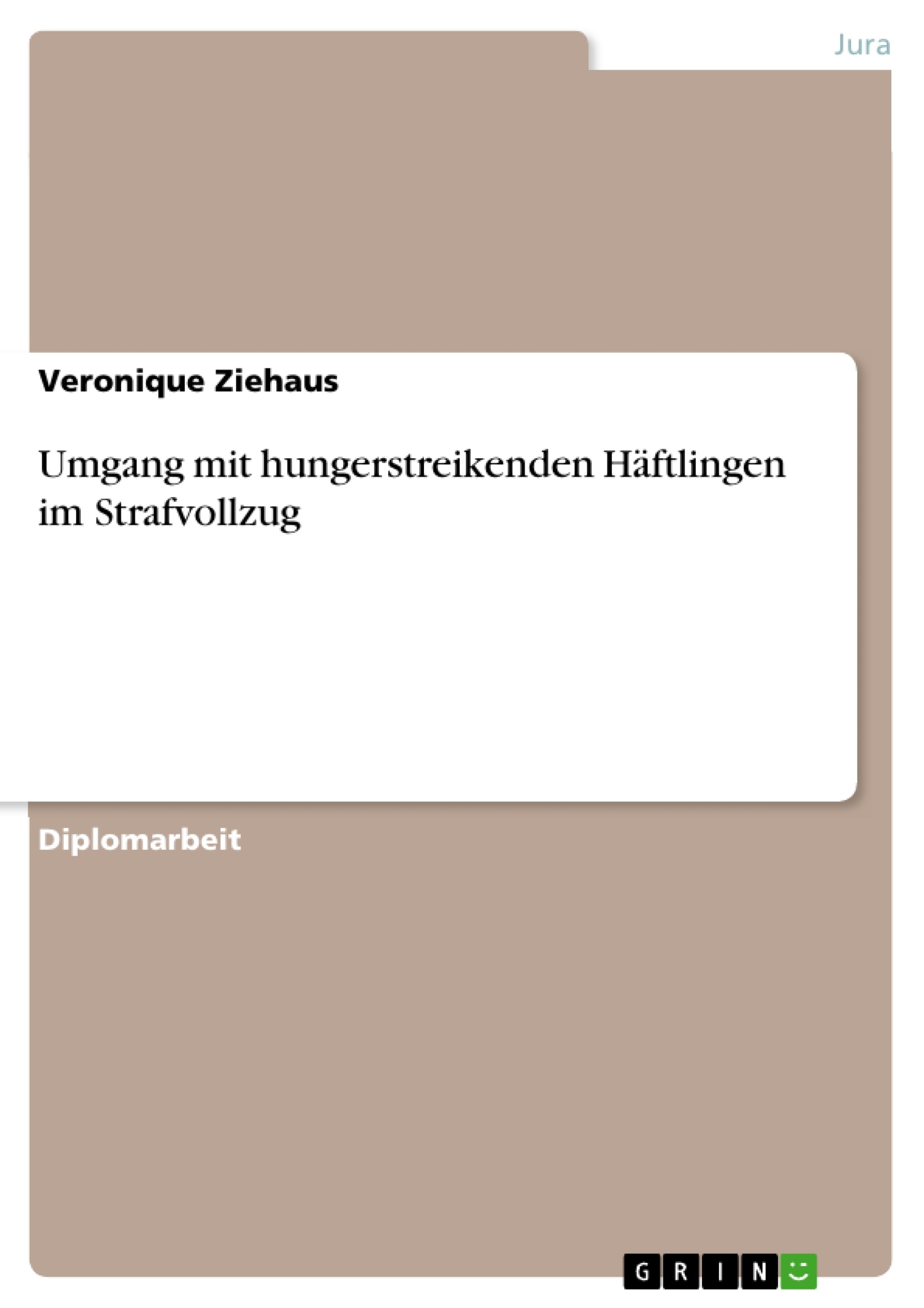Die Arbeit untersucht den Umgang mit hungerstreikenden Häftlingen im Strafvollzug unter besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Die Arbeit analysiert ethische Standards und beleuchtet Herausforderungen im Kontext der Menschenrechte, um einen fundierten Einblick in diese Thematik zu bieten. Außerdem werden Fallbeispiele aus der Praxis angeführt und diese erläutert.
Der Beschwerdeführer und Schweizer „Hanfbauer“ Bernard Rappaz wurde das erste Mal im November 1996 verhaftet, als bei einer Durchsuchung seines Unternehmens dort befindliche Hanfduftkissen gefunden und beschlagnahmt wurden. Da er die Meinung vertrat, zu Unrecht verurteilt worden zu sein, und um seinem Protest gegen das seines Erachtens unrechtmäßige Strafverfahren Ausdruck zu verleihen, trat Rappaz bereits nach kurzer Zeit in den Hungerstreik, welchen er erst mit seiner Haftentlassung zwei Monate später beendete.
In den darauffolgenden Jahren wurde der Beschwerdeführer aufgrund der Begehung diverser anderer Delikte, unter anderem wegen Drogenhandels, Geldwäscherei, einfacher Körperverletzung und schwere Untreue, im Oktober 2008 zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt. Rappaz trat schon am Tag seiner Inhaftierung und später im Zuge seiner Gefangenschaft wiederholt in den Hungerstreik, einerseits um die Legalisierung der Verwendung und des Verkaufs von Cannabis zu erwirken, andererseits auch als Protest gegen seine Verurteilung, welche er als zu schwerwiegend empfand. Zeitweise verweigerte er auch die Aufnahme von Flüssigkeit.
Die nationalen Behörden weigerten sich jedoch trotz seiner fortgesetzten Nahrungsverweigerung, Bernard Rappaz freizulassen. Der Beschwerdeführer berief sich daraufhin auf Art. 92 des schweizerischen Strafgesetzbuches. Dieser besagt, dass die Unterbrechung des Strafvollzugs ausnahmsweise aus wichtigem Grund stattfinden darf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- EGMR 26.03.2013, Rappaz v. Schweiz, Nr 73175/10
- Hungerstreik
- Geschichtlich bedeutsame Fälle von Hungerstreik
- Definition und Ziele des Hungerstreiks
- Formen des Hungerstreiks
- Gesundheitliche Auswirkungen des Hungerstreiks
- Die künstliche Ernährung unter Zwang
- Begriff und grundsätzliche Informationen zur Zwangsernährung
- Gesundheitliche Risiken der künstlichen Ernährung unter Zwang
- Zulässigkeit der Zwangsernährung
- Grundrechtliche Rahmenbedingungen
- Art. 2 EMRK - Das Recht auf Leben
- Art. 3 EMRK - Das Folterverbot
- Art. 8 EMRK - Recht auf Achtung des Privatlebens
- Art. 10 EMRK - Freiheit der Meinungsäußerung
- Nationale Bestimmungen in Bezug auf die Zwangsernährung von Häftlingen
- Strafvollzug in Österreich
- Strafvollzug in Deutschland
- Strafvollzug in der Schweiz
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Hungerstreiks im Strafvollzug und analysiert die Rechtmäßigkeit der Zwangsernährung von inhaftierten Personen, die ihren Protest durch Nahrungsverweigerung zum Ausdruck bringen. Dabei werden die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) beleuchtet, sowie die nationalen Bestimmungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz in Bezug auf die Zwangsernährung von Häftlingen betrachtet.
- Rechtliche und ethische Aspekte der Zwangsernährung im Strafvollzug
- Die EMRK-rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Hungerstreikenden
- Die medizinischen und psychologischen Auswirkungen des Hungerstreiks
- Die nationale Rechtslage in Österreich, Deutschland und der Schweiz
- Der Fall "Bernard Rappaz gegen die Schweiz" als Beispiel für die rechtliche und ethische Problematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den EGMR-Fall „Bernard Rappaz gegen die Schweiz“ vor und erläutert die rechtliche Problematik der Zwangsernährung im Strafvollzug. Im nächsten Kapitel werden Hungerstreik und seine Formen, sowie historische Beispiele und die gesundheitlichen Auswirkungen umfassend beschrieben.
Das Kapitel über die künstliche Ernährung unter Zwang behandelt Begriff und grundsätzliche Informationen, die gesundheitlichen Risiken und die rechtliche Zulässigkeit der Zwangsernährung.
Die grundrechtlichen Rahmenbedingungen werden im darauffolgenden Kapitel beleuchtet, wobei die EMRK-Artikel 2 (Recht auf Leben), 3 (Folterverbot), 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) und 10 (Freiheit der Meinungsäußerung) im Kontext des Hungerstreiks und der Zwangsernährung diskutiert werden.
Das Kapitel über die nationalen Bestimmungen in Bezug auf die Zwangsernährung von Häftlingen widmet sich den rechtlichen Regelungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Schlüsselwörter
Hungerstreik, Zwangsernährung, Strafvollzug, Menschenrechte, EMRK, Recht auf Leben, Folterverbot, Recht auf Achtung des Privatlebens, Freiheit der Meinungsäußerung, nationale Rechtslage, Österreich, Deutschland, Schweiz.
- Citar trabajo
- Veronique Ziehaus (Autor), 2015, Umgang mit hungerstreikenden Häftlingen im Strafvollzug, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1438823