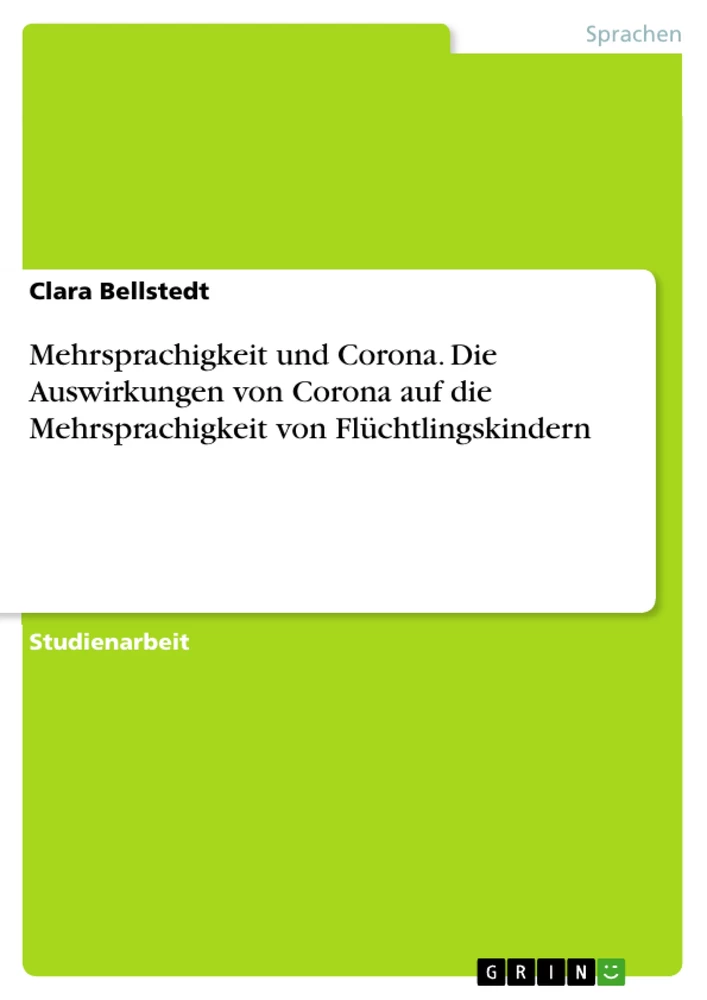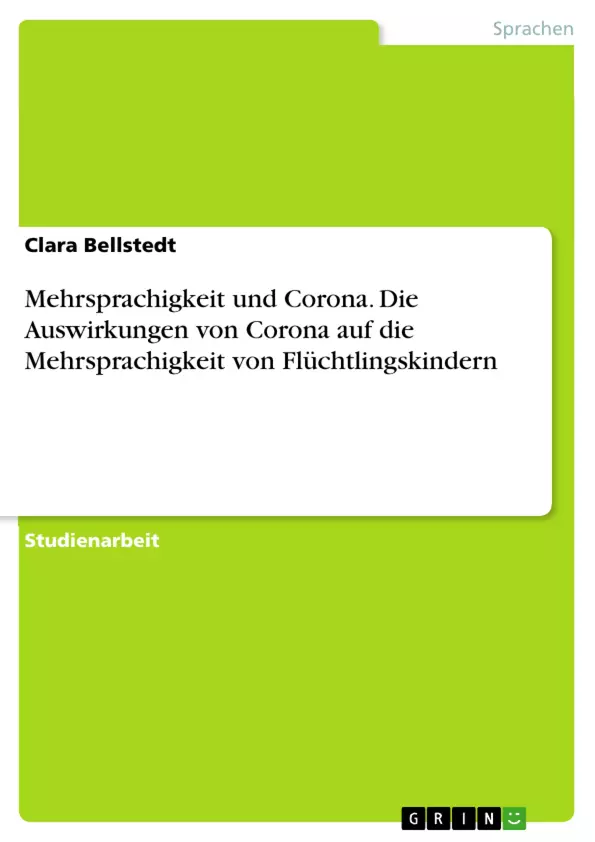Im Fokus dieser Forschungsarbeit steht die Analyse der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Mehrsprachigkeit von Flüchtlingskindern in Deutschland. Während bisherige Forschung hauptsächlich die Auswirkungen der Pandemie auf die Mehrheit untersucht hat, wurden die spezifischen Situationen und Herausforderungen von Minderheiten bisher vernachlässigt. Die Grundhypothese dieser Arbeit lautet, dass die durch die Pandemie eingeleiteten Maßnahmen, darunter der "Lockdown", einen erheblichen Einfluss auf die sprachliche Umgebung, den Spracherwerb und den Sprachgebrauch von Menschen ausüben. Besonderes Augenmerk gilt dabei mehrsprachigen Menschen, die in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Sprachen nutzen.
Die Forschungsfragen dieser Untersuchung beleuchten vielfältige Aspekte, darunter den Mehrsprachigkeitsgrad von Flüchtlingskindern, deren individuelle Spracherwerbsprozesse, den Zeitpunkt und die Umstände des Spracherwerbs sowie die Veränderungen durch die Corona-Pandemie. Zusätzlich wird die Wahrnehmung der sprachlichen Umgebung der Flüchtlingskinder, deren Unterstützung bei der Sprachpflege und -verbesserung trotz der pandemiebedingten Einschränkungen sowie aktuelle Probleme und Bedürfnisse dieser Gruppe näher beleuchtet.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel, beginnend mit einer Vertiefung des theoretischen Hintergrunds (Kapitel 2), gefolgt von der detaillierten Darstellung der angewandten Methode (Kapitel 3). Die Pretests und ihre Ergebnisse werden in den Kapiteln 4 und 5 präsentiert, während Kapitel 6 auf etwaige Anpassungen des Fragebogens eingeht. Kapitel 7 widmet sich einer kritischen Reflexion der angewandten Methodik, und abschließend werden die Erkenntnisse in einem Fazit in Kapitel 8 zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Mehrsprachigkeit und Sprachverwendung
- Stellung einer Sprachminderheit in einer mehrsprachigen Umgebung
- Zugang zur eigenen Sprache
- Auswirkungen der Schulschließungen
- Methode und Informanten
- Erläuterung der Pretests
- Ergebnisse der Pretests und deren Implikation auf den Fragebogen
- Sonstige Anpassungen
- Methodenkritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der Maßnahmen der Corona-Pandemie auf die Mehrsprachigkeit von Flüchtlingskindern in Deutschland zu untersuchen. Ziel ist der Entwurf eines Fragebogens für eine weiterführende qualitative Forschung. Die Untersuchung soll Einblicke in die sprachliche Situation von Flüchtlingskindern vor und während der Pandemie liefern und dazu beitragen, die Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Gruppe besser zu verstehen.
- Einfluss der Corona-Pandemie auf die Mehrsprachigkeit von Flüchtlingskindern
- Sprachliche Umgebung und Unterstützungsmöglichkeiten für Flüchtlingskinder in Deutschland
- Herausforderungen und Bedürfnisse von Flüchtlingskindern in Bezug auf Sprachentwicklung und -erhalt
- Entwicklung eines Fragebogens für eine weiterführende qualitative Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Forschung und definiert wichtige Grundbegriffe wie Mehrsprachigkeit und die Stellung einer Sprachminderheit in einer mehrsprachigen Umgebung. Es werden zudem der Zugang zur eigenen Sprache und die Auswirkungen von Schulschließungen auf die Schulleistungen erörtert.
Kapitel 3 erläutert die Methodik der Untersuchung, während Kapitel 4 die verwendeten Pretests detailliert beschreibt. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Pretests und deren Implikation auf den Fragebogen.
Kapitel 6 geht auf weitere Anpassungen des Fragebogens ein. Eine Methodenkritik findet in Kapitel 7 statt.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Flüchtlingskinder, Sprachentwicklung, Sprachgebrauch, Corona-Pandemie, Sprachliche Umgebung, Unterstützungsmöglichkeiten, Qualitative Forschung, Fragebogenentwicklung.
- Citar trabajo
- Clara Bellstedt (Autor), 2021, Mehrsprachigkeit und Corona. Die Auswirkungen von Corona auf die Mehrsprachigkeit von Flüchtlingskindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1438934