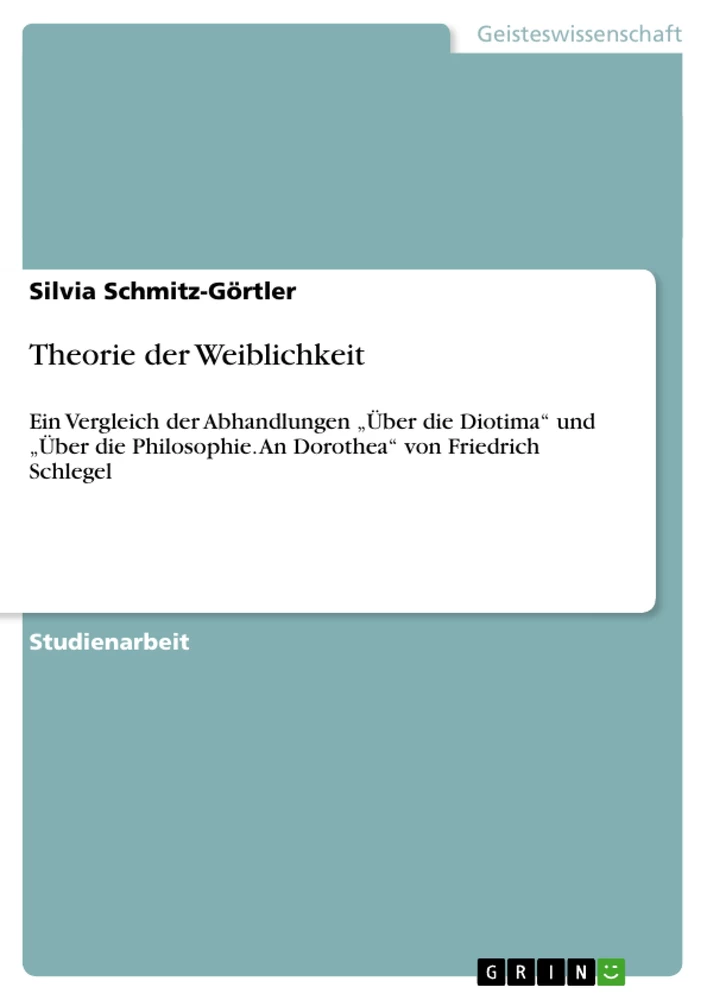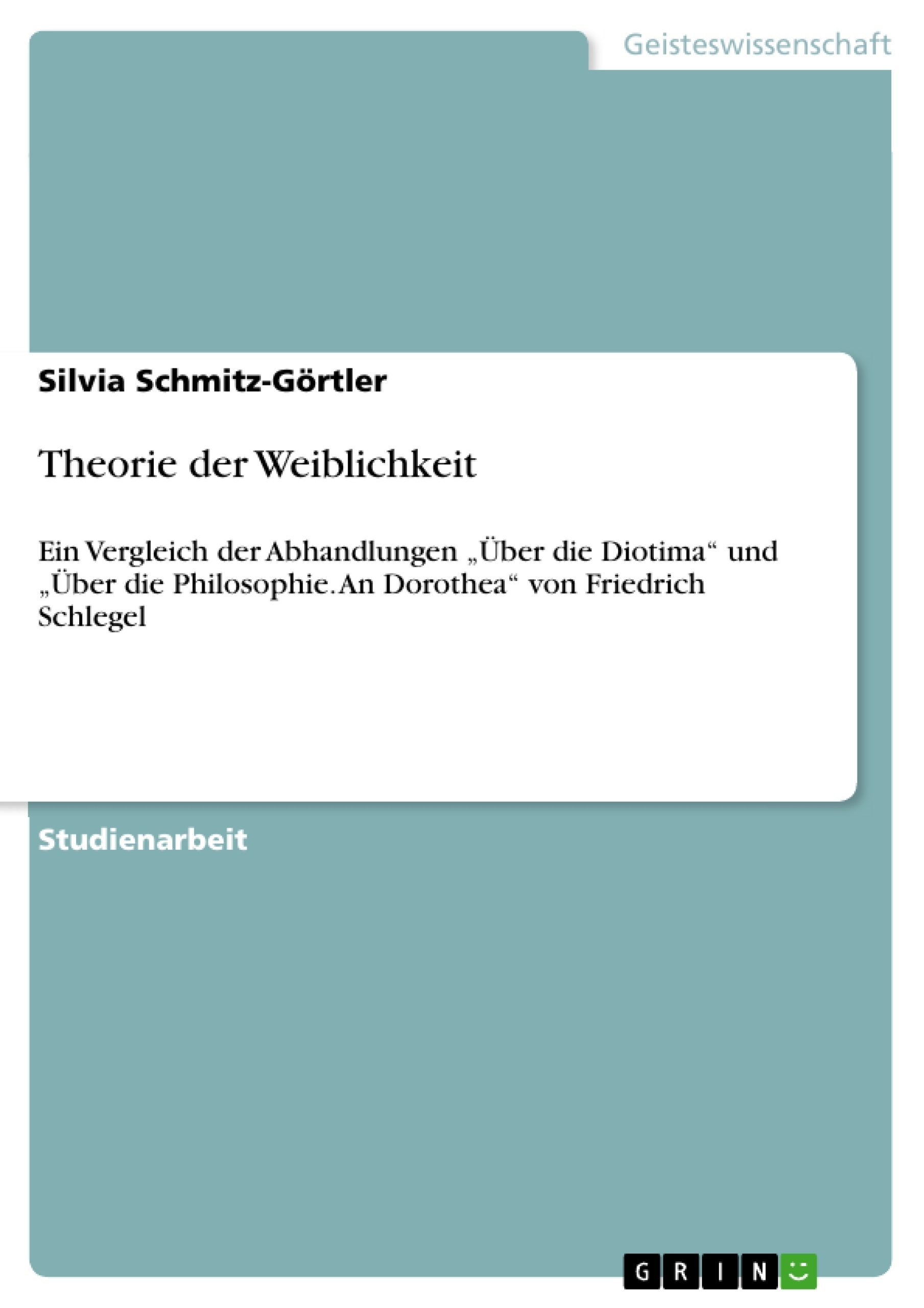Friedrich Schlegel entwickelt in der Zeit von 1794-1800 eine Theorie der Weiblichkeit, die in seinem Werk und mit diesem untrennbar verwoben ist. Schlegel tritt als Kritiker des zeitgenössischen Frauenbildes auf und fordert entgegen diesem Bild weibliche Selbständigkeit, Bildung und Teilhabe am öffentlichen Leben.
Die vorliegende Hausarbeit Theorie der Weiblichkeit -- Ein Vergleich der Abhandlungen „Über die Diotima“ und „Über die Philosophie. An Dorothea“ von Friedrich Schlegel zeigt auf, dass sich beide Abhandlungen unterscheiden, ergänzen und durchdringen. In einem ersten Schritt wird die kritisch-postulativ-historische Abhandlung „Über die Diotima“ untersucht und es soll gezeigt werden, dass diese den Schematismus zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit überwinden will. Schlegel sucht nach einer Formel der Vereinigung der scheinbaren Widersprüche der Geschlechter, die es zu überwinden gilt. Er macht sich zum Kritiker der zeitgenössischen Sittenbilder. Schlegel beschreitet hier gegenüber den zeitgenössisch üblichen einen entgegengesetzten Weg, weg von anthropologischen und naturphilosophischen Aussagen. Seine Utopie ist die wechselseitige Durchdringung von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theorie der Weiblichkeit
- 1. „Über die Diotima“
- 2. „Über die Philosophie. An Dorothea“
- III. Die wechselseitige Durchdringung
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht Friedrich Schlegels Theorie der Weiblichkeit, insbesondere im Vergleich der Abhandlungen „Über die Diotima“ und „Über die Philosophie. An Dorothea“. Ziel ist es, die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen zwischen beiden Texten aufzuzeigen und Schlegels Vision einer „Vollendung der Menschheit“ und „Universalpoesie“ zu beleuchten.
- Kritische Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Frauenbild
- Schlegels Konzept der wechselseitigen Durchdringung von Männlichkeit und Weiblichkeit
- Die Rolle der Philosophie und Bildung für die Emanzipation der Frau
- Analyse des griechischen Frauenbildes in Schlegels Werk
- Die Bedeutung von Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling und Dorothea Mendelssohn-Veit-Schlegel für Schlegels Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Der Abschnitt stellt Friedrich Schlegel als Kritiker des zeitgenössischen Frauenbildes vor und beschreibt seine Forderung nach weiblicher Selbständigkeit, Bildung und Teilhabe am öffentlichen Leben. Die Hausarbeit selbst setzt sich zum Ziel, die Abhandlungen „Über die Diotima“ und „Über die Philosophie. An Dorothea“ zu vergleichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
II. Theorie der Weiblichkeit
Dieses Kapitel erläutert Schlegels Konzept der Weiblichkeit und seine Kritik an der Unterdrückung und Geringschätzung von Frauen. Es werden zentrale Elemente seiner Theorie hervorgehoben, wie die Betonung individueller Freiheit, die Bedeutung von Freundschaft und Gedankenaustausch und die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
1. „Über die Diotima“
Schlegels Abhandlung „Über die Diotima“ wird hier im Detail untersucht. Es wird dargestellt, wie Schlegel durch die Analyse des griechischen Frauenbildes, insbesondere der Figur der Diotima, eine Überwindung der traditionellen Geschlechterrollen anstrebt. Seine Kritik an naturrechtlichen Positionen und seine Vision einer „sanften Männlichkeit“ und „selbständigen Weiblichkeit“ werden beleuchtet.
- Citation du texte
- Silvia Schmitz-Görtler (Auteur), 2009, Theorie der Weiblichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143938