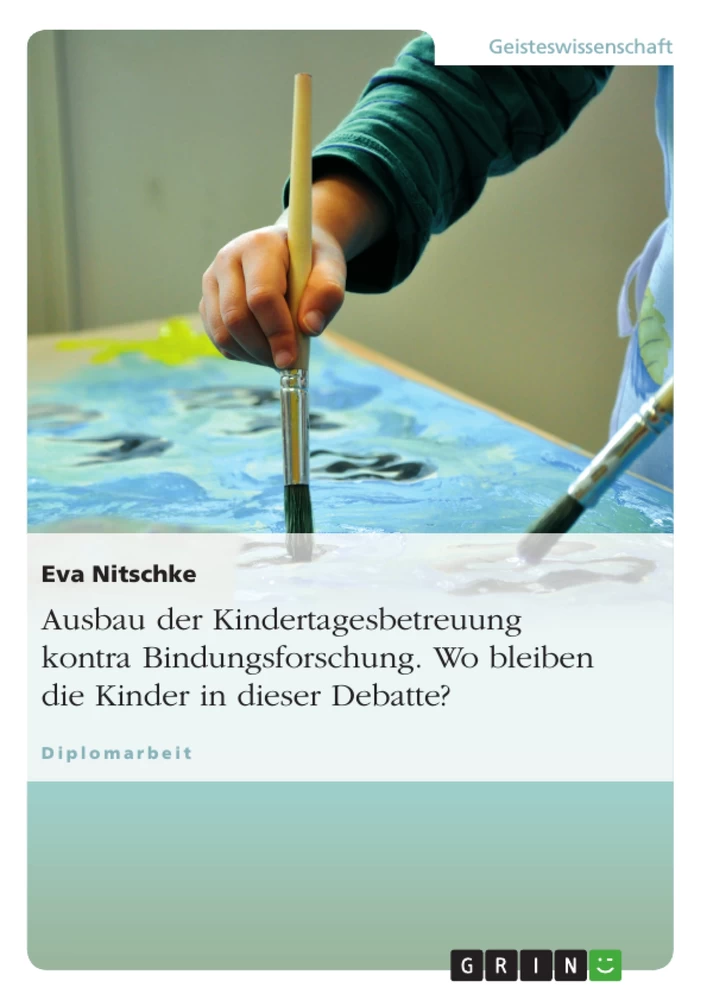Die Geburtenrate sinkt, die Zahl der Alten steigt an – Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, kinderfreundlicher zu werden, um die Zahl der Geburten zu erhöhen.
Familienministerin Ursula von der Leyen verfolgt in diesem Zusammenhang die Umsetzung einer echten Wahlmöglichkeit zwischen Kinderbetreuungsalternativen. Vorrangig durch den Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige sei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu erreichen. Statistiken belegen den Betreuungsnotstand.
So wurden in jüngster Zeit Gesetze zum Ausbau der Kindertagesbetreuung erlassen, die sowohl eine flächendeckende Versorgung als auch eine Sicherstellung der Qualität der Betreuungseinrichtungen beinhalten.
Grund genug für eine öffentliche Diskussion. Auf der einen Seite ist die Befürwortung dieses Betreuungsausbaus mit Schlagworten wie Frühförderung, mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sowie Prävention vor Kindeswohlgefährdung untermauert. Auf der anderen Seite warnen Fremdbetreuungsgegner vor den Auswirkungen solch früher Fremdbetreuung und befürchten die Abkehr vom (traditionellen) Modell Familie einerseits sowie die Verstaatlichung der Kindererziehung andererseits.
Ein absolutes „Richtig“ in diesem Zusammenhang gibt es wohl nicht. Allerdings lassen sich die verschiedenen Aspekte, die für oder gegen diesen Tagesbetreuungsausbau sprechen, genauer untersuchen.
Dies soll in der vorliegenden Arbeit geschehen. Sowohl die Grundlagen der Bindungstheorie, die bedeutend für die Entwicklung von Kindern ist, als auch die möglichen Auswirkungen von institutioneller Fremdbetreuung auf die kindliche Entwicklung werden erörtert. Die Grundlage für den Ausbau bieten verschiedene Gesetze, welche durch die momentane politische und gesellschaftliche Richtung geprägt sind. Zudem gibt es verschiedene Merkmale, die laut aktuellem Forschungsstand maßgeblich für eine gelingende Fremdbetreuung sind. Hauptteil dieser Arbeit ist eine Untersuchung über die tatsächliche Einstellung von Eltern über die Betreuungsalternativen, welche anschließend durch die Benennung von möglichen Alternativen zum Betreuungsausbau ergänzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bindungstheorie
- Entstehung der Bindungstheorie
- Bindungstypen
- Unsicher-vermeidend gebunden (A)
- Sicher gebunden (B)
- Unsicher-ambivalent gebunden (C)
- Unsicher-desorganisiert / desorientiert gebunden (D)
- Entwicklung der Bindung im ersten Lebensjahr
- Die Entstehung der Mutter-Kind-Bindung
- Feinfühligkeit
- Auswirkungen von Bindungsmustern
- Auswirkungen auf das Gehirn
- Auswirkungen auf die weitere Entwicklung
- Weiterer Verlauf der Bindung
- Das Adult-Attachment-Interview (AAI)
- Klassifikation von Bindungsrepräsentanzen
- Sicher organisierte, wertschätzende Bindungseinstellung (,,free-autonomous“)
- Unsicher-vermeidende, abwertende Bindungseinstellung (,,dismissing“)
- Unsicher-ambivalente, verstrickte Bindungseinstellung (,,enmeshed, preoccupied“)
- Unsichere Bindungseinstellung mit ungelöstem Trauma und/oder Verlust (,,unresolved trauma of loss\")
- Stabilität des Bindungsmusters
- Weitergabe von Bindungsmustern an die eigenen Kinder
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Risikofaktoren
- Schutzfaktoren
- Kinderbetreuung
- Kinderbetreuungsarten
- Kinder(tages-)einrichtungen
- Kindergarten
- Kindertagesstätte, Kita, Krippe
- Hort, Kernzeitbetreuung
- Tagespflege, Tagesmutter
- Definition
- Gesetzliche Richtlinien für die Tagespflege
- Familiäre Betreuung
- Andere Betreuungsformen
- Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Regelungen für Familien mit Kleinkindern
- Mutterschutz
- Kindergeld
- Elterngeld
- Erziehungsgeld
- Elternzeit
- Weitere finanzielle Hilfen
- Geschichte der Kinderbetreuung
- Fremdbetreuung heute
- Das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Das Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz
- Aktuelle Situation
- Exkurs: Wirtschaftspolitischer Hintergrund der Kita-Debatte
- Auswirkungen von Kindertagesbetreuung
- Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung
- Auswirkung der Trennung auf die Bindung
- Auswirkung der mütterlichen Einstellung zur Betreuungsart
- Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung
- Auswirkungen auf die Aggressionsentwicklung
- Kinder in besonderen Lebenslagen
- Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund
- Kinder in Armut
- Rahmenbedingungen für eine gelingende Fremdbetreuung
- Besonderheiten in der Erzieherin-Kind-Bindung
- Gruppengröße
- Altersstruktur und Betreuungsschlüssel
- Eingewöhnungszeit
- Information
- Dreitägige Grundphase
- Feststellung der individuellen Eingewöhnungszeit
- Stabilisierungsphase
- Schlussphase der Eingewöhnung
- Frühe Bildung
- Wie funktioniert frühkindliche Bildung?
- Bildung in der Kita
- Anregungsreiche Umgebung
- Bildungspartnerschaft zwischen Erzieherinnen und Eltern
- Weitere Merkmale für eine gelingende außerfamiliäre Betreuung
- Gelingende Fremdbetreuung in Verantwortung der Eltern
- Verantwortung der Einrichtung/des Trägers
- Der Wunsch der Eltern nach mehr Betreuung
- Vorgehensweise bei der Online-Befragung
- Teilnehmer
- Einkommen und Bildung
- Alter und Geschlecht
- Querschnitt der Probanden
- Kinderanzahl
- Inhaltliche Ergebnisse
- Zufriedenheit mit Unterstützungsangeboten
- Realer Wunsch der Betreuungsmöglichkeit
- Was ist das Beste fürs Kind?
- Wie wird das Kind tatsächlich betreut?
- Vergleich des gewünschten und realen Kita-Besuchs
- Gründe für die Fremdbetreuung
- Betreuungsgeld
- Gründe, die gegen ein Betreuungsgeld sprechen
- Gründe, die für ein Betreuungsgeld sprechen
- Kernpunkte der Überlegungen
- Nähere Betrachtung von Frage 3
- Schlussfolgerung
- Mögliche Alternativen zum Ausbau der Betreuungsplätze
- Betreuungsgeld
- Inhalte des Betreuungsgeldes
- Kritik am Betreuungsgeld
- ,,Elternführerschein“
- Kombination Betreuungsgeld und Elternführerschein
- Fazit
- Entwicklung der Bindungstheorie und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung
- Untersuchung verschiedener Kinderbetreuungsformen und deren Auswirkungen auf die Bindung
- Analyse der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der aktuellen Situation in Deutschland
- Diskussion der Auswirkungen der Fremdbetreuung auf die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern
- Bewertung möglicher Alternativen zum Ausbau der Betreuungsplätze
- Kapitel 1: Die Bindungstheorie: Dieses Kapitel stellt die Grundlagen der Bindungstheorie vor. Es beleuchtet die Entstehung der Theorie, beschreibt verschiedene Bindungstypen und erläutert die Entwicklung der Bindung im ersten Lebensjahr. Zudem werden die Auswirkungen von Bindungsmustern auf das Gehirn und die weitere Entwicklung des Kindes diskutiert.
- Kapitel 2: Kinderbetreuung: In diesem Kapitel werden unterschiedliche Kinderbetreuungsformen in Deutschland vorgestellt, darunter Kindergärten, Kitas, Tagespflege und familiäre Betreuung. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Kinderbetreuung in Deutschland beleuchtet.
- Kapitel 3: Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Familien mit Kleinkindern. Es werden die rechtlichen Regelungen zum Mutterschutz, Kindergeld, Elterngeld und Elternzeit vorgestellt. Zudem wird ein Einblick in die Geschichte der Kinderbetreuung und die aktuelle Situation gegeben.
- Kapitel 4: Auswirkungen von Kindertagesbetreuung: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Kindertagesbetreuung auf die Mutter-Kind-Bindung, die kognitive Entwicklung und die Aggressionsentwicklung von Kindern untersucht. Die Auswirkungen der Trennung auf die Bindung und der mütterlichen Einstellung zur Betreuungsart werden beleuchtet.
- Kapitel 5: Kinder in besonderen Lebenslagen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Kinderbetreuung für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund und Kinder in Armut.
- Kapitel 6: Rahmenbedingungen für eine gelingende Fremdbetreuung: In diesem Kapitel werden wichtige Rahmenbedingungen für eine gelingende Fremdbetreuung, wie die Eingewöhnungszeit, die Gruppengröße und die Bildungsarbeit, analysiert.
- Kapitel 7: Der Wunsch der Eltern nach mehr Betreuung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Online-Befragung zu den Wünschen und Bedürfnissen von Eltern in Bezug auf die Kinderbetreuung.
- Kapitel 8: Mögliche Alternativen zum Ausbau der Betreuungsplätze: In diesem Kapitel werden alternative Ansätze zum Ausbau der Betreuungsplätze, wie das Betreuungsgeld und der „Elternführerschein", diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der aktuellen Debatte um den Ausbau der Kindertagesbetreuung und deren Auswirkungen auf die Bindungsforschung. Die Arbeit analysiert die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Bindung und untersucht, wie sich die Fremdbetreuung auf die Entwicklung von Kindern auswirken kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Themen Kindertagesbetreuung, Bindungstheorie, Entwicklungspsychologie, Familienpolitik, Fremdbetreuung, Gesellschaftspolitik, Mutter-Kind-Bindung, Kognitive Entwicklung, Aggressionsentwicklung, Eingewöhnungszeit, Bildungsarbeit und Betreuungsgeld. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Studien, empirischen Daten und Gesetzestexten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Bindungstypen nach der Bindungstheorie?
Man unterscheidet sicher gebundene (B), unsicher-vermeidende (A), unsicher-ambivalente (C) und unsicher-desorganisierte (D) Kinder.
Wie wirkt sich frühe Fremdbetreuung auf die Mutter-Kind-Bindung aus?
Die Arbeit untersucht, ob die Trennung die Bindungsqualität beeinflusst und welche Rolle die Einstellung der Mutter zur Betreuungsart spielt.
Was ist das Ziel des Kinderförderungsgesetzes (KiföG)?
Das KiföG zielt auf den flächendeckenden Ausbau von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige ab, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.
Welche Rahmenbedingungen sind für eine gelingende Fremdbetreuung nötig?
Wichtige Faktoren sind eine sensible Eingewöhnungszeit, kleine Gruppengrößen, ein guter Betreuungsschlüssel und eine stabile Erzieherin-Kind-Bindung.
Was versteht man unter dem Begriff „Betreuungsgeld“?
Es ist eine finanzielle Leistung für Eltern, die ihre Kleinkinder nicht in öffentlich geförderten Einrichtungen, sondern privat oder familiär betreuen lassen.
- Arbeit zitieren
- Eva Nitschke (Autor:in), 2009, Ausbau der Kindertagesbetreuung kontra Bindungsforschung. Wo bleiben die Kinder in dieser Debatte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144149