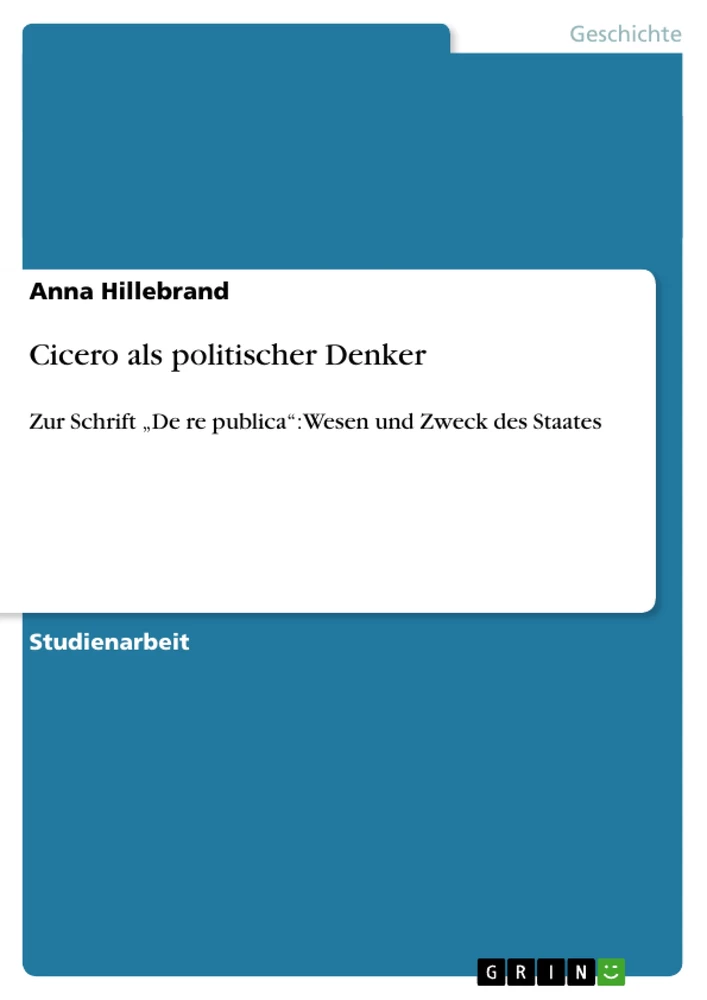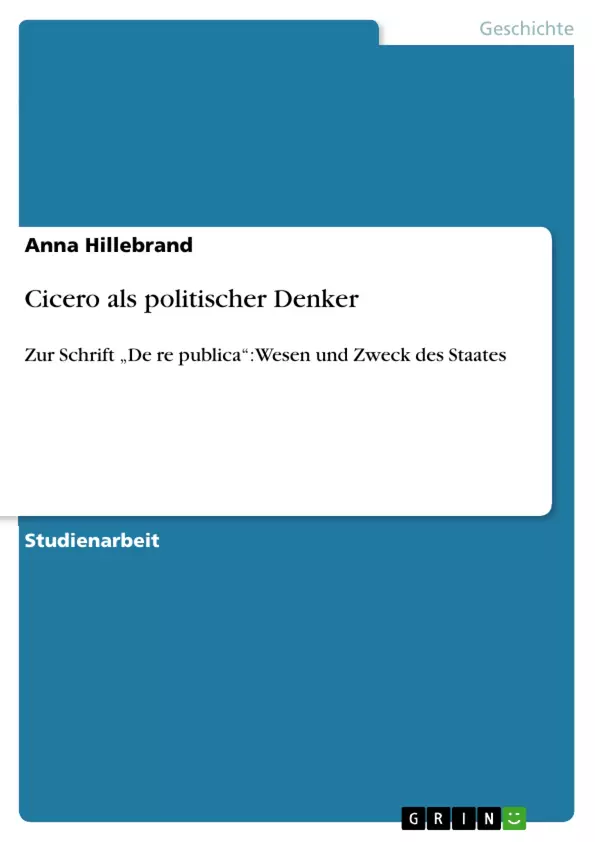Während Cicero als Schriftsteller und Redner geachtet wird, kommt ihm als Politiker eine eher geringe Wertschätzung entgegen. Obwohl Cicero durchaus politische Erfolge erzielen konnte, ging er nicht als ein bedeutender Politiker in die Geschichte ein, sondern eher mit seiner Tätigkeit als Schriftsteller, die ihm wohl in den Jahren, in denen er nicht politisch tätig werden konnte, als Ersatz gedient haben muss.
Dies muss Cicero angesichts der Tatsache, dass er sein Leben lang eher ein erfolgreicher Staatsmann als Schriftsteller sein will, stark verärgern.
So erfüllten ihn seine Schriften zur Theorie und Praxis der Rhetorik oder zur Rechtskunde, Hermeneutik und Religion zwar mit einem gewissen Stolz, befriedigen aber nicht sein Bedürfnis nach einer lenkenden politischen Rolle. Diese Tatsache belegt ein Ausschnitt aus seiner Schrift „De divinatione“
„Denn in Schriften gab ich mein Urteil ab, in ihnen sprach ich zum Volk; die Philosophie,
so meinte ich, war mir an die Stelle der Staatsverwaltung getreten. Jetzt, da man begonnen
hat, mich hinsichtlich der Politik zu konsultieren, muss ich dem Staat alle meine Kraft widmen
oder vielmehr ihm alle Überlegung und Sorge zuwenden, und darf nur so viel für diese Studien
erübrigen, wie mir die öffentliche Pflicht und Tätigkeit erlauben.“
Offensichtlich befand sich Cicero in einem ständigen Wechselspiel zwischen Resignation, die ihn stärker an seinen Studien arbeiten ließ und erneuter Hoffnung auf politische Wirksamkeit, die ihn wieder von diesen entfernte.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Entstehung seines bedeutenden staatstheoretischen Schrift „De re publica“ zu sehen.
[...]
Die vorliegende Arbeit möchte in erster Linie klären, welche Vorstellung Cicero von einem „guten Staat“ hat. Was für ein Staatsverständnis liegt diesem zugrunde und was für eine Machtverteilung ist vorgesehen? Um angemessene Antworten auf diese Fragen geben zu können, werden zunächst einige Definitionen vorgenommen, bevor im Anschluss eine Verfassungsanalyse folgt, in der nicht nur die Einzelverfassungen, sondern auch deren Entartungen und letztendlich die Mischverfassung Berücksichtigung finden.Um Ciceros Bild von einem „guten Staat“ abzurunden, schließt sich eine Darstellung des Staatslenkers an.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wesen und Ursprung des Staates
- Das Gemeinwesen – Der Versuch einer Definition
- Die Verfassungsanalyse
- Die Einzelverfassungen Monarchie, Aristokratie und Demokratie
- Entartungen und Verfassungskreislauf
- Die ideale Staatsform
- Die beste Einzelverfassung – Der Übergang zur Mischverfassung
- Die beste Verfassung - Die Mischverfassung
- Der römische Staat
- Der Staatslenker
- Das Wesen des Staatslenkers
- Die Aufgaben des Staatslenkers
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ciceros Vorstellung von einem „guten Staat“ in seiner Schrift „De re publica“. Sie klärt die Grundlagen seines Staatsverständnisses und die von ihm vorgeschlagene Machtverteilung.
- Ciceros Definition des Gemeinwesens (res publica) und seine Verbindung zum Volk (populus)
- Analyse der Einzelverfassungen: Monarchie, Aristokratie und Demokratie
- Die Mischverfassung als ideale Staatsform
- Der Staatslenker: Eigenschaften und Aufgaben
- Die Rolle der Gerechtigkeit und der Unterdrückung leidenschaftlicher Begierden in der Staatsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Ciceros politische Karriere und seine Schriften in den Kontext seiner staatstheoretischen Arbeit "De re publica". Sie beleuchtet seine Motivation, sich mit der Frage der besten Staatsform auseinanderzusetzen, und die politische Krise Roms, die ihn zu dieser Beschäftigung führte.
Wesen und Ursprung des Staates
Dieses Kapitel behandelt Ciceros Definition des Gemeinwesens (res publica). Es analysiert den Zusammenhang zwischen dem Gemeinwesen und dem Volk (populus) und argumentiert, dass die res publica nicht nur einen Zustand, sondern eine aktive Form des Gemeinwesens darstellt, in der das Volk Träger der Staatsgewalt ist.
Die Verfassungsanalyse
Dieses Kapitel untersucht die drei Einzelverfassungen Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Es beleuchtet die Vor- und Nachteile jeder Form und die Gefahren, die mit der Konzentration von Macht in einem einzigen Herrscher oder in einer kleinen Gruppe von Menschen verbunden sind. Cicero argumentiert, dass eine gute Staatsführung durch die Unterdrückung leidenschaftlicher Begierden und durch Gerechtigkeit gekennzeichnet ist.
Die ideale Staatsform
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Ciceros Argumenten für die Mischverfassung als die beste Form der Staatsführung. Es zeigt, wie die Mischverfassung die Vorteile der Einzelverfassungen vereint und gleichzeitig deren Nachteile minimiert.
Schlüsselwörter
Cicero, De re publica, Staatsform, Gemeinwesen, res publica, populus, Monarchie, Aristokratie, Demokratie, Mischverfassung, Staatslenker, Gerechtigkeit, libertas, Machtverteilung, politische Krise, römischer Staat.
- Quote paper
- Anna Hillebrand (Author), 2009, Cicero als politischer Denker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144167