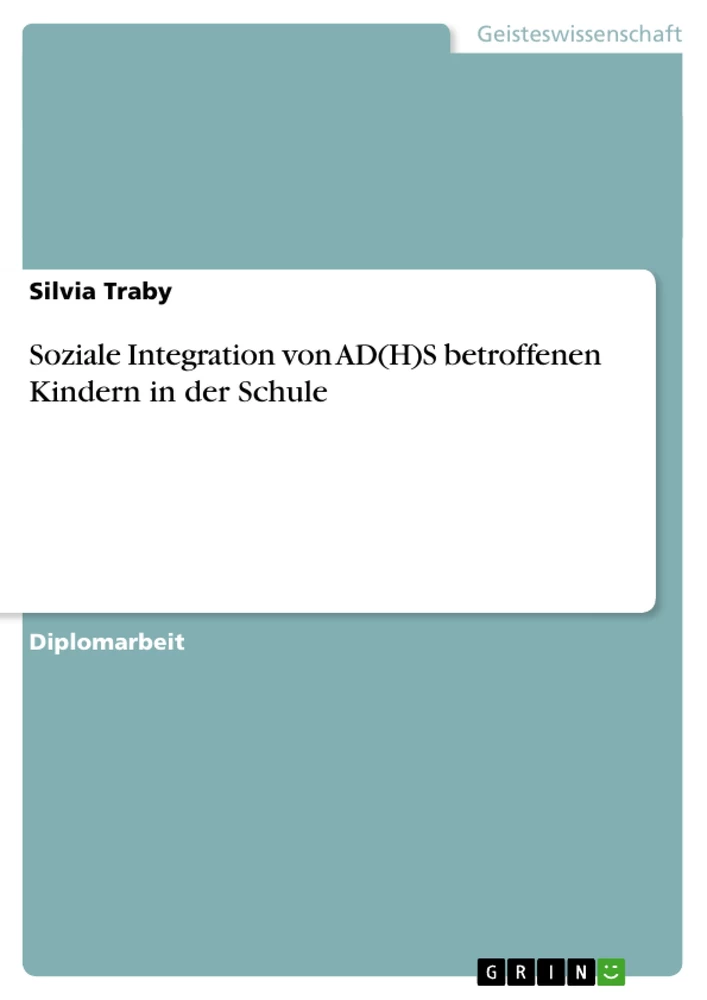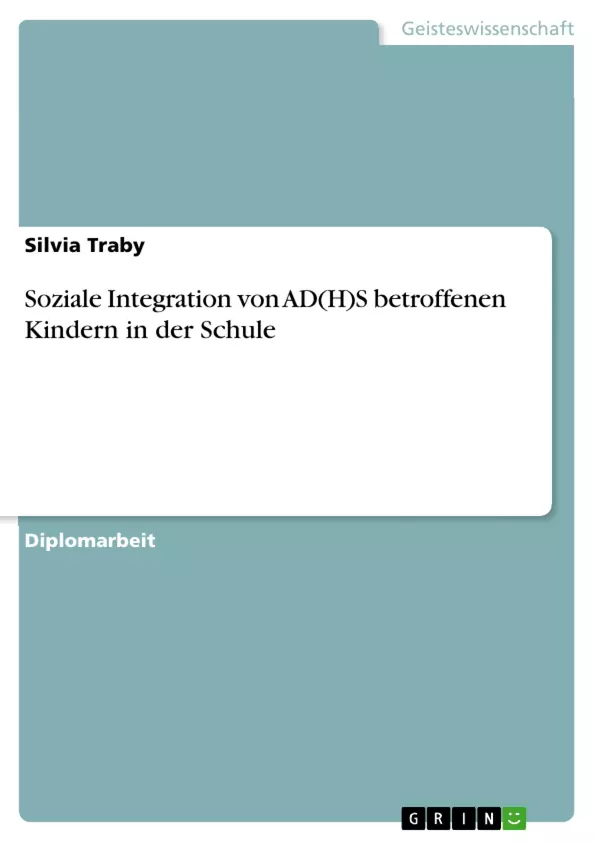Der Begriff der Integration gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung. Er ist derzeit in aller Munde und kommt vielseitig zur Anwendung, daher
wird auch eine genaue Definition immer schwieriger. Im Zusammenhang mit dem
Integrationsbegriff verbindet man vor allem die gesellschaftliche Eingliederung von
Menschen mit fremder Herkunft, Sprache und Religion. Weiters verbindet man mit
dem Fachbegriff auch die Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw.
Behinderungen in das „normale“ gesellschaftliche Leben, in die Lebensbereiche der
Schule, Arbeit und Freizeit.
Im Speziellen werde ich mich in vorliegender Diplomarbeit auf die „schulische
Integration“ lern – und verhaltensbeeinträchtigter Kinder, welche das Störungsbild
ADHS aufweisen, konzentrieren. Diese Störungsform zeigt sich häufig erst mit dem
Eintritt in die Schule. ADHS weist ein sehr umfangreiches Krankheitsbild mit vielen
verschiedenen, unterschiedlich ausgeprägten Symptomen auf. Die betroffenen
Schüler sind durch die Hauptsymptome (Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität,
Impulsivität) oft nicht in der Lage dem Unterricht zu folgen bzw. ermöglichen es dem
Lehrer nicht einen geordneten Unterricht zu führen und werden deshalb vielfach zum
Außenseiter. Das Erscheinungsbild der Störung kann von Kind zu Kind deutlich
unterschiedlich sein und verändert sich auch mit dem Heranwachsen. Die
Diagnoseerstellung gestaltet sich daher sehr schwierig und erfordert einen hohen
Arbeitsaufwand und viel Erfahrung. Die Basis einer erfolgreichen Therapie dieser
Störungsform ist eine vernetzte Zusammenarbeit zwischen Therapeuten, Eltern und
Schule. Die Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs spielt hier eine
zentrale Rolle. Erst dadurch kann man den Kindern die benötigte besondere
Unterstützung in der Schule ermöglichen.
Die Probleme, welche mit diesem Störungsbild einhergehen, führen nicht selten zu
einer problematischen Schullaufbahn, welche sich durch Klassenwiederholungen
oder mehrmaligen Schulwechsel äußern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Gliederung der Arbeit
- 1.2. Die integrative Schule - eine Schule für Alle
- 1.3. Bildungssystem in Österreich
- 2. Allgemeine Einführung in den Themenbereich der Sozialen Integration
- 2.1. Integration als gesellschaftlicher Auftrag
- 2.2. Begriffsdefinition Integration
- 2.2.1. Schulische Integration
- 2.2.2. Vorraussetzungen für schulische Integration
- 2.3. Behinderungsbegriff
- 2.3.1. Lernbehinderung
- 2.4. Begriffsdefinition Sonderpädagogischer Förderbedarf
- 3. Historische Entwicklung der Schulischen Integration in Österreich
- 3.1. Allgemeine historische Einführung
- 3.2. Geschichte Sonderschulen
- 3.2.1. Sonderschulen in der Zeit des Nationalsozialismus
- 3.2.2. Sonderschulen nach dem 2. Weltkrieg
- 3.3. Entwicklungslinien schulischer Integration in Österreich ab den späten 60iger Jahren
- 3.3.1. Gesetzliche Entwicklungen schulischer Integration
- 4. Gesetzliche Grundlagen für die schulische Integration
- 4.1. Schulische Integration in der Praxis
- 4.2. Schule und Behinderung – die aktuelle Situation in Österreich
- 5. Schulische Integrationsmodelle in Österreich
- 5.1. Integrative Klasse
- 5.2. Klassen mit Stützlehrersystem
- 5.3. Kooperative Klasse
- 5.4. Klein- oder Förderklasse
- 6. Einführung das Störungsbild der ADHS
- 6.1. Gegenwärtiger Kenntnisstand der ADHS
- 6.2. ADHS eine Krankheit?
- 7. Begriffsdefinition ADHS
- 8. Symptomatik
- 8.1. Unaufmerksamkeit
- 8.2. Hyperaktivität
- 8.3. Impulsivität
- 9. Ursachen der Störung
- 9.1. Physiologische Faktoren
- 9.2. Genetische Faktoren
- 9.3. Psychosoziale Faktoren
- 9.4. Soziokulturelle Faktoren
- 9.5. Schwangerschafts- und Geburtsfaktoren
- 9.6. Weitere Faktoren
- 10. Diagnostische Kriterien
- 10.1. ICD-10
- 10.2. DSM-IV
- 11. ADHS Diagnostik
- 11.1. Differenzialdiagnose
- 11.2. Komorbiditäten
- 11.2.1. Oppositionelles Trotzverhalten
- 11.2.2. Angststörungen
- 11.2.3. Depressive Störungen
- 11.2.4. Störung des Sozialverhaltens
- 11.2.5. Tic-Störungen und Tourette-Syndrom
- 11.2.6. Entwicklungsstörungen, Lernstörungen, Teilleistungsschwächen
- 11.2.7. Gesundheitliche oder medizinische Probleme
- 11.3. Die diagnostischen Ebenen bei ADHS
- 11.3.1. Exploration des Umfeldes
- 11.3.2. Exploration des Kindes
- 11.3.3. Verlaufskontrolle
- 11.3.4. Standardisierte Fragebögen
- 11.3.5. Testpsychologische Untersuchung
- 11.4. Diagnose ADHS
- 11.4.1. Teufelskreis des hyperkinetischen Kindes
- 12. Entwicklung des ADHS betroffenen Kindes
- 12.1. Kindheit
- 12.2. Jugend
- 12.3. Erwachsenenalter
- 13. Therapie der ADHS
- 13.1. Konzept der Multimodalen Therapie
- 13.2. Verhaltenstherapie
- 13.3. Elterntraining
- 13.4. Stimulanzientherapie
- 13.5. Ergotherapie
- 13.6. Marburger Trainings
- 14. AD(H)S und Schule: Pädagogische Ansätze
- 14.1. Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Schulbesuch
- 14.1.1. Die Rolle des Lehrers
- 14.2. Allgemeine pädagogische Maßnahmen für den Umgang mit ADHS Kindern im Unterricht
- 14.2.1. Lernumfeld
- 14.2.2. Strukturierung der Unterrichtsstunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der sozialen Integration von Kindern mit AD(H)S in der Schule. Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration dieser Kinder in das österreichische Bildungssystem zu entwickeln. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, verschiedene Integrationsmodelle und die Bedeutung von pädagogischen Ansätzen beleuchtet.
- Die Bedeutung von Inklusion im österreichischen Bildungssystem
- Die Herausforderungen der Integration von Kindern mit AD(H)S in die Schule
- Mögliche Integrationsmodelle und ihre praktische Umsetzung
- Pädagogische Maßnahmen für den Umgang mit AD(H)S Kindern im Unterricht
- Die Rolle des Lehrers in der Integration von Kindern mit AD(H)S
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in das Thema der sozialen Integration von Kindern mit AD(H)S in der Schule ein. Es werden die Ziele der Arbeit und die Gliederung der Arbeit erläutert. Die integrative Schule als eine Schule für alle wird beschrieben und das österreichische Bildungssystem im Kontext der Integration wird beleuchtet.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem allgemeinen Konzept der sozialen Integration. Der gesellschaftliche Auftrag, die Begriffsdefinition und die Voraussetzungen für schulische Integration werden erörtert. Darüber hinaus wird der Begriff der Behinderung im Allgemeinen und speziell die Lernbehinderung beleuchtet. Der Begriff "Sonderpädagogischer Förderbedarf" wird ebenfalls definiert.
- Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung der schulischen Integration in Österreich. Es werden die Anfänge von Sonderschulen und deren Entwicklung in verschiedenen Zeitabschnitten beschrieben. Die gesetzlichen Entwicklungen ab den späten 60er Jahren, die zu einer verstärkten Integration führten, werden ebenfalls beleuchtet.
- Kapitel 4 behandelt die gesetzlichen Grundlagen für die schulische Integration in Österreich. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die aktuelle Situation von Schule und Behinderung in Österreich dargestellt.
- Kapitel 5 befasst sich mit verschiedenen schulischen Integrationsmodellen in Österreich. Die Integrative Klasse, Klassen mit Stützlehrersystem, die Kooperative Klasse und die Klein- oder Förderklasse werden vorgestellt und ihre spezifischen Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten werden diskutiert.
- Kapitel 6 bietet eine Einführung in das Störungsbild der ADHS. Der aktuelle Kenntnisstand und die Frage, ob ADHS als Krankheit betrachtet werden kann, werden erörtert.
- Kapitel 7 widmet sich der Begriffsdefinition von ADHS. Es werden die wesentlichen Merkmale und Definitionen dieser Störung erläutert.
- Kapitel 8 beschreibt die Symptomatik von ADHS. Die drei Kernsymptome - Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität - werden ausführlich dargestellt.
- Kapitel 9 untersucht die Ursachen von ADHS. Verschiedene Faktoren wie physiologische, genetische, psychosoziale, soziokulturelle, Schwangerschafts- und Geburtsfaktoren werden als mögliche Einflussfaktoren betrachtet.
- Kapitel 10 behandelt die diagnostischen Kriterien für ADHS. Die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV werden vorgestellt und die relevanten Kriterien für die Diagnose von ADHS werden erläutert.
- Kapitel 11 befasst sich mit der ADHS Diagnostik. Die Differenzialdiagnose, Komorbiditäten und die verschiedenen diagnostischen Ebenen bei ADHS werden im Detail beschrieben. Es werden auch die verschiedenen Methoden zur Diagnose von ADHS vorgestellt, wie z. B. standardisierte Fragebögen und testpsychologische Untersuchungen.
- Kapitel 12 behandelt die Entwicklung des ADHS betroffenen Kindes in verschiedenen Phasen: Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter. Die typischen Herausforderungen und Entwicklungsverläufe in diesen Phasen werden beleuchtet.
- Kapitel 13 beschreibt die Therapie der ADHS. Das Konzept der multimodalen Therapie, die Verhaltenstherapie, das Elterntraining, die Stimulanzientherapie, die Ergotherapie und die Marburger Trainings werden als wichtige Therapieansätze vorgestellt.
- Kapitel 14 befasst sich mit den pädagogischen Ansätzen im Umgang mit Kindern mit AD(H)S in der Schule. Es werden die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Schulbesuch, die Rolle des Lehrers und allgemeine pädagogische Maßnahmen für den Unterricht erörtert.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit widmet sich der Integration von Kindern mit AD(H)S in der Schule, wobei wichtige Themenbereiche wie Inklusion, Bildungssystem, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Diagnostik, Therapie und pädagogische Ansätze beleuchtet werden. Zentrale Begriffe sind dabei "Schulische Integration", "ADHS", "Inklusion", "Integrationsmodelle" und "Pädagogische Maßnahmen".
- Quote paper
- Silvia Traby (Author), 2009, Soziale Integration von AD(H)S betroffenen Kindern in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144272