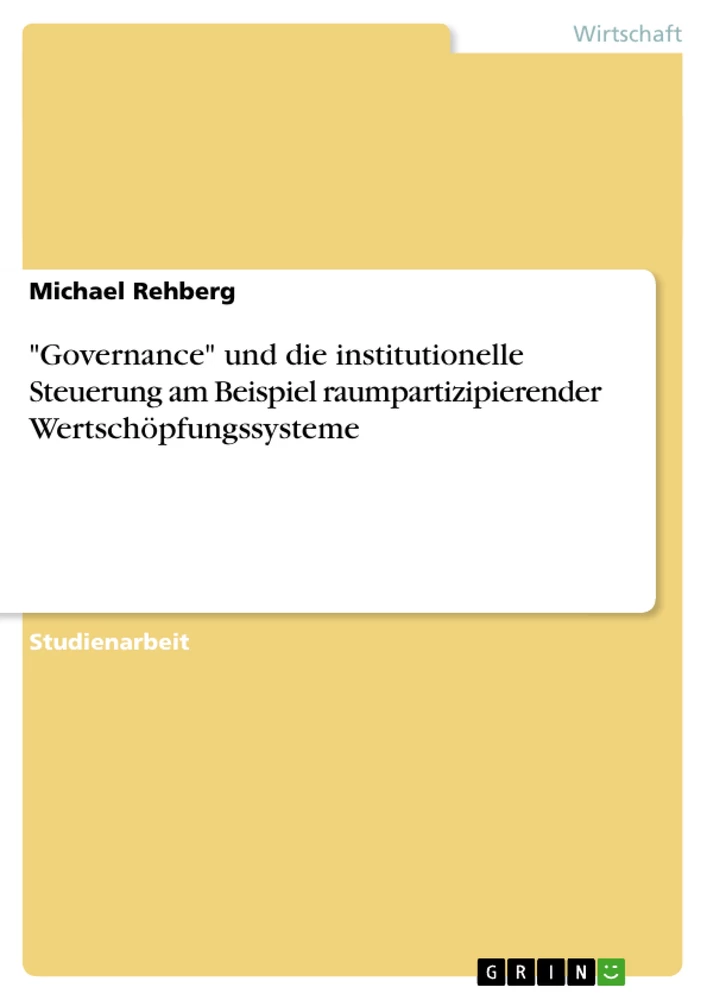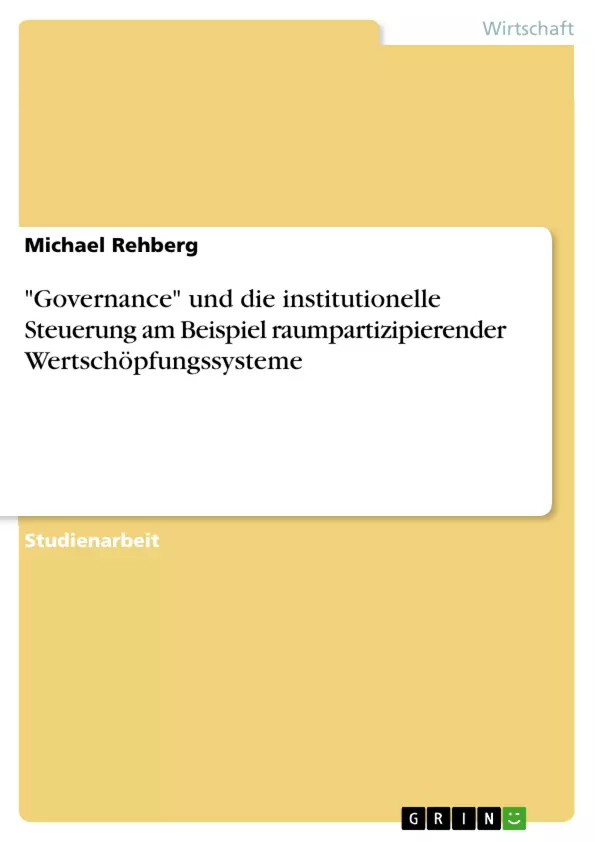Die seit Ende der 1970er Jahre stark frequentierten globalen Interaktionsprozesse komplettieren ein zunehmend vielschichtiges Framework an neuen Herausforderungen für Staat, Ökonomie und Gesellschaft. Die Globalisierung sowie die Informatisierung der Märkte, Beziehungen und Regulierungsformen fördern gleichzeitig räumliche Reorganisationsprozesse mit ökonomisch-funktional orientierten Raumstrukturen. Der Staat vermag die veränderten Anforderungsnormen nicht mehr im Sinne des tradierten administrativen Hierachiemodells zu koordinieren. Neue prozessuale Koordinierungsmodi gewinnen folglich an Relevanz (DILLER ET AL. 2009: S. 3).
Der aktuelle sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsstand erklärt die neuen prozessualen Koordinationsformen unter dem Begriff „Governance“. Zusätzlich analysieren die Raumwissenschaften anwendungsbezogen die Existenz und Entwicklung neuer ökonomischer Raumstrukturen. Die Disziplinen können beiderseits ihre komparativen Stärken in diese interdisziplinare Forschung aus institutionellem Steuerungsverständnis der Wirtschaftsprozesse in einer räumlichen Perspektive einbringen. Der Forschungsstand hinsichtlich der institutionellen Modi innerhalb des ökonomisch-funktional orientierten Raumsystems erscheint lückenhaft (BATHELT 2008) und die rein theorieleitende Arbeit abseits von normativen Fallstudien wird vernachlässigt (BATHELT, GLÜCKLER 2003: S. 90).
Die vorliegende Studienarbeit ist ein Beitrag die Forschungslücke aufzufüllen unter der Fragestellung, inwiefern das prozessuale Management von Interdependenzen durch Institutionen innerhalb des räumlich lokalisierten Wertschöpfungssystems theoretisch erklärt werden kann. Dass Institutionen vorhanden sein müssen, die koordinieren, ist die hypothetische Voraussetzung. Der Text bewegt sich damit in einem rein theoriegeladenen Spannungsfeld.
Diese Arbeit ist im Forschungsbereich der Politischen Ökonomie angesiedelt und gliedert sich, angelehnt an die drei Wirkungsgefüge, in Prozess, Institution und Politikinhalt. Mit dem (i) Begriff „Governance“ wird im zweiten Kapitel einleitend der Prozess entwickelt sowie definiert. Eine theoretische Analyseperspektive eröffnet die Institutionenökonomie für die (ii) Governance-Institutionen Hierarchie, Markt sowie Netzwerk mit den zugrundeliegenden Steuerungsmechanismen. Eingebettet in den vorgegebenen Analyserahmen wird im dritten Kapitel die (iii) ökonomisch-funktionale Raumstruktur als (Politik-) Inhalt untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Governance-Konzept als Konstrukt
- Governance: Entwicklung und Definition
- Neoinstitutionalismus und die Institutionenökonomie
- Governanceinstitutionen und -mechanismen
- Die Hierarchie
- Der Markt
- Das Netzwerk
- Die institutionelle Steuerung räumlicher Wertschöpfungssysteme.
- Räumliche Wertschöpfungssysteme: Entwicklung und Definition
- Das lokalisierte Wertschöpfungssystem und seine Institutionen
- Die Bedeutung der Institution „Markt“ im Wertschöpfungssystem
- Die Bedeutung der Institution „Netzwerk“ im Wertschöpfungssystem
- Symbiose der institutionellen Perspektiven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Frage, wie das prozessuale Management von Interdependenzen durch Institutionen innerhalb räumlich lokalisierter Wertschöpfungssysteme theoretisch erklärt werden kann. Sie analysiert das Governance-Konzept als ein Konstrukt, das die Steuerung komplexer Interaktionsprozesse in einem globalisierten Kontext beschreibt. Die Arbeit betrachtet die Institutionenökonomie als theoretische Grundlage, um die Rolle von Hierarchie, Markt und Netzwerk als Governance-Institutionen zu untersuchen. Im Fokus steht die institutionelle Steuerung räumlicher Wertschöpfungssysteme, insbesondere die Bedeutung von Markt und Netzwerk innerhalb lokalisierter Systeme.
- Das Governance-Konzept als Instrument zur Steuerung von Interdependenzen
- Die Rolle von Institutionen (Hierarchie, Markt, Netzwerk) in Governance-Prozessen
- Die institutionelle Steuerung räumlicher Wertschöpfungssysteme
- Die Bedeutung von Markt und Netzwerk in lokalisierten Wertschöpfungssystemen
- Symbiose der institutionellen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik von Interdependenzen im Kontext der Globalisierung und der sich verändernden Anforderungen an staatliche Steuerung dar. Die Studienarbeit untersucht die Rolle von Governance-Konzepten als Instrument zur Koordinierung dieser Interdependenzen innerhalb räumlich lokalisierter Wertschöpfungssysteme.
Das Governance-Konzept als Konstrukt
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Governance“ und erörtert seine Entwicklung als Reaktion auf die zunehmende Komplexität der modernen Gesellschaft. Die Institutionenökonomie wird als theoretische Grundlage eingeführt, um die Rolle von Institutionen wie Hierarchie, Markt und Netzwerk im Governance-Prozess zu analysieren.
Die institutionelle Steuerung räumlicher Wertschöpfungssysteme.
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der institutionellen Steuerung räumlicher Wertschöpfungssysteme. Es untersucht die Bedeutung von Markt und Netzwerk als Institutionen innerhalb lokalisierter Systeme und beleuchtet die Symbiose der institutionellen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Governance, Institutionenökonomie, räumliche Wertschöpfungssysteme, Markt, Netzwerk, Hierarchie, Interdependenzen und die institutionelle Steuerung komplexer Prozesse im Kontext der Globalisierung. Weitere wichtige Begriffe sind die Globalisierung, Informatisierung, Regulierung, Koordinierung, räumliche Reorganisationsprozesse und die institutionelle Anpassungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Governance" in dieser Studienarbeit?
Governance beschreibt neue prozessuale Koordinationsformen zur Steuerung komplexer Interdependenzen, die über das klassische hierarchische Staatsmodell hinausgehen.
Welche drei Governance-Institutionen werden analysiert?
Die Arbeit untersucht die Institutionen Hierarchie, Markt und Netzwerk als grundlegende Steuerungsmechanismen.
Was ist ein raumpartizipierendes Wertschöpfungssystem?
Es handelt sich um ökonomisch-funktional orientierte Raumstrukturen, in denen Wertschöpfungsprozesse lokalisiert sind und durch spezifische Institutionen koordiniert werden.
Welche Rolle spielt die Institutionenökonomie in der Arbeit?
Sie dient als theoretische Grundlage, um die Steuerungsmechanismen innerhalb der verschiedenen Governance-Strukturen zu erklären.
Wie beeinflusst die Globalisierung die staatliche Steuerung?
Durch Globalisierung und Informatisierung kann der Staat Anforderungen nicht mehr allein durch Hierarchie bewältigen, weshalb Netzwerke und Märkte an Bedeutung gewinnen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Inwiefern kann das prozessuale Management von Interdependenzen durch Institutionen innerhalb eines räumlich lokalisierten Wertschöpfungssystems theoretisch erklärt werden?
- Citation du texte
- Michael Rehberg (Auteur), 2009, "Governance" und die institutionelle Steuerung am Beispiel raumpartizipierender Wertschöpfungssysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144279