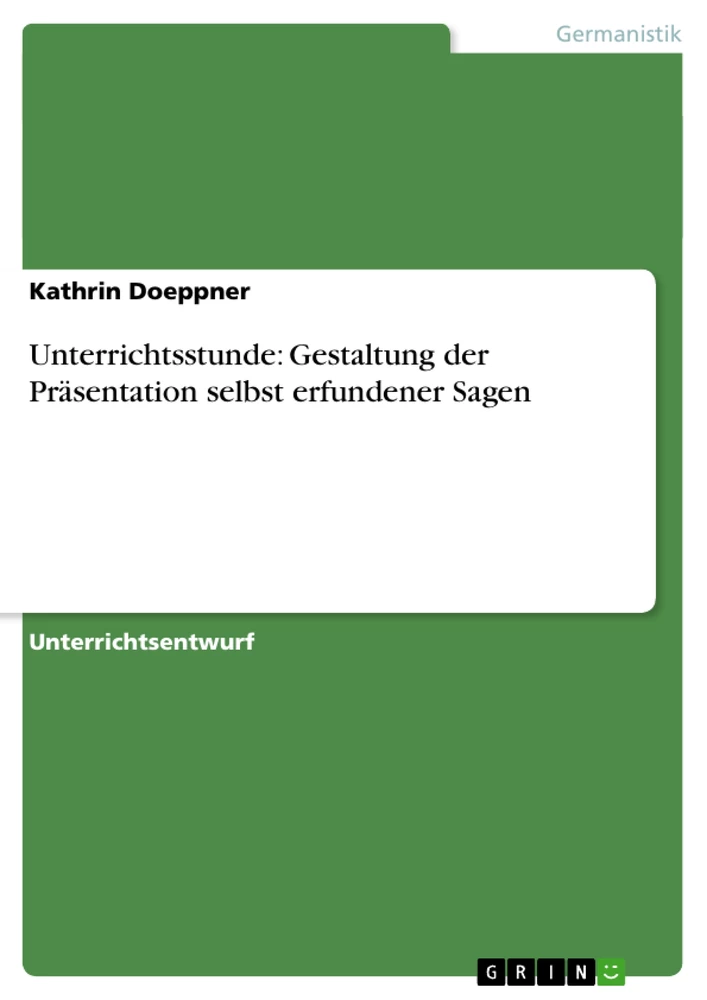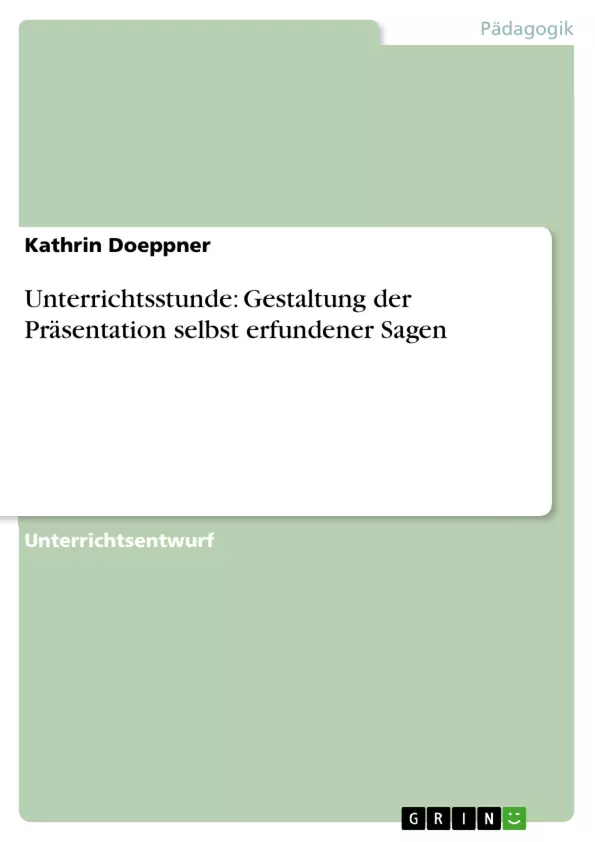Nach den Bildungsstandards der KMK ist Kommunikation ein zentraler Punkt allen schulischen Lernens. Für eine gelingende Kommunikation ist die Entwicklung und Förderung der Sprachkompetenz der Schüler von zentraler Bedeutung.
Ein wichtiger Baustein der kindlichen Sprachentwicklung ist das mündliche Erzählen. Kinder im Grundschulalter entwickeln ihre Sprache an Geschichten, die sie selbst lesen, selbst erzählen, selbst hören, mit denen sie sich auseinander setzen und zu denen sie sich zusammensetzen. Das Erlernen und Ausüben von Erzählen und Zuhören ist eine langfristige Aufgabe für die Grundschule, doch wurde bisher kein entsprechendes erzähldidaktisches Curriculum entwickelt.
Das mündliche Erzählen fördert die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit und wirkt sich auf weitere Kompetenzen wie Kreativität, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und das soziale Miteinander aus.
Wer selbst eine Geschichte vorbereitet und vorträgt, übt sich in der sprachlichen Darstellung, und dies nicht nur im richtigen Gebrauch von Wörtern und grammatischen Regeln, sondern auch im Ausdruck von Gefühlen. Wolf Singer, Neurophysiologe und Direktor des Frankfurter Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, fordert mit Blick auf die Bildungsentwicklung von Kindern, mehr in die Ausdrucksfähigkeit der SchülerInnen zu investieren, und zwar nicht nur in die verbale, sondern auch in die mimische und gestische (Singer: 2003, S. 97f). Wenn Kinder Geschichten erzählen und erzählte Geschichten besprechen und beurteilen, dann erweitern sie ihre Möglichkeiten, Emotionen auszudrücken und zu interpretieren.
Mit der Sprachentwicklung hängt die Entwicklung der kommunikativen und damit auch der sozialen Fähigkeiten zusammen. Dabei konstituiert das Zuhören ein Gemeinschaftserlebnis. Das eigene Vortragen einer Geschichte erweitert die Erfahrungen im Umgang mit den sozialen Herausforderungen gelingender Kommunikation und die Erfahrung des Gelingens stärkt das Selbstvertrauen der Kinder.
Schüler müssen heute in allen Bereichen präsentieren können und werden auch in ihrem weiteren Leben mit dieser Aufgabe konfrontiert werden. Daher ist es wichtig, den Kindern die Kleintechniken eines erfolgreichen Erzählens zu vermitteln, wie Stimmeinsatz, Körperhaltung, Mimik, Gestik und ausdrucksvolles Sprechen.
Der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit liegt auf dem Einüben des gestalteten Erzählens einer selbst erfundenen Sage in der Gruppe für die anschließende Präsentation vor der Klasse.
Inhaltsverzeichnis
- Warum dieses Thema?
- Bezug zum amtlichen Lehrplan
- Bezug zu den Bildungsstandards
- Was ist die Sache beim Thema?
- Sprechstimme
- Gute Artikulation
- Gestaltungsmittel
- Klassensituation
- Leistungssituation im Bereich Sprechen und Gespräche führen
- Anmerkungen zu einzelnen Schülern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtsvorbereitung zielt darauf ab, die Schüler der Klasse 3b in die Gestaltung und Präsentation selbst erfundener Sagen einzuführen. Ziel ist es, die mündliche Sprachkompetenz der Kinder zu fördern, ihre Kreativität und Fantasie anzuregen und gleichzeitig das Selbstvertrauen in ihre sprachlichen Fähigkeiten zu stärken.
- Entwicklung der mündlichen Sprachkompetenz
- Steigerung der Kreativität und Fantasie
- Förderung des Selbstvertrauens in der Präsentation
- Anwendung sprachgestalterischer Mittel
- Entwicklung von Sozialkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung mündlichen Erzählens für die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit von Kindern im Grundschulalter. Sie erläutert die Bedeutung des Erzählens für die Entwicklung von Selbstvertrauen und sozialer Kompetenz.
- Der Abschnitt „Bezug zum amtlichen Lehrplan“ stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Bildungsstandards und des Fachprofils Deutsch dar. Die entsprechenden Lernziele werden aufgezeigt.
- Der Abschnitt „Was ist die Sache beim Thema?“ erläutert das Konzept des „Erzählens als gesellige Praxis“ nach Claus Claussen und erklärt die Bedeutung von gestaltetem mündlichen Erzählen.
- Der Abschnitt „Sprechstimme“ beleuchtet die Bedeutung der Stimme als Mittel der sprachlichen und non-verbalen Kommunikation. Die Klangfarbe, die Stimmstärke, das Sprechtempo, die Sprechmelodie und der Sprechrhythmus werden als wichtige Elemente der Sprechstimme hervorgehoben.
- Der Abschnitt „Gute Artikulation“ betont die Wichtigkeit einer aufrechten Haltung und physiologischen Atmung für eine klare Artikulation. Die Verbindung zwischen Artikulation und Standardsprache wird ebenfalls beleuchtet.
- Der Abschnitt „Gestaltungsmittel“ behandelt verschiedene sprachliche und nicht-sprachliche Mittel zur Gestaltung von Erzählungen. Pausen, Betonung, Tempo, Lautstärke, Stimmmodulation, Mimik und Gestik werden als wichtige Gestaltungsmittel vorgestellt.
- Der Abschnitt „Klassensituation“ bietet einen Einblick in die Zusammensetzung der Klasse 3b und beschreibt die soziale und leistungsbezogene Situation der Schüler.
- Der Abschnitt „Leistungssituation im Bereich Sprechen und Gespräche führen“ analysiert die Sprach- und Sprechfähigkeiten der Kinder in der Klasse 3b und beschreibt die unterschiedlichen Lernstände.
- Der Abschnitt „Anmerkungen zu einzelnen Schülern“ stellt besondere Schüler der Klasse 3b vor und gibt detaillierte Informationen zu ihren individuellen Bedürfnissen und Lernschwierigkeiten.
Schlüsselwörter
Mündliches Erzählen, Sprachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Fantasie, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Sprechmotorik, Sprachgestaltung, Sprecherziehung, Sage, Ursprungs-, Erklärungs-, ätiologische Sagen, Weißensberg, Weihergeister, Monster, Präsentation, Bildungsstandards, Sprechstimme, Artikulation, Körpersprache, Mimik, Gestik.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist mündliches Erzählen in der Grundschule so wichtig?
Mündliches Erzählen fördert die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit, steigert die Kreativität und wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen und das soziale Miteinander aus.
Welche Gestaltungsmittel werden beim Erzählen eingesetzt?
Zu den Mitteln gehören die Variation der Sprechstimme (Tempo, Lautstärke, Melodie), der Einsatz von Pausen, sowie Körpersprache wie Mimik und Gestik.
Was sind ätiologische Sagen?
Ätiologische Sagen sind Erklärungs- oder Ursprungssagen. Sie versuchen auf fantasievolle Weise zu erklären, wie bestimmte Orte, Namen oder Naturphänomene entstanden sind.
Wie hängen Sprechstimme und Kommunikation zusammen?
Die Stimme ist ein Instrument zur Übertragung von Emotionen und Bedeutungen. Eine gute Artikulation und bewusster Stimmeinsatz machen den Vortrag lebendig und fesseln die Zuhörer.
Was fordert die moderne Erzähldidaktik?
Sie fordert, mehr in die Ausdrucksfähigkeit der Schüler zu investieren – nicht nur verbal, sondern auch mimisch und gestisch, um eine gelingende Kommunikation in allen Lebensbereichen vorzubereiten.
Wie können Schüler ihre Präsentationskompetenz verbessern?
Durch das Einüben von Kleintechniken wie aufrechter Körperhaltung, Blickkontakt zum Publikum und ausdrucksvollem Sprechen in einem geschützten Rahmen, wie z. B. der Gruppenarbeit.
- Citar trabajo
- Kathrin Doeppner (Autor), 2009, Unterrichtsstunde: Gestaltung der Präsentation selbst erfundener Sagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144368