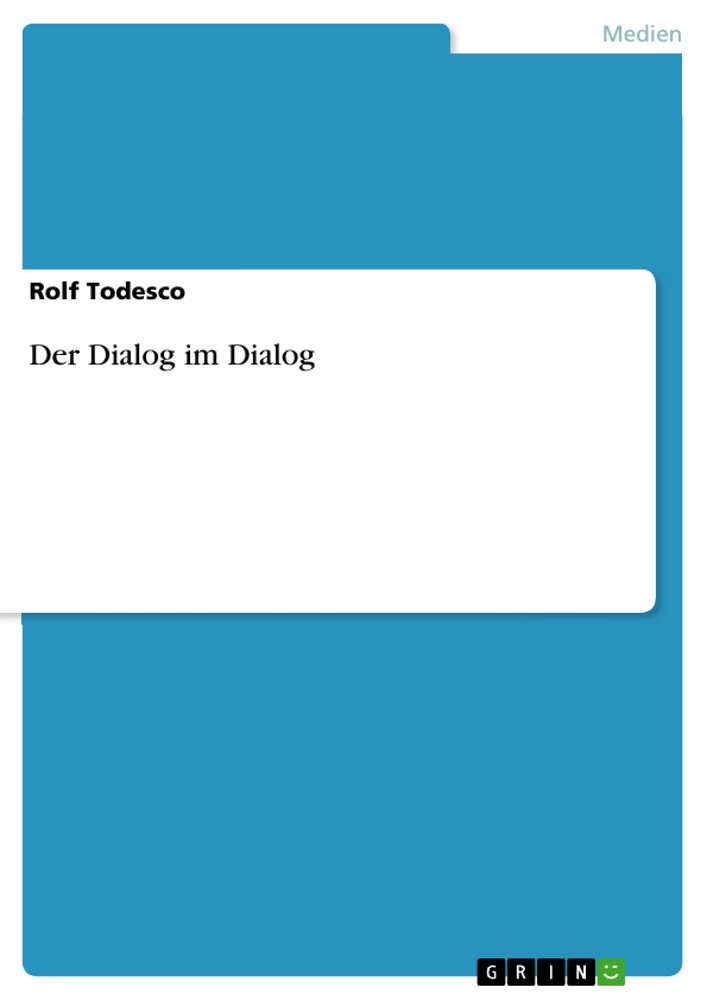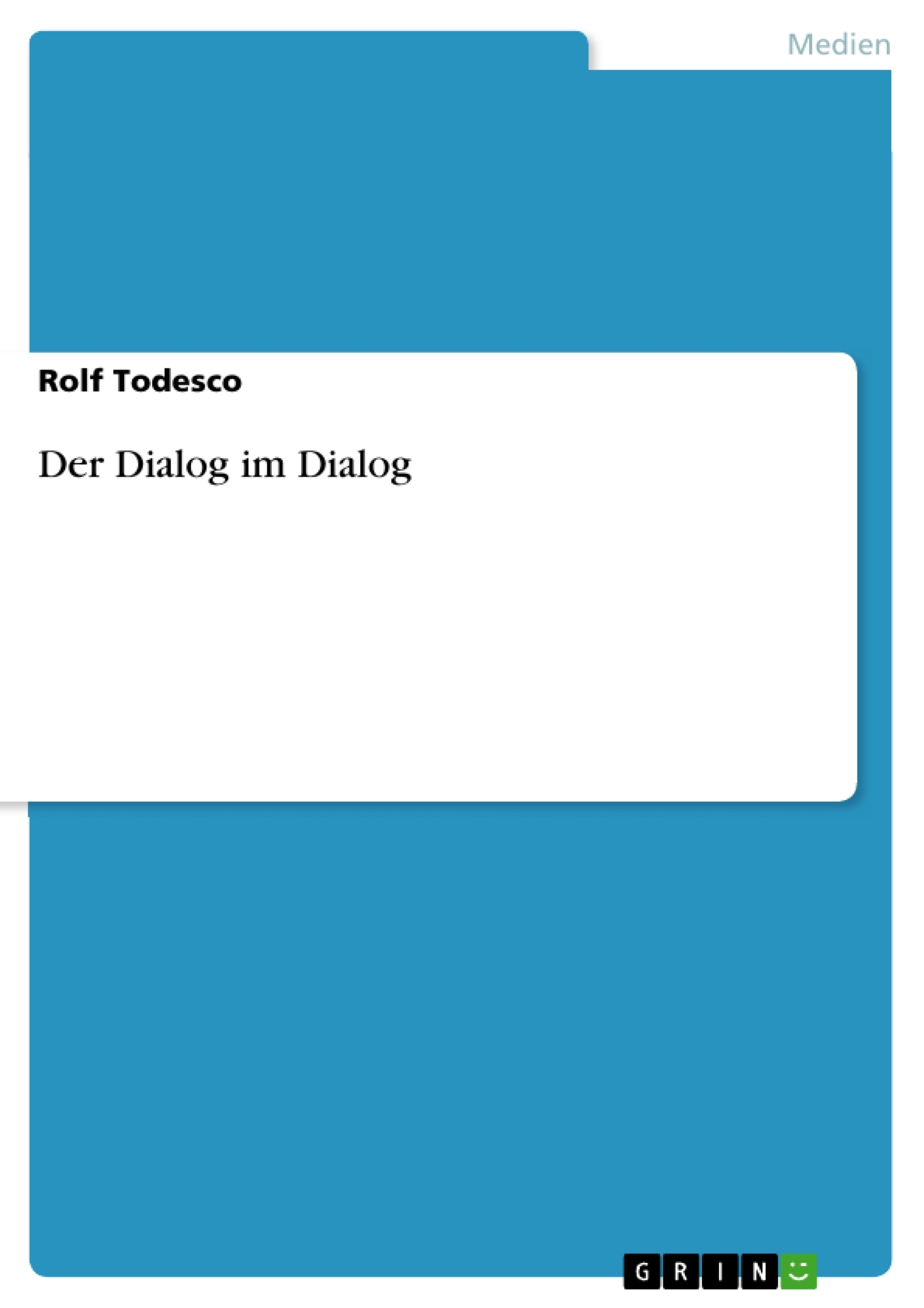Mit Dialog im Dialog lege ich einige Berichte von inszenierten Dialogen vor. Inszeniert werden solche Dialoge in Form von Veranstaltungen, in welchen durch Protokolle darüber, wie man spricht, verhindert wird, dass der Gesprächsgegenstand die Führung darüber übernimmt, was man spricht. Die Protokolle, die die Gesprächsform festlegen, sollen verhindern, dass die Sprechenden zu Subjekten verkommen, die der jeweils verhandelten Sache unterworfen sind. In diesen Dialog sollen nicht die Gesprächsgegenstände bestimmen, was gesagt wird, sondern der Logos durch die Form der Sprache. Die Protokolle verlangen vordergründig, dass die Formulierungen eine bestimmte Form einhalten, so dass ich jedes Mal bevor ich spreche, noch etwas über die Formulierung nachdenken muss. So bleibe ich stets gewahr, dass ich spreche und dass ich das, was ich sage, auf verschiedene Weise sagen könnte, wobei ich dann natürlich Verschiedenes sagen würde. Ich treffe eine Wahl und bedenke so, was ich mit dem, was ich sage und wie ich es sage, aneignen will. Dieses Aneignen verstehe ich als allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ich spreche so, damit mir klarer wird, wie ich zu andern, zum Du spreche.
Solche Dialogveranstaltungen kann man als Fortsetzung der Konversationssalons sehen, in welchen sich die Rhetorik des Mittelalters aufgehoben hat. In der kultivierten Salonkonversation zielt die Aufmerksamkeit immer darauf, dass keine Festschreibungen entstehen, obwohl oder gerade weil in diesen Salons immer die Zeit nach der nächsten angestrebten sozialen Revolution antizipiert wird. Die Konversation betrifft immer die Utopie, die nur erwogen wird, die man auch dort, wo sie sich als Historie gibt, nur erkennen, aber nicht kennen kann. In diesen Dialogen will ich keine Wahrheit finden und nicht darüber sprechen, wie es wirklich ist. Indem ich zum Du spreche, will ich erkennen, was gemeinsam formulierbar ist. Man kann darin eine Erwägungskultur sehen.
Die in unseren Dialogveranstaltungen verwendeten Protokolle stammen nicht aus den aristokratisch-frühbürgerlichen Salons, sondern werden im Dialog selbst entwickelt. In diesen Dialogprotokollen ist die Differenz zwischen Vorschrift und Beschreibung insofern aufgehoben, als jede Dialoggruppe ihre Regeln immer so umschreibt und anpasst, dass sie zum Verhalten der Dialogteilnehmer passen. Anhand des Protokolls kann jede Dialoggruppe erkennen, woran sie sich als Dialoggruppe halten wollte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einladungen
- Ein Anfang
- Fragen im Dialog
- Die Veranstaltung
- Verheissungen
- Wahrheit und Konflikt
- Dialog als Kunst
- Sinn und Verstehen
- Reflexion
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht inszenierte Dialoge und deren protokollierte Verlaufsformen. Ziel ist es, die Rolle des Logos in der Gestaltung von Kommunikation und die Entwicklung dialogischer Haltungen zu erforschen. Die Arbeit basiert auf Erfahrungen mit eigens veranstalteten Dialogrunden, die sich an Konversationssalons des Mittelalters anlehnen.
- Die Rolle des Logos in der Gesprächsführung
- Dialogische Haltungen und ihre Erkundung
- Unterscheidung zwischen "griechisch-wissenschaftlichem" und "jüdisch-gemeinschaftlichem" Dialog
- Die Bedeutung von Protokollen in der Dialoggestaltung
- Das Verhältnis von Form und Inhalt in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert den Ansatz des Buches, welches inszenierte Dialoge präsentiert, bei denen Protokolle die Gesprächsform festlegen und verhindern sollen, dass die Gesprächsgegenstände die Führung übernehmen. Der Fokus liegt auf der Gestaltung des Dialogs durch den Logos und dem bewussten Umgang mit der Formulierung, um eine allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden zu ermöglichen. Die Arbeit wird als Fortsetzung der Konversationssalons des Mittelalters gesehen, wobei der Fokus auf der gemeinsamen Formulierbarkeit liegt und nicht auf der Suche nach Wahrheit.
Einladungen: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel Beschreibungen von Einladungen zu den Dialogveranstaltungen enthält. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Ein Anfang: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel den Auftakt der Dialogveranstaltungen beschreibt. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Fragen im Dialog: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel die Art der Fragen und deren Rolle im Dialog behandelt. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Die Veranstaltung: Dieses Kapitel beschreibt vermutlich den Ablauf und die Struktur der Dialogveranstaltungen im Detail. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.
Verheissungen: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel die Versprechungen oder Erwartungen an die Dialoge thematisiert. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Wahrheit und Konflikt: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel den Umgang mit Wahrheit und Konflikten in den Dialogen thematisiert. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Dialog als Kunst: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel den Dialog als künstlerisches Verfahren betrachtet. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Sinn und Verstehen: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel die Aspekte von Sinnfindung und Verständnis im Dialog beleuchtet. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Reflexion: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel eine Reflexion über die durchgeführten Dialoge und die gewonnenen Erkenntnisse enthält. Da der Text diese nicht explizit beschreibt, kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Dialog, Logos, Kommunikation, Dialogformen, Dialogprotokolle, dialogische Haltungen, Konversationssalon, Wahrheit, Beziehung, Ich-Du-Beziehung, griechisch-wissenschaftlicher Dialog, jüdisch-gemeinschaftlicher Dialog.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Buch: Inszenierte Dialoge
Was ist das Thema des Buches?
Das Buch untersucht inszenierte Dialoge und deren protokollierte Verlaufsformen. Der Fokus liegt auf der Rolle des Logos in der Gestaltung der Kommunikation und der Entwicklung dialogischer Haltungen. Die Arbeit basiert auf Erfahrungen mit eigens veranstalteten Dialogrunden, die an mittelalterliche Konversationssalons angelehnt sind.
Welche Zielsetzung verfolgt das Buch?
Das Buch erforscht die Rolle des Logos in der Gesprächsführung, die Entwicklung dialogischer Haltungen und den Unterschied zwischen „griechisch-wissenschaftlichem“ und „jüdisch-gemeinschaftlichem“ Dialog. Es beleuchtet die Bedeutung von Protokollen in der Dialoggestaltung und das Verhältnis von Form und Inhalt in der Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch beinhaltet Kapitel zu Vorwort, Einladungen, Ein Anfang, Fragen im Dialog, Die Veranstaltung, Verheissungen, Wahrheit und Konflikt, Dialog als Kunst, Sinn und Verstehen, Reflexion und Nachwort. Leider liefert der Text keine detaillierten Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel außer dem Vorwort.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort beschreibt den Ansatz des Buches: Die Präsentation inszenierter Dialoge, bei denen Protokolle die Gesprächsform festlegen sollen, um zu verhindern, dass die Gesprächsgegenstände die Führung übernehmen. Der Fokus liegt auf der Gestaltung des Dialogs durch den Logos und dem bewussten Umgang mit Formulierungen, um eine allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden zu ermöglichen. Die Arbeit wird als Fortsetzung der Konversationssalons des Mittelalters gesehen, mit dem Fokus auf der gemeinsamen Formulierbarkeit und nicht auf der Suche nach Wahrheit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Buch?
Schlüsselwörter sind: Dialog, Logos, Kommunikation, Dialogformen, Dialogprotokolle, dialogische Haltungen, Konversationssalon, Wahrheit, Beziehung, Ich-Du-Beziehung, griechisch-wissenschaftlicher Dialog, jüdisch-gemeinschaftlicher Dialog.
Gibt es detaillierte Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Außer dem Vorwort bietet der Text keine detaillierten Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel. Für die restlichen Kapitel wird lediglich angenommen, worum es thematisch gehen könnte, da der gelieferte Text diese nicht explizit beschreibt.
An wen richtet sich das Buch?
Das Buch richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Kommunikation, Dialogforschung und philosophischen Fragen der Gesprächsführung auseinandersetzt. Der Fokus auf inszenierten Dialogen und die methodische Herangehensweise weisen auf eine wissenschaftliche Zielgruppe hin.
Welche Methode wird im Buch angewandt?
Das Buch basiert auf der Analyse von eigens veranstalteten Dialogrunden, die an mittelalterliche Konversationssalons angelehnt sind. Die Protokolle dieser Dialoge bilden die Grundlage der Untersuchung. Die Methode konzentriert sich auf die Analyse der Form und Struktur des Dialogs und die Rolle des Logos in der Gestaltung der Kommunikation.
- Citar trabajo
- Rolf Todesco (Autor), 2010, Der Dialog im Dialog, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144502