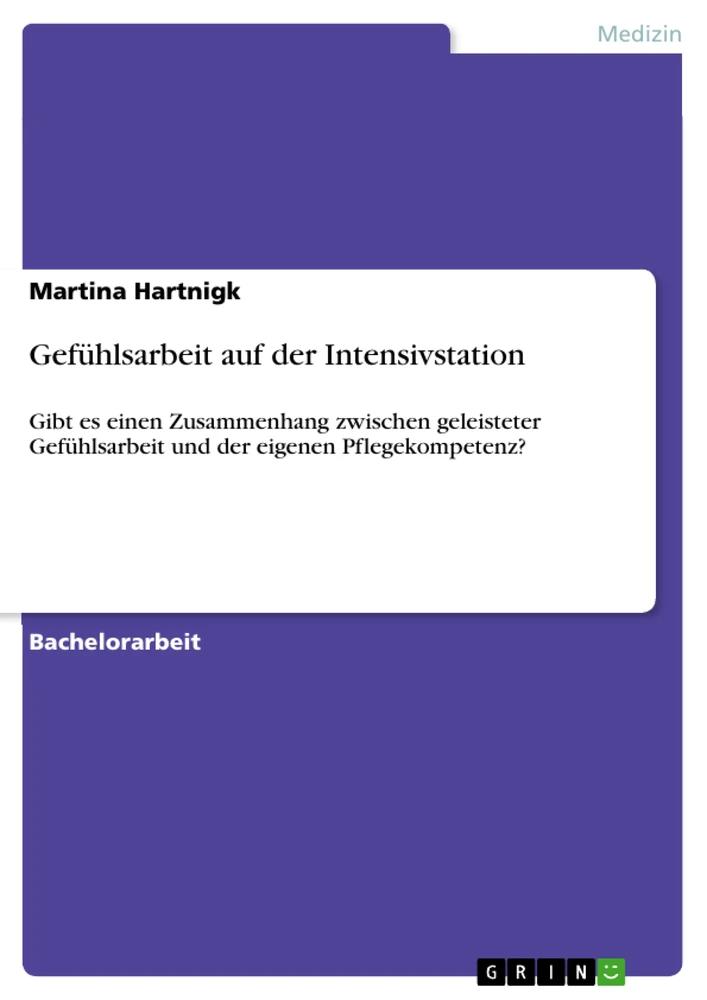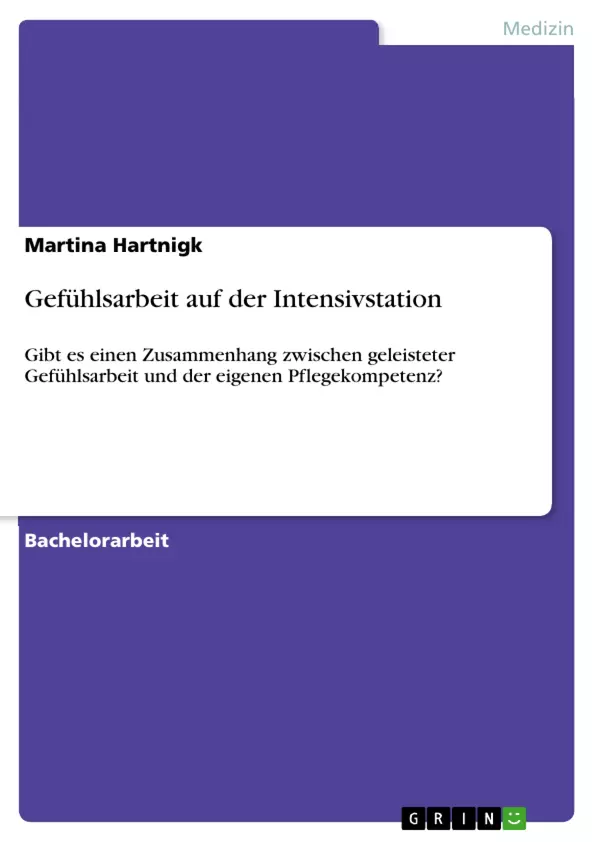Nicht nur das Tätigkeitsfeld einer Pflegekraft auf einer Intensivstation hat sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert. Der Einsatz von Hightech-Geräten hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Intensivmedizin. Medizinische Geräte können die intensivpflichtigen Patient*innen bei der Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen bis hin zur eventuellen Genesung oder Tod unterstützen. Medizinische Geräte reichen ohne eine entsprechende Pflege durch qualifiziertes Personal nicht aus. Intensivpflege durch die Pflegekraft ist sehr anspruchsvoll, nicht zuletzt durch den Umgang der täglich geleisteten Gefühls-/Emotionsarbeit. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwieweit Gefühlsarbeit in den jeweiligen Stufen der Pflegekompetenz geleistet wird und ob es einen Zusammenhang zwischen geleisteter Gefühlsarbeit und der eigenen Pflegekompetenz gibt, des Weiteren die Wichtigkeit und Notwendigkeit der geleisteten Gefühlsarbeit in allen Stufen zur Pflegekompetenz, aber auch die Unterschiedlichkeit. Das in dieser Arbeit vorgestellte „Grol & Wensing Modell zur Implementierung“ von 2007 eröffnet ein Vorgehen, wie Veränderungen - zum Beispiel der Einsatz von Gefühlsarbeit in Intensivpflege - in die tägliche Arbeitsroutine überführt werden können.
Das Forschungsdesign ist eine qualitative Erhebung mittels Leitfadeninterviews (n = 5) mit dem Ziel, die individuellen Sichtweisen der Pflegekräfte über den geleisteten Einsatz darzulegen sowie einen Überblick zu den Chancen und Grenzen der Gefühlsarbeit zu erheben. In der ersten Phase dieser Arbeit wurde eine Literatur- und Studienrecherche durchgeführt. In der zweiten Phase wurden Leitfadeninterviews vorbereitet und durchgeführt. Ein Pretest diente dazu, das Themenfeld zu konkretisieren. Ein statistisches Sampling erfolgte entsprechend zur Pflegekompetenz (n = 5). Da die Fluktuationsrate vom Pflegepersonal besonders in der 2. Stufe „Fortgeschrittene Anfänger*innen“ sehr hoch ist, konnte dort kein Interview durchgeführt werden. Eine Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und aus den Interviews erfolgte in der dritten und letzten Phase.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation der Intensivpflege
- Rahmenbedingungen der Arbeit auf der Intensivstation
- Ökonomische Sachzwänge
- Ethische Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit in der Intensivmedizin
- Pflegekompetenz
- Die Perspektive von Patient*innen, auf der Basis der Bedürfnispyramide
- Gefühlsarbeit in der Pflege
- Distanz und Nähe in der Pflege
- Coping (Stressmanagement = Burn-out Prävention)
- Mitarbeitendenbindung
- Das Leitfadeninterview
- Die Methode
- Vorgehen der qualitativen Untersuchung zur Pflegekompetenz und Gefühlsarbeit auf der Intensivstation
- Die Forschungsfrage
- Demographische Erhebung und Vorbereitung des Leitfadeninterviews
- Die Datenerhebung und die Durchführung eines Leitfadeninterviews
- Die Datenauswertung, Methodik
- Auswertung der Leitfadeninterviews durch eine deduktive Kategorienbildung
- Auswertung des Datenmateriales aus den Leitfadeninterviews/Kodierung
- Ergebnisse
- Ergebnisse des Begriffsverständnisses der Gefühlsarbeit
- Ergebnisse der thematischen Erfahrungen im Umgang mit Gefühlsarbeit
- Ergebnisse der Priorisierung von Gefühlsarbeit
- Ergebnisse der Möglichkeiten beim Erwerb der Kompetenz der Gefühlsarbeit
- Ergebnisse der thematischen Erfahrungen mit „,,Nicht-Gefühlsarbeit“.
- Methodenkritik
- Diskussion
- Fazit
- Ausblick und Vorgehensempfehlung zur Intensivierung von „Gefühlsarbeit auf der Intensivstation“
- Die Rolle von Gefühlsarbeit in der Intensivpflege
- Die Herausforderungen und Chancen der Gefühlsarbeit im Kontext der Intensivstation
- Die Entwicklung von Kompetenzen in der Gefühlsarbeit
- Die Auswirkungen von Gefühlsarbeit auf die Patient*innen und Pflegefachkräfte
- Möglichkeiten zur Förderung der Gefühlsarbeit in der Intensivpflege
- Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Ausgangssituation der Intensivpflege. Sie legt den Fokus auf die Rahmenbedingungen der Arbeit auf der Intensivstation und die damit verbundenen Herausforderungen, wie ökonomische Sachzwänge und ethische Aspekte.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen der Arbeit auf der Intensivstation. Es befasst sich mit Themen wie ökonomischen Sachzwängen, ethischen Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit in der Intensivmedizin, Pflegekompetenz, der Perspektive von Patient*innen, Gefühlsarbeit in der Pflege, Distanz und Nähe in der Pflege, Coping (Stressmanagement = Burn-out Prävention) und Mitarbeitendenbindung.
- Das dritte Kapitel beschreibt die Methode der qualitativen Untersuchung. Es erläutert das Vorgehen der Forschung, die Datenerhebung und -auswertung, die Forschungsfrage und die Demographische Erhebung.
- Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die auf der Analyse der Leitfadeninterviews basieren. Es untersucht das Begriffsverständnis der Gefühlsarbeit, die Erfahrungen im Umgang mit Gefühlsarbeit, die Priorisierung von Gefühlsarbeit, die Möglichkeiten beim Erwerb der Kompetenz der Gefühlsarbeit und die Erfahrungen mit „,,Nicht-Gefühlsarbeit“.
- Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung und setzt sie in Beziehung zu den bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Gefühlsarbeit in der Intensivpflege. Sie analysiert die Erfahrungen von Pflegefachkräften mit der Gefühlsarbeit und erkundet, wie diese ihre Fähigkeiten in diesem Bereich entwickeln und einsetzen. Die Studie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der Gefühlsarbeit in der Intensivpflege zu gewinnen.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themengebiete Gefühlsarbeit, Intensivpflege, Pflegekompetenz, Qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Patient*innen, Ethische Aspekte, Ökonomische Sachzwänge, Stressmanagement, Burn-out Prävention und Mitarbeitendenbindung.- Quote paper
- Martina Hartnigk (Author), 2021, Gefühlsarbeit auf der Intensivstation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1448983