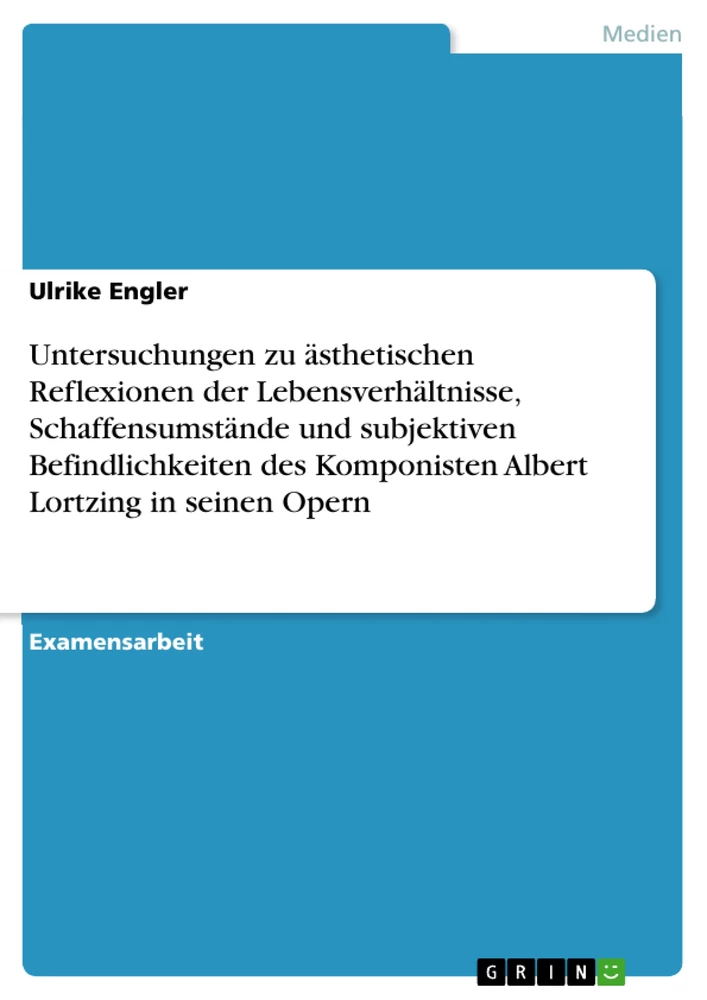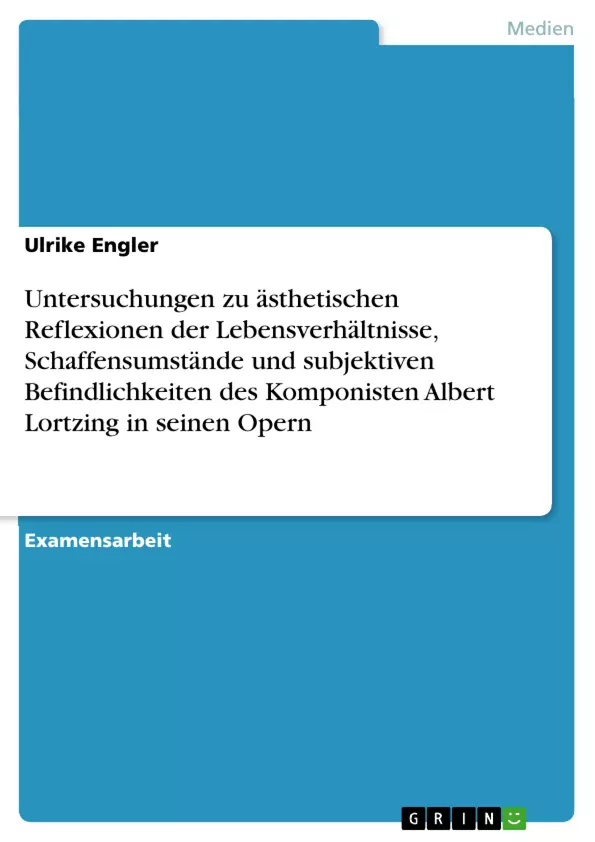Viele Menschen kennen „Zar und Zimmermann“, aber wer ist der Komponist? Gustav Albert Lortzing wurde schon zu Lebzeiten verkannt und auch heute würdigt man ihn nicht genügend. Seien es falsche Daten an der Gedenktafel in Leipzig oder nicht beachtete Opern. Wer weiß schon, dass der Begründer der deutschen Volksoper auch die Kompositionen zu bekannten Volksliedern, wie „Ein Männlein steht im Walde“, „Alle Vöglein sind schon da“, „Winter ade“, „Morgen Kinder wird’s was geben“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, eingerichtet hat? Auch heute werden seine Opern als „biedermeierlich“ bzw. „trivial“ abgetan und überspitzt auf der Bühne dargestellt. Doch Lortzing schrieb seine Musik nicht zur puren Unterhaltung, sondern setzte bewusst und explizit sozialkritische Momente in Szene.
Lortzing nimmt im Sammelsurium der Künstler und Musiker des 19. Jahrhunderts eine Randstellung ein. Er ordnet sich nicht in die Reihe der Romantiker wie Mendelssohn, Schubert und Schumann, Weber oder Wagner ein. Seine Ambitionen und Beweggründe, die er in seinen Opern reflektiert, beziehen sich auf sein eigenes Erleben, auf seinen Alltag. Einfluss auf sein Schreiben hatten die familiäre Lage, der Theateralltag und das eigene Streben nach Höherem.
Ende des 18. Jahrhunderts setzte mit der Französischen Revolution eine Entwicklung ein, die neue Kräfte belebte und grundlegende Veränderungen in Europa zur Folge hatte. Lortzing lebte in einer Zeit des Umbruchs, der Neuerungen und der Zensur. Hatte sich im Rokoko das Musikleben in den Adelspalästen abgespielt, so begann im 19. Jahrhundert der Aufschwung des Bürgertums und dessen steigender Einflussbereich. Die Macht- und Gesellschaftsverhältnisse verschoben sich innerhalb der Stände und beeinflussten das Leben vieler Künstler. Ein Kulturleben entstand, wie es vorher nicht aufzufinden war. In dieser Zeit des Wandels eröffneten sich neue Perspektiven und Möglichkeiten, die auch Lortzing aufgegriffen hat.
Lortzings Leben begann auf der Bühne und endete auch mit ihr. Höhepunkte und Niederlagen lassen sich beispielhaft an den Wirkungsstätten seiner beruflichen Laufbahn festmachen. Er wurde durch den Alltag und das Leben am Theater geprägt und geleitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Literatur- und Quellenlage
- Kinder- und Jugendjahre
- Herkunft und Familie
- Die Beziehung zu seinen Eltern und das soziale Umfeld
- Bildung (allgemein und musikalisch)
- Das politische Geschehen in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Wanderjahre
- Musikalische Entwicklung
- Die Detmolder Zeit
- Politisches und gesellschaftliches Umfeld in der kleinen Residenzstadt
- Vom Sohn zum Familienvater
- Schauspieler und Publikumsliebling
- Musikalische Entwicklung – Lehrjahre
- Leipziger Erfolgsjahre
- Politisches Geschehen
- Kulturelle und gesellschaftliche Metropole Leipzig
- Gesellschaftliches Engagement
- Berufliche Laufbahn am Theater
- Die Rolle des Künstlers im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der Frau
- Die berufliche Laufbahn - Das Eitel Sehnen
- Musikalische Entwicklung - Meisterjahre
- Wiener Zeit
- Die politischen Ereignisse um 1848
- Lortzings Wirken am Theater an der Wien
- Lortzing als Freiheitskämpfer
- Die letzten Jahre
- Rückkehr nach Leipzig und Berlin
- „Die Opernprobe“ – Abrechnung mit der Opernwelt
- Zurück in Berlin
- Lortzings Opern
- Zar und Zimmermann
- Vorlage und Handlung
- Peter Michaelow - Idealisierung eines Herrschers
- Van Bett - Karikatur eines Spießbürgers
- Peter Iwanov - Die positive Projektion Lortzings
- Marie - Die Personifizierung von Lortzings Frauenbild
- Hans Sachs - „ein Spiel um Lortzing“
- Anlass und Vorlage
- Hans Sachs
- Obrigkeit und Vaterland
- Künstlerische Anerkennung versus gesellschaftlicher Stand
- Undine
- Vorlage und Entstehung
- Das Streben nach Höherem
- Undine und die Seele
- Undine und das Frauenbild
- Das Elementarreich – Der sehnsuchtsvolle Zufluchtsort
- Die Verbündeten
- Regina – Eine Revolutionsoper ?
- Hintergründe der Entstehung und Rezeption
- Der 1. Akt
- Der 2. Akt
- Der 3. Akt
- Zar und Zimmermann
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Opern von Albert Lortzing und untersucht deren ästhetische Reflexion der Lebensverhältnisse, Schaffensumstände und subjektiven Befindlichkeiten des Komponisten. Sie beleuchtet die Entstehung von Lortzings Werk im Kontext seiner persönlichen Erfahrungen und der historischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts.
- Lortzings Biografie und seine künstlerische Entwicklung
- Die Rolle des Künstlers im 19. Jahrhundert und die Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse in Lortzings Opern
- Das Frauenbild in Lortzings Opern
- Die ästhetischen und musikalischen Besonderheiten von Lortzings Opern
- Die Bedeutung von Lortzings Opern für die deutsche Musikgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Leben und Werk von Albert Lortzing im Kontext der deutschen Musikgeschichte einordnet. Die Einleitung befasst sich mit Lortzings Rolle als Begründer der deutschen Volksoper und mit der Kritik, die seine Werke im Laufe der Zeit erfahren haben.
Kapitel 3 und 4 behandeln Lortzings Kindheit und Jugendjahre sowie seine Detmolder Zeit. Diese Kapitel geben Einblicke in die familiäre Situation, die musikalische Ausbildung und die frühen künstlerischen Anfänge Lortzings.
Kapitel 5 widmet sich Lortzings erfolgreichen Leipziger Jahren. Hier werden seine berufliche Entwicklung am Theater, sein soziales Engagement und die Rolle des Künstlers im 19. Jahrhundert beleuchtet. Die Rolle der Frau in Lortzings Leben und Werk wird ebenfalls untersucht.
Kapitel 6 behandelt die Zeit Lortzings in Wien, in der er am Theater an der Wien wirkte. Die politischen Ereignisse um 1848 und Lortzings Rolle als Freiheitskämpfer werden thematisiert.
Kapitel 7 beschreibt Lortzings letzte Jahre, seine Rückkehr nach Leipzig und Berlin und seine Auseinandersetzung mit der Opernwelt in seinem Werk „Die Opernprobe“.
Kapitel 8 widmet sich einer detaillierten Analyse von Lortzings Opern, insbesondere „Zar und Zimmermann“, „Hans Sachs“, „Undine“ und „Regina“. Die Analyse fokussiert auf die Handlung, die Charaktere, die musikalische Gestaltung und die ästhetischen Besonderheiten der einzelnen Opern.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung, die die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Albert Lortzing, deutsche Volksoper, 19. Jahrhundert, Oper, Lebensverhältnisse, Schaffensbedingungen, subjektive Befindlichkeiten, Sozialkritik, Frauenbild, Theater, Künstler, Gesellschaft, Politik, Musikgeschichte, Analyse, Interpretation.
- Citar trabajo
- Ulrike Engler (Autor), 2002, Untersuchungen zu ästhetischen Reflexionen der Lebensverhältnisse, Schaffensumstände und subjektiven Befindlichkeiten des Komponisten Albert Lortzing in seinen Opern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14490