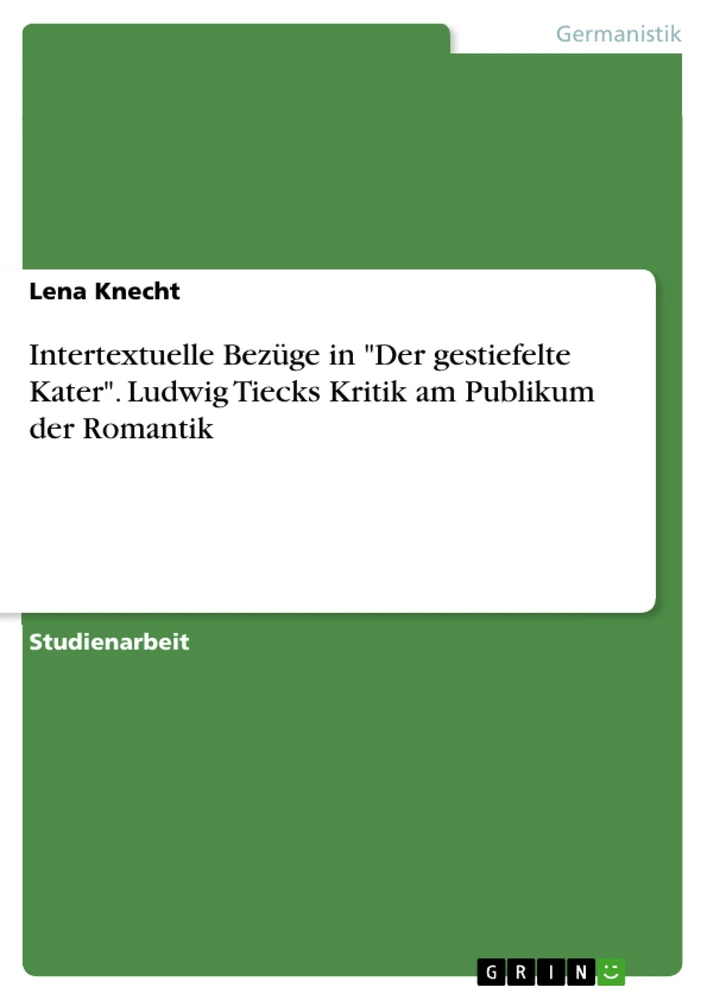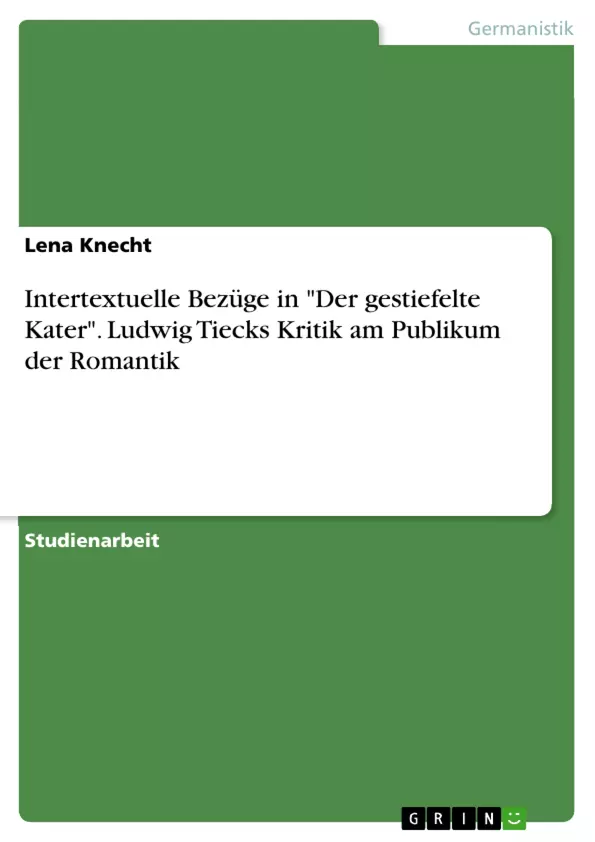In den letzten Jahren hat das Interesse an der Deutung und Darstellung von Literaturkritik in der philologischen Forschung stark zugenommen. Die vorliegende Hausarbeit widmet sich diesem aufstrebenden Forschungsfeld, indem sie die Deutungsmuster und kritischen Ansätze in den intertextuellen Bezügen der romantischen Komödie "Der gestiefelte Kater" von Ludwig Tieck untersucht.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, neue Interpretationsmöglichkeiten für die Literaturwissenschaft aufzuzeigen und weiterzuentwickeln, indem sie sich insbesondere mit der Epoche der Romantik und ihren spezifischen literarischen Merkmalen auseinandersetzt. Dabei wird das Werk von Ludwig Tieck, bekannt als "Der König der Romantik", näher beleuchtet und kritisch hinterfragt.
"Der gestiefelte Kater" ist ein Kindermärchen in drei Akten, das eine fiktive Theateraufführung vor einem ebenso fiktiven Publikum darstellt. Die Geschichte von Bauer Gottlieb und seinem pfiffigen Kater Hinze wird durch zahlreiche Bezüge auf andere literarische und musikalische Werke bereichert und erweitert.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird die zeitgeschichtliche Einordnung des Werkes in die Epoche der Romantik beleuchtet. Dabei wird insbesondere auf die Topoi und charakteristischen Merkmale dieser Epoche eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Fragestellung erörtert, welche Kritik Tieck in "Der gestiefelte Kater" am zeitgenössischen Publikum vorbringt. Dazu werden im zweiten Teil ausgewählte intertextuelle Bezüge analysiert und interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturanalyse
- Die Epoche der Romantik - Zwischen innerer Zerrissenheit und Volksnähe
- Intertextuelle Bezüge als Ausschlusskriterium des Verstehens
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse der intertextuellen Bezüge in Ludwig Tiecks romantischer Komödie „Der gestiefelte Kater“. Ziel ist es, die Deutungsmuster und kritischen Ansätze zu identifizieren, die sich in diesen Bezügen verbergen. Die Arbeit untersucht insbesondere die Epoche der Romantik und ihre spezifischen literaturgeschichtlichen Merkmale im Kontext des Werkes.
- Intertextuelle Bezüge in Tiecks „Der gestiefelte Kater“
- Kritik am zeitgenössischen Publikum in der Romantik
- Die Rolle der Romantik in der Literaturgeschichte
- Die Bedeutung des Rezipienten in der Literatur
- Intertextualität als Ausschlusskriterium des Verstehens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Literaturkritik in der philologischen Forschung dar und führt in die Fragestellung der Hausarbeit ein. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Deutungsmuster und kritischen Ansätze in den intertextuellen Bezügen von Tiecks „Der gestiefelte Kater“.
Literaturanalyse
Die Epoche der Romantik - Zwischen innerer Zerrissenheit und Volksnähe
Dieser Abschnitt erläutert die Epoche der Romantik, ihre historischen und literarischen Merkmale und stellt den Kontext für die Analyse von Tiecks Werk dar. Die Romantik, die als Gegenbewegung zur Klassik verstanden werden kann, thematisiert die Zerrissenheit der Zeit und sucht Trost in der Volksnähe, der Kindheit und der Natur.
Intertextuelle Bezüge als Ausschlusskriterium des Verstehens
Dieser Abschnitt untersucht die Intertextualität in Tiecks „Der gestiefelte Kater“ als Mittel der Kritik am zeitgenössischen Publikum. Die Arbeit analysiert ausgewählte intertextuelle Bezüge und zeigt auf, wie Tieck durch den Einsatz dieser Bezüge eine bestimmte Leserschaft voraussetzt, die über ein spezifisches Vorwissen verfügt. Das Nicht-Verstehen der intertextuellen Bezüge wird als Kritik an der Oberflächlichkeit des Publikums interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Romantik, Literaturkritik, Intertextualität, Publikum, Rezeption, Ludwig Tieck, „Der gestiefelte Kater“, Goethe, Schiller, Mozart, „Die Zauberflöte“ und dem Verhältnis von Autor und Rezipient in der Literatur.
- Quote paper
- Lena Knecht (Author), Intertextuelle Bezüge in "Der gestiefelte Kater". Ludwig Tiecks Kritik am Publikum der Romantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1449575