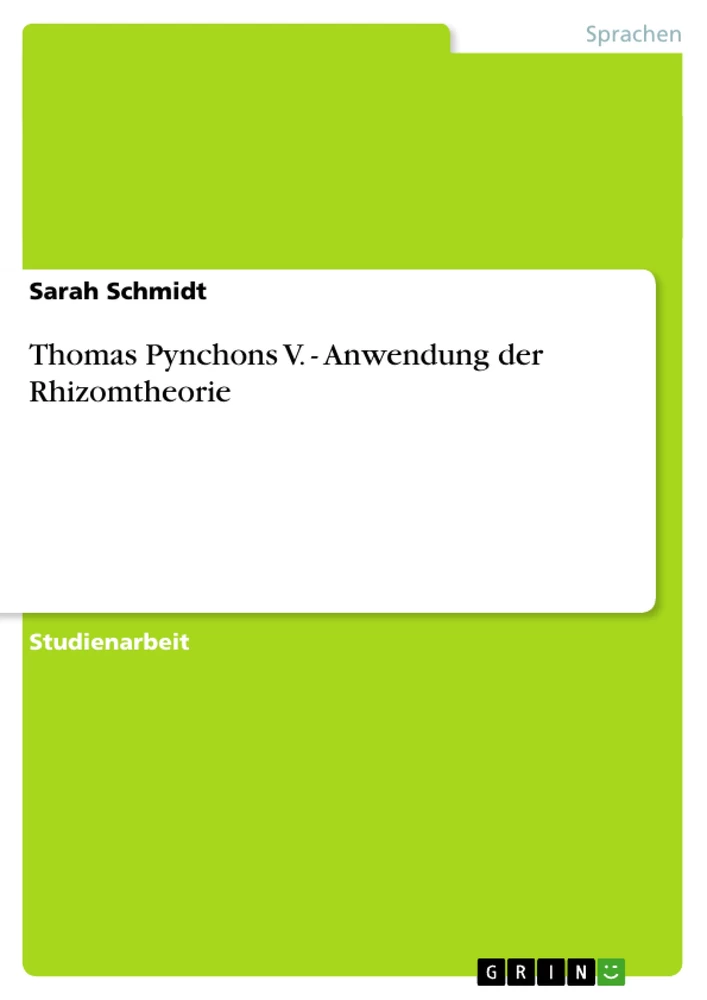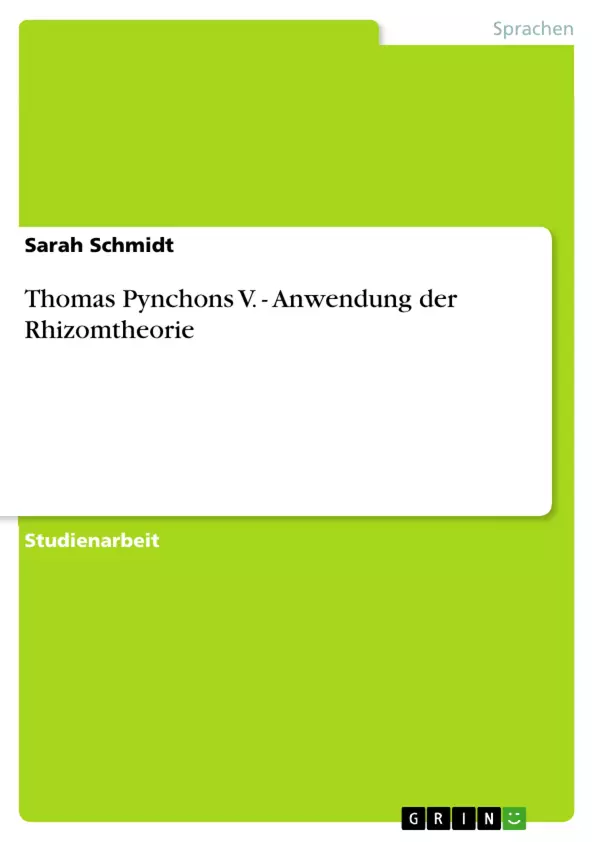Thomas Pynchon gilt als einer der Hauptvertreter der amerikanischen Postmoderne. Sein erster Roman V. wird meist der frühen Postmoderne zugeordnet. So besitzt V. eine große Themenvielfalt, ist collagenhaft angeordnet, bietet eine große Variation von Techniken und Stilen und erlaubt keine einheitliche Deutung.
Die Besonderheit V.s ist aber nicht (allein) seine Postmodernität, sondern die beständige Suche nach Antworten, nach Einheit und Eindeutigkeit und nach Sinn. Diese Suche findet ihre Äußerung im Fehlen eines Zentrums. Statt einer linearen, an einem Zentrum orientierten Erzählung ist V. eine vielfach vernetzte Struktur aus zwei (in sich multiplen) Handlungssträngen, die parallel bzw. gleichzeitig und sich zeitweise berührend und überschneidend zueinander verlaufen.
V. als komplexes Ganzes, als Theorie, entsteht dabei nicht allein durch das Nebeneinander zweier Protagonisten, sondern durch das sinnstiftende Lesen des Rezipienten. Der Leser spiegelt durch seine eigene Sinnstiftung das Thema des Romans (als die Konstruiertheit von Sinn). Das Ergebnis einer solchen Suche ist in der Fiktion dasselbe wie in der Realität: „The world is all that the case is“, oder: Der Roman ist sein Inhalt. Dieser Inhalt ist in V. bereits sehr viel, entscheidend ist aber, dass der Roman nicht mehr ist, nichts zusätzliches.
Gerade die eben herausgestellten Besonderheiten des Romans, sein Vernetzungsaspekt , die damit einhergehende Heterogenität, aber auch die Deutung des Romans unter dem Gesichtspunkt des Wittgensteinschen Zitats kann durch Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Rhizomtheorie präzise beschrieben und analysiert werden. Die 5 Prinzipien der Rhizomtheorie verweisen auf signifikante Eigenschaften V.s und scheinen den Roman besser zu erklären als es die Reduktion auf eine bilineare Struktur vermag.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, das Pynchonsche Geflecht von Handlung als ein solches Rhizom zu lesen. Hierzu wird zunächst die Theorie von Deleuze und Guattari, vor allem an Hand der von ihnen definierten Prinzipien eines Rhizoms erläutert und anschließend auf V. als Ganzes und mittels exemplarischer Details des Romans angewendet. Deleuzes und Guattaris Rhizomtheorie wird in dieser Arbeit pragmatisch besprochen, d.h. dass ideologische Aspekte der Theorie nur insoweit Betrachtung finden, wie sie der Deutung V.s als Rhizom nützlich sind. Ebenso wird V. nicht im Detail besprochen, sondern nur unter rhizomatischen Gesichtspunkten analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rhizomtheorie
- 2.1 Baumstruktur - Rhizom: Abgrenzung und Einleitung
- 2.2 Prinzipien der Rhizomtheorie
- 2.3 Der rhizomatische Text und die Postmoderne
- 3 Thomas Pynchons V.
- 3.1 Besonderheiten des Romans
- 3.2 Anwendung der Rhizomtheorie
- 3.3 Bewertung der Anwendung
- 4 Schlussteil und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Pynchons Roman V. unter Anwendung der Rhizomtheorie von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit und Vernetzung des Romans als ein Rhizom zu verstehen, das durch seine heterogenen Elemente und die fehlende zentrale Einheit gekennzeichnet ist.
- Postmoderne Literatur und ihre Charakteristika
- Die Rhizomtheorie als Gegenmodell zur Baumstruktur
- Das Fehlen eines Zentrums in Pynchons Roman V.
- Vernetzung und Heterogenität als Merkmale des Rhizoms
- Die Bedeutung des Lesers für die Sinnkonstituierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Postmoderne und die Besonderheiten von Thomas Pynchons Roman V. ein. Sie beleuchtet die Vielschichtigkeit und die fehlende zentrale Einheit des Romans, die ihn als ein Beispiel für postmoderne Literatur ausweisen.
Das Kapitel „Rhizomtheorie“ stellt das rhizomatische Ordnungsmodell von Deleuze und Guattari vor und grenzt es von der traditionellen Baumstruktur ab. Es werden die Prinzipien des Rhizoms erläutert, die als Schlüssel zum Verständnis von V. dienen.
Das Kapitel „Thomas Pynchons V.“ beschäftigt sich mit den Besonderheiten des Romans und seiner komplexen Struktur. Es werden die verschiedenen Handlungsstränge, die heterogenen Elemente und die fehlende lineare Erzählstruktur beleuchtet. Die Anwendung der Rhizomtheorie ermöglicht eine tiefergehende Analyse der Vernetzung und Heterogenität des Romans.
Schlüsselwörter
Postmoderne, Rhizomtheorie, Thomas Pynchon, V., Vernetzung, Heterogenität, Vielschichtigkeit, fehlende Einheit, Sinnstiftung, Leserrezeption.
- Quote paper
- Sarah Schmidt (Author), 2007, Thomas Pynchons V. - Anwendung der Rhizomtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144988