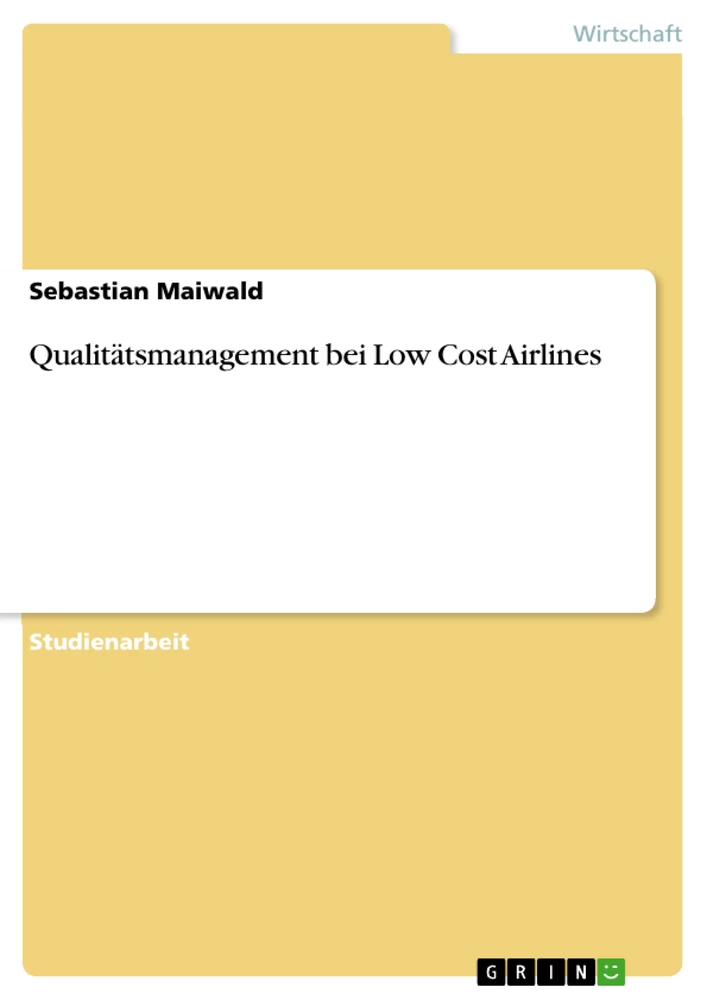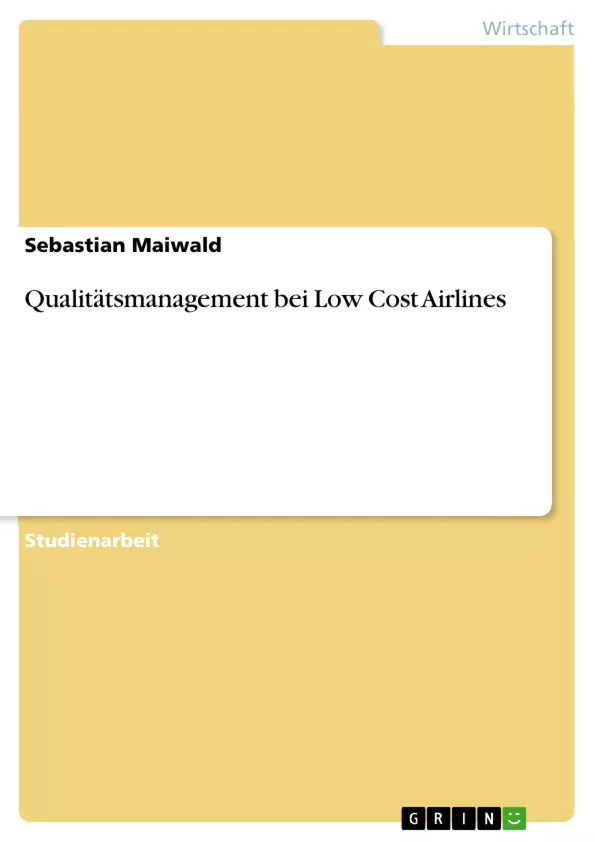Neben theoretischem Hintergrundwissen wird alles anhand von konkreten Beispielen erklärt. Es wird zunächst beschrieben, wie die Airlines ihre günstigen Preise ohne Verzicht auf Sicherheit erzielen können. Anschließend wird die Strategie anhand von Porter thematisiert. Hiebei wird vor allem der Aspekt "umfassende Kostenführerschaft" bearbeitet. Daraufhin wird definiert, welche Komponenten bei der Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems zu berücksichtigen sind und wie man Qualitätsmanagement messen kann. Abschließend werden die Geschäftsmodelle von 8 Vertretern verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Low Cost Carrier
- 2.1 Begriffsbestimmung LCC
- 2.2 Merkmale
- 2.3 Sicherheit
- 2.4 Werbung zur Verkaufsförderung
- 3. Strategieverfolgung nach Porter
- 3.1 Differenzierung
- 3.2 Konzentration auf den Schwerpunkt
- 3.3 Umfassende Kostenführerschaft
- 3.3.1 Nutzung sekundärer Flughäfen und populärer Strecken
- 3.3.2 Hohe Sitzplatzkapazität und Sitzplatzdichte
- 3.3.3 Beschränkung auf ein Flugzeugmuster
- 3.3.4 klares Produktkonzept
- 3.3.5 Vielfliegerprogramme
- 4. Qualitätsmanagement bei Low Cost Airlines
- 4.1 Qualitätsbegriff
- 4.2 Total Quality Management
- 4.3 Qualitätsdimensionen bei Airlines
- 4.4 Messung der Dienstleistungsqualität
- 5. Unterschiedliche Geschäftsmodelle
- 5.1 No Frill
- 5.2 Serviceleistungen inklusive
- 5.3 Business Class
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Qualitätsmanagement bei Low Cost Airlines. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten des Qualitätsmanagements in diesem Bereich. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die zur Sicherung und Steigerung der Qualität bei Low Cost Airlines beitragen.
- Begriffsbestimmung und Merkmale von Low Cost Airlines
- Strategieverfolgung nach Porter und deren Anwendung bei Low Cost Airlines
- Qualitätsmanagementkonzepte und deren Implementierung im Kontext von Low Cost Airlines
- Unterschiede in den Geschäftsmodellen von Low Cost Airlines
- Herausforderungen und Chancen im Qualitätsmanagement bei Low Cost Airlines
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Low Cost Airlines und deren Bedeutung in der heutigen Luftfahrtindustrie. Kapitel 2 definiert den Begriff Low Cost Carrier, beschreibt die wichtigsten Merkmale und beleuchtet die Sicherheitsaspekte. Kapitel 3 analysiert die Strategieverfolgung nach Porter und zeigt auf, wie Low Cost Airlines die Strategie der umfassenden Kostenführerschaft erfolgreich umsetzen. Kapitel 4 widmet sich dem Qualitätsmanagement bei Low Cost Airlines, wobei der Qualitätsbegriff, Total Quality Management und Qualitätsdimensionen im Fokus stehen. Kapitel 5 beleuchtet unterschiedliche Geschäftsmodelle von Low Cost Airlines, wie z.B. No Frill, Serviceleistungen inklusive und Business Class. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gibt.
Schlüsselwörter
Low Cost Airlines, Qualitätsmanagement, Total Quality Management, Kostenführerschaft, Differenzierung, Geschäftsmodelle, No Frill, Serviceleistungen, Business Class, Sicherheit, Werbung, Flughäfen, Sitzplatzkapazität, Flugzeugmuster, Vielfliegerprogramme.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale von Low Cost Carriern (LCC)?
LCC zeichnen sich durch niedrige Ticketpreise, die Nutzung sekundärer Flughäfen, eine hohe Sitzplatzdichte, den Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung und die Beschränkung auf einen Flugzeugtyp aus.
Wie setzen Billigflieger die Kostenführerschaft nach Porter um?
Durch radikale Kostensenkungen in allen Bereichen, wie z.B. Direktvertrieb übers Internet, schnelle Bodenzeiten und den Verzicht auf komplexe Vielfliegerprogramme oder Lounges.
Sparen Low Cost Airlines an der Sicherheit?
Nein, die günstigen Preise werden durch operative Effizienz erzielt. Sicherheitsstandards sind gesetzlich streng reguliert und werden auch von LCC strikt eingehalten.
Was bedeutet „Total Quality Management“ bei Airlines?
TQM ist ein Konzept, das die Qualität in allen Prozessen und Abteilungen verankert, um die Kundenzufriedenheit trotz reduzierter Serviceleistungen (No Frill) sicherzustellen.
Welche Geschäftsmodelle gibt es bei Billigfliegern?
Es wird zwischen dem klassischen „No Frill“-Modell (nur der Flug), Modellen mit inkludierten Serviceleistungen und hybriden Modellen, die sogar eine Business Class anbieten, unterschieden.
- Quote paper
- Sebastian Maiwald (Author), 2009, Qualitätsmanagement bei Low Cost Airlines, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144990