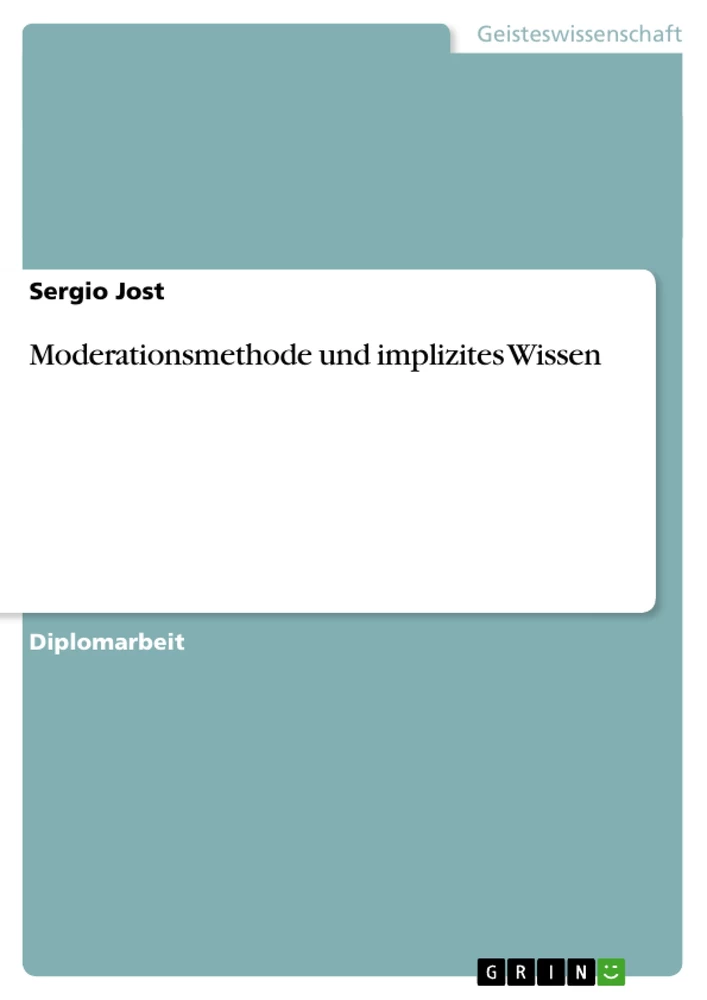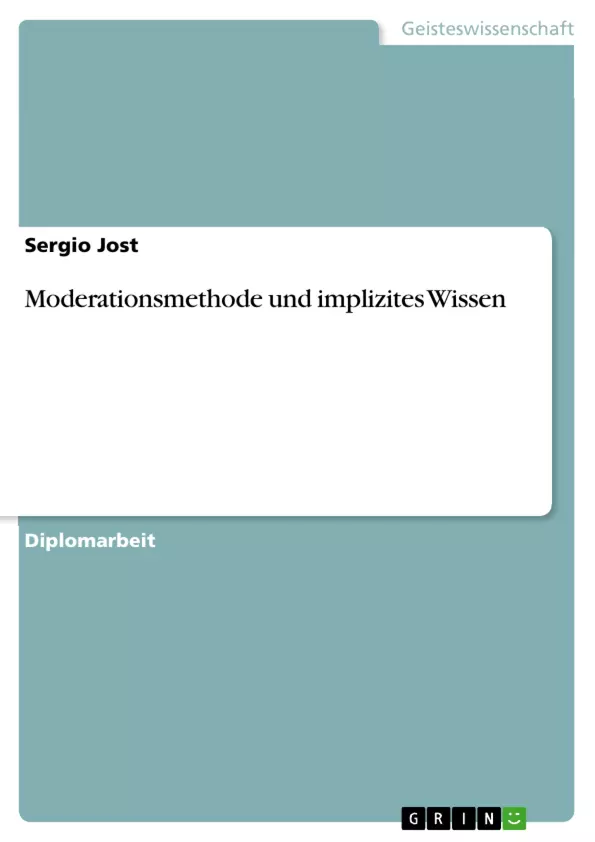In der Helvetia Patria Schweiz fanden zur Evaluation eines Management-Ausbildungsprogramms mehrere Evaluationsworkshops statt. In diesen Workshops war eine Kurzmoderation vorgesehen. Mit Hilfe dieser speziellen Methode erhoffte man sich, einen fundierten Aufschluss über den weiteren langfristigen Ausbildungsbedarf der Manager zu erhalten. Man vermutete, dass durch die Anwendung dieser Methode bei den Teilnehmern ein umfassenderes Wissen abgerufen werden kann, als wenn die Teilnehmer lediglich auf eine einfache Fragebogengestützten Methode nach den weiteren Ausbildungsbedürfnissen zu antworten haben.
Die Diplomarbeit geht der Frage nach, inwiefern diese Vermutung gestützt werden kann und ob es sich bei dem Wissen, das durch die Moderationsmethode visualisiert wird, um implizites Gruppenwissen handelt.
Anhand der theoretischen Aufbereitung und dem Vergleich der Workshopergebnisse kann gesagt werden, dass bei korrekter Anwendung der Moderationsmethode diese Vermutung gestützt werden kann, allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass der experimentelle Nachweis des impliziten Wissens in der Fachliteratur bislang nur unbefriedigend hergestellt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Abgrenzung der Begriffe
- 3. Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- 4. Wissenschaftstheoretische Positionierung
- 5. Implizite Wissenstheorien
- 5.1. Implizites Lernen
- 5.2. Implizites Wissen
- 5.3. Implementierung in die Praxis
- 5.4. Implizites Gruppenwissen
- 5.5. Kritik an der Theorie des impliziten Wissens
- 5.5.1. Problemlösen an computersimulierten Systemen
- 5.5.2. Künstliche Grammatiken
- 5.5.3. Serielle Wahlreaktionsaufgabe
- 6. Moderationsmethode
- 6.1. Momente der Gruppendynamik
- 6.1.1. Strukturdeterminiertheit
- 6.1.2. Soziale Systeme sind komplex
- 6.1.3. Soziale Systeme haben Grenzen
- 6.1.4. Gruppen evolvieren
- 6.1.5. Spontane soziale Ordnung
- 6.2. Funktion und Rolle des Moderators
- 6.3. Basistechnik der Moderation: Visualisierung
- 6.3.1. Trailer
- 6.3.2. Auffächern
- 6.3.3. Gewichten und Vertiefen
- 6.1. Momente der Gruppendynamik
- 7. Gemeinsame Merkmale
- 7.1. Struktur und Salienz
- 7.2. Sozialisation und impliziter Lernmodus
- 7.3. Interaktion und Evolution
- 7.4. Externalisierung und Visualisierung
- 7.5. Vieldeutigkeit und Redundanz
- 8. Evaluation in der betrieblichen Ausbildung
- 9. Evaluationsworkshop bei der Helvetia Patria Schweiz
- 9.1. Beschreibung des Evaluationsworkshops
- 9.1.1. Ziele
- 9.1.2. Inhalte
- 9.2. Kurzmoderation im Evaluationsworkshop
- 9.2.1. Trailer
- 9.2.2. Auffächerung
- 9.2.3. Gewichten und vertiefen
- 9.3. Ergebnisse mit Kurzmoderation
- 9.4. Ergebnisse ohne Kurzmoderation
- 9.1. Beschreibung des Evaluationsworkshops
- 10. Diskussion
- 10.1. Forschungsergebnisse
- 10.2. Forschungsprozess
- 10.3. Validität
- 10.4. Objektivität
- 10.5. Reliabilität
- 10.6. Schlussfolgerungen
- 10.7. Ausblick und weiterer Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz der Moderationsmethode zur Explikation impliziten Wissens in einem Evaluationsworkshop. Ziel ist es, die Eignung dieser Methode zur Erfassung des Wissensbedarfs in der betrieblichen Ausbildung zu evaluieren. Die Arbeit analysiert die Verbindung zwischen implizitem Wissen, Gruppendynamik und Moderationstechniken.
- Explikation impliziten Wissens
- Moderationsmethoden in der betrieblichen Ausbildung
- Gruppendynamische Prozesse und Wissensgewinnung
- Evaluation des Wissensbedarfs
- Anwendung und Wirksamkeit von Moderationstechniken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema implizites Wissen und dessen Bedeutung in der betrieblichen Ausbildung ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Eignung der Moderationsmethode zur Explikation von implizitem Wissen und zur Ermittlung des Wissensbedarfs in der betrieblichen Weiterbildung. Der Bezug zu "prozeduralem Wissen" wird hergestellt, um den Kontext des impliziten Wissens zu verdeutlichen. Die Arbeit hebt die Herausforderung hervor, den tatsächlichen und wesentlichen Ausbildungsbedarf von Mitarbeitern zu identifizieren und von individuellen Bedürfnissen zu unterscheiden.
2. Abgrenzung der Begriffe: Dieses Kapitel klärt den Begriff des impliziten Wissens und grenzt ihn von verwandten Konzepten ab, insbesondere vom prozeduralen Gedächtnis aus der Kognitionspsychologie. Es wird deutlich gemacht, dass implizites Wissen schwer explizierbar ist, im Gegensatz zu explizitem Wissen, und dass es sich um ein ganzheitliches Wissen handelt, das Erfahrungen, Werte und Einstellungen umfasst. Die Verbindung zwischen implizitem Wissen und der Notwendigkeit von Methoden zur dessen Offenlegung wird hergestellt.
5. Implizite Wissenstheorien: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit verschiedenen Aspekten von impliziten Wissenstheorien. Es erörtert implizites Lernen, implizites Wissen, dessen Implementierung in der Praxis, implizites Gruppenwissen und kritische Auseinandersetzungen mit der Theorie. Es werden verschiedene Ansätze zur Erforschung impliziten Wissens vorgestellt, wie zum Beispiel das Problemlösen an computersimulierten Systemen, künstliche Grammatiken und die serielle Wahlreaktionsaufgabe. Das Kapitel liefert eine umfassende Grundlage für das Verständnis von implizitem Wissen und seiner Herausforderungen.
6. Moderationsmethode: Dieses Kapitel beschreibt die Moderationsmethode als Werkzeug zur Förderung von Kreativität und sozialer Interaktion in Gruppenprozessen. Es analysiert die Gruppendynamik im Kontext der Moderation, beleuchtet die Rolle des Moderators und detailliert Basistechniken wie Visualisierung (Trailer, Auffächern, Gewichten und Vertiefen). Der Fokus liegt auf der Methodik als Instrument zur Explikation impliziten Wissens.
7. Gemeinsame Merkmale: Dieser Abschnitt beschreibt die Gemeinsamkeiten zwischen implizitem Wissen und den Prinzipien der Moderationsmethode. Es werden die Aspekte Struktur und Salienz, Sozialisation und impliziter Lernmodus, Interaktion und Evolution, Externalisierung und Visualisierung sowie Vieldeutigkeit und Redundanz untersucht und im Zusammenhang mit der Explikation von implizitem Wissen in Gruppenprozessen analysiert. Das Kapitel verdeutlicht die Synergien zwischen Theorie und Methode.
8. Evaluation in der betrieblichen Ausbildung: Das Kapitel befasst sich mit dem allgemeinen Kontext der Evaluation im Bereich der betrieblichen Ausbildung und legt den Grundstein für die anschließende Fallstudie. Es beschreibt die Bedeutung der differenzierten Abklärung des Wissensbedarfs von Mitarbeitern für das Human Resource Management und die Herausforderungen, den tatsächlichen Ausbildungsbedarf zu identifizieren.
9. Evaluationsworkshop bei der Helvetia Patria Schweiz: Dieses Kapitel dokumentiert den Evaluationsworkshop bei der Helvetia Patria Schweiz, in dem die Moderationsmethode eingesetzt wurde. Es beschreibt die Ziele und Inhalte des Workshops und detailliert die Anwendung der Kurzmoderation. Die Ergebnisse mit und ohne Kurzmoderation werden vorgestellt, um die Effektivität der Methode zu belegen.
Schlüsselwörter
Implizites Wissen, Moderationsmethode, Gruppendynamik, Evaluationsworkshop, betriebliche Ausbildung, Wissensbedarf, Explikation, Visualisierung, Human Resource Management.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Explikation impliziten Wissens mittels Moderation in der betrieblichen Ausbildung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz der Moderationsmethode zur Explikation impliziten Wissens in einem Evaluationsworkshop der Helvetia Patria Schweiz. Das Hauptziel ist die Evaluierung der Eignung dieser Methode zur Erfassung des Wissensbedarfs in der betrieblichen Ausbildung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Verbindung zwischen implizitem Wissen, Gruppendynamik und Moderationstechniken. Sie umfasst verschiedene Aspekte impliziter Wissenstheorien (implizites Lernen, implizites Gruppenwissen, Kritik an der Theorie), die Moderationsmethode (Gruppendynamik, Rolle des Moderators, Visualisierungstechniken), Gemeinsamkeiten zwischen implizitem Wissen und Moderation, Evaluation in der betrieblichen Ausbildung und eine Fallstudie eines Evaluationsworkshops.
Was ist implizites Wissen und wie unterscheidet es sich von explizitem Wissen?
Implizites Wissen ist schwer explizierbar, im Gegensatz zu explizitem Wissen. Es ist ein ganzheitliches Wissen, das Erfahrungen, Werte und Einstellungen umfasst. Die Arbeit grenzt implizites Wissen von verwandten Konzepten ab, insbesondere vom prozeduralen Gedächtnis.
Welche Rolle spielt die Moderationsmethode?
Die Moderationsmethode wird als Werkzeug zur Förderung von Kreativität und sozialer Interaktion in Gruppenprozessen eingesetzt. Die Arbeit beschreibt die Gruppendynamik im Kontext der Moderation, die Rolle des Moderators und detailliert Basistechniken wie Visualisierung (Trailer, Auffächern, Gewichten und Vertiefen). Der Fokus liegt auf der Methodik als Instrument zur Explikation impliziten Wissens.
Wie wird implizites Wissen in der Arbeit expliziert?
Die Explikation impliziten Wissens erfolgt durch den Einsatz von Moderationstechniken in einem Evaluationsworkshop. Die Arbeit beschreibt die Anwendung der Kurzmoderation (Trailer, Auffächern, Gewichten und Vertiefen) und vergleicht die Ergebnisse mit und ohne Kurzmoderation.
Welche Ergebnisse liefert die Fallstudie?
Die Fallstudie dokumentiert einen Evaluationsworkshop bei der Helvetia Patria Schweiz. Die Ergebnisse mit und ohne Kurzmoderation werden präsentiert, um die Effektivität der Moderationsmethode zur Explikation impliziten Wissens und zur Ermittlung des Wissensbedarfs zu evaluieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Implizites Wissen, Moderationsmethode, Gruppendynamik, Evaluationsworkshop, betriebliche Ausbildung, Wissensbedarf, Explikation, Visualisierung, Human Resource Management.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffserklärungen, Fragestellung und Aufbau, wissenschaftstheoretischer Positionierung, impliziten Wissenstheorien, der Moderationsmethode, gemeinsamen Merkmalen von implizitem Wissen und Moderation, Evaluation in der betrieblichen Ausbildung, dem Evaluationsworkshop bei der Helvetia Patria Schweiz (inkl. detaillierter Beschreibung und Ergebnissen) und einer abschließenden Diskussion mit Schlussfolgerungen und Ausblick.
- Quote paper
- Sergio Jost (Author), 2002, Moderationsmethode und implizites Wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14510