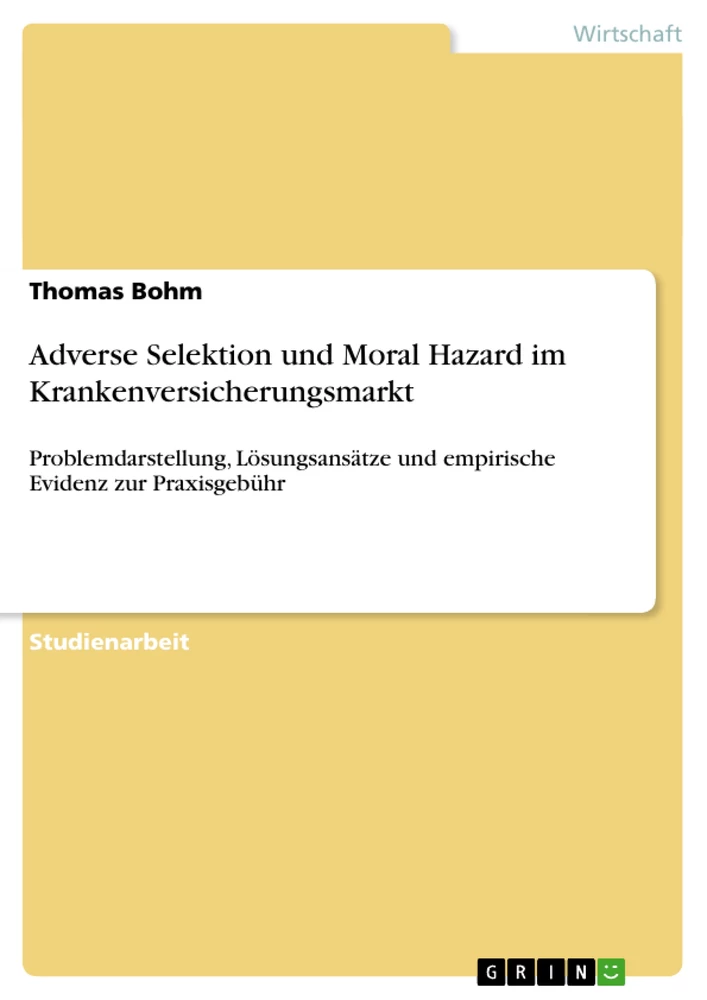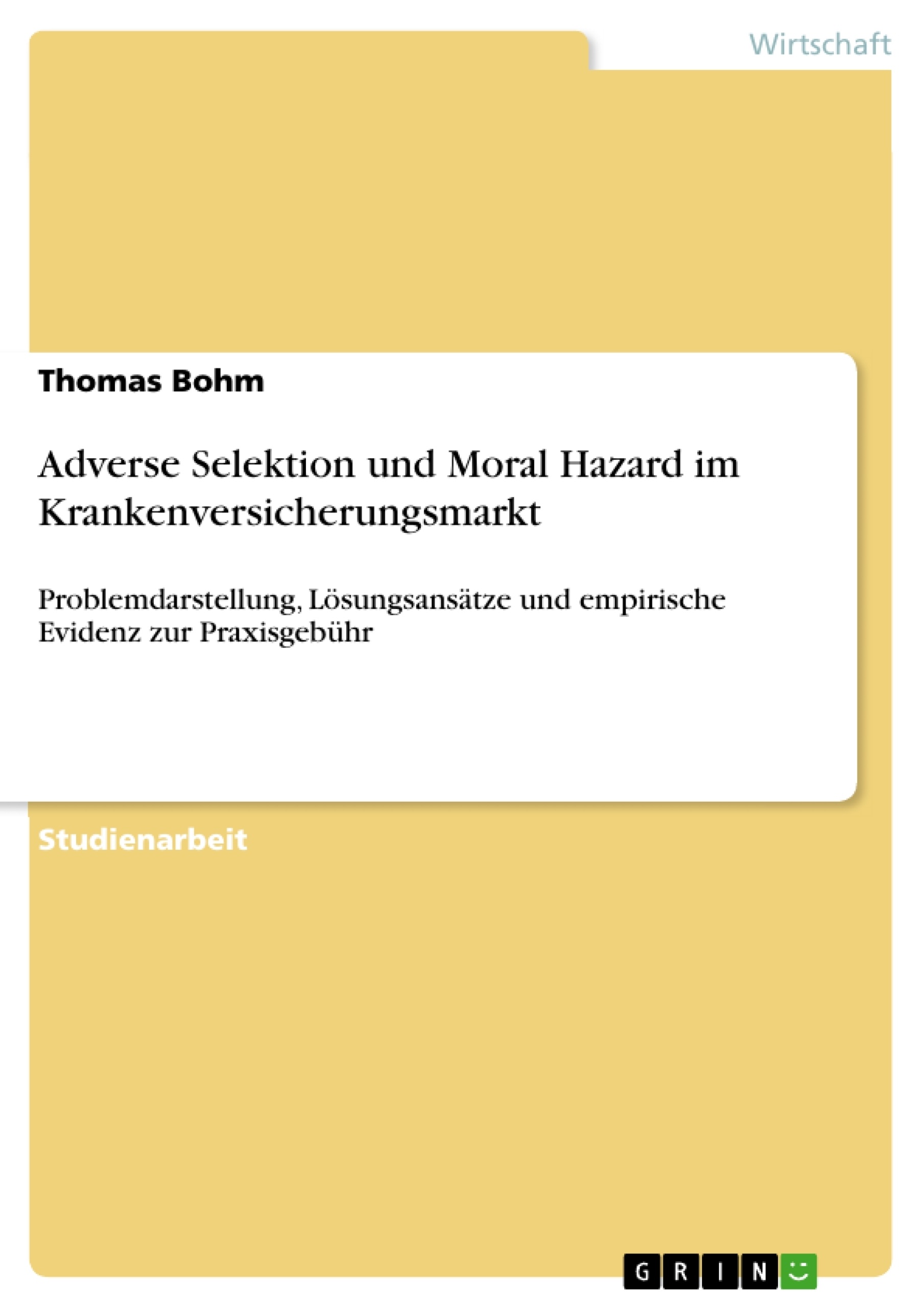Eine Krankenversicherung funktioniert dann optimal, wenn keine Informationsasymmetrien zwischen den Krankenversicherungen und den Versicherten bzw. den Individuen, die in Betracht ziehen sich zu versichern, (potentiell Versicherte) bestehen. Unter Informationsasymmetrien wird die Nichtbeobachtbarkeit von Charakteristika, Informationen, Handlungen und Intentionen einer Partei durch eine andere Partei verstanden (vgl. Amelung und Amelung (2007), S. 32). In der Realität bestehen aber Informationsasymmetrien zwischen Versicherungen einerseits und (potentiell) Versicherten andererseits. Die Beziehung zwischen diesen Parteien kann mit Hilfe der Prinzipal-Agenten-Theorie erläutert werden (vgl. Amelung und Amelung (2007), S. 33). Der Prinzipal (Versicherungen) möchte, dass der Agent (Versicherte bzw. potentiell Versicherte), der in der Regel andere Ziele als der Prinzipal verfolgt, sich im Sinne des Prinzipals verhält bzw. alle relevanten Charakteristika und Informationen preisgibt. Er kann dies aber nicht beobachten bzw. validieren (vgl. Amelung und Amelung (2007), S. 30f.). Der Krankenversicherung ist es nicht oder nicht vollständig möglich zu erkennen, welches Erkrankungsrisiko der potentiell Versicherte in sich birgt. Beispielsweise gibt das Individuum an, Nichtraucher zu sein, obwohl dem nicht so ist. Dieses Problem kann zu Adverser Selektion führen. Der Begriff „Adverse Selektion“ entstammt der Versicherungstheorie und bedeutet „negative Auslese“ (Alparslan (2006), S. 26). Ebenso kann eine Versicherung in der Regel das Verhalten des Versicherten nicht beobachten. Beispielsweise geht der Versicherte schon wegen eines kleinen Schnupfens zum Arzt, obwohl er dies ohne Kostenübernahme durch die Versicherung nicht getan, sondern sich selbst behandelt hätte. Dieses Problem wird als Moral Hazard bezeichnet. Der Begriff „Moral Hazard“ entstammt ebenfalls der Versicherungstheorie und bedeutet „moralisches Risiko“ (Alparslan (2006), S. 27). Sowohl Adverse Selektion als auch Moral Hazard können zu Marktversagen führen, weshalb deren Vermeidung bzw. Eindämmung von höchster Relevanz ist.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Problematik der Adversen Selektion und des Moral Hazard grundlegend vorzustellen, eine Auswahl von Lösungsansätzen darzulegen und die Auswirkungen der Praxisgebühr als ein Beispiel aktueller Anstrengungen der Politik zur Eindämmung von Moral Hazard bei den gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Darstellung von Adverser Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt
- 2.1 Adverse Selektion im Krankenversicherungsmarkt
- 2.2 Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt
- 3. Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt
- 3.1 Lösungsansätze für Adverse Selektion
- 3.1.1 Versicherungsverträge mit festen Preis-Mengen-Kombinationen
- 3.1.2 Staatliche Zwangsversicherung mit freiwilliger Ergänzungsversicherung
- 3.2 Lösungsansätze für Moral Hazard
- 3.2.1 Konzepte zur Kostenbeteiligung
- 3.2.2 Limitierung des Leistungskatalogs und des Anbieterkreises
- 4. Auswirkungen der Praxisgebühr auf die Problematik des Moral Hazard im deutschen Krankenversicherungmarkt
- 4.1 Notwendigkeit der Eindämmung von Moral Hazard
- 4.2 Empirische Befunde zur Auswirkung der Praxisgebühr auf Moral Hazard
- 4.2.1 Daten und Methoden von Schreyögg und Grabka
- 4.2.2 Ergebnisse von Schreyögg und Grabka
- 4.3 Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen der Praxisgebühr
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Probleme der adversen Selektion und des Moral Hazard im Kontext des deutschen Krankenversicherungsmarktes. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen dieser Phänomene, präsentiert verschiedene Lösungsansätze und analysiert die Auswirkungen der Praxisgebühr auf die Eindämmung des Moral Hazard. Der Fokus liegt auf der empirischen Evidenz und deren Interpretation.
- Adverse Selektion im Krankenversicherungsmarkt
- Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt
- Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard
- Auswirkungen der Praxisgebühr auf Moral Hazard
- Empirische Evidenz zur Praxisgebühr
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der adversen Selektion und des Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt ein. Sie erläutert die grundlegenden Konzepte der Risikoaversion, Informationsasymmetrien und die Prinzipal-Agenten-Theorie im Kontext der Krankenversicherung. Die Arbeit beschreibt das Ziel, die Problematik der adversen Selektion und des Moral Hazard darzustellen, Lösungsansätze zu präsentieren und die Auswirkungen der Praxisgebühr zu diskutieren.
2. Theoretische Darstellung von Adverser Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Grundlage für das Verständnis von adversen Selektion und Moral Hazard. Es differenziert zwischen Informationsasymmetrien vor und nach Vertragsabschluss (hidden characteristics und hidden action/information) und erläutert, wie diese zu den jeweiligen Problemen führen. Es werden anhand von Beispielen die Mechanismen und Folgen dieser Informationsasymmetrien im Detail dargestellt, insbesondere im Kontext unterschiedlicher Risikogruppen im Versicherungssystem.
3. Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Lösungsansätze zur Bewältigung der Probleme von adversen Selektion und Moral Hazard. Es werden Strategien zur Gestaltung von Versicherungsverträgen, die Rolle staatlicher Interventionen (wie z.B. die Zwangsversicherung) und Instrumente zur Kostenbeteiligung und zur Limitierung des Leistungskatalogs diskutiert. Die verschiedenen Ansätze werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Effizienz und Gerechtigkeit des Systems analysiert.
4. Auswirkungen der Praxisgebühr auf die Problematik des Moral Hazard im deutschen Krankenversicherungmarkt: Dieses Kapitel fokussiert auf die Praxisgebühr als ein Instrument zur Eindämmung des Moral Hazard im deutschen Gesundheitssystem. Es wird die Notwendigkeit zur Regulierung des Moral Hazard begründet und die empirischen Befunde von Schreyögg und Grabka zu den Auswirkungen der Praxisgebühr auf das Inanspruchnahmeverhalten im Gesundheitswesen vorgestellt und analysiert. Die Diskussion der Ergebnisse bildet die Grundlage für Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit der Praxisgebühr.
Schlüsselwörter
Adverse Selektion, Moral Hazard, Krankenversicherung, Informationsasymmetrie, Praxisgebühr, Kostenbeteiligung, Marktversagen, Prinzipal-Agenten-Theorie, empirische Evidenz, Gesundheitsökonomik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Adverse Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Probleme der adversen Selektion und des Moral Hazard im deutschen Krankenversicherungsmarkt. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen dieser Phänomene, präsentiert verschiedene Lösungsansätze und analysiert die Auswirkungen der Praxisgebühr auf die Eindämmung des Moral Hazard. Der Fokus liegt auf der empirischen Evidenz und deren Interpretation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Adverse Selektion im Krankenversicherungsmarkt, Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt, Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard (inklusive Versicherungsverträge mit festen Preis-Mengen-Kombinationen und staatliche Zwangsversicherung), Auswirkungen der Praxisgebühr auf Moral Hazard (inkl. empirischer Befunde von Schreyögg und Grabka), und die Prinzipal-Agenten-Theorie im Kontext der Krankenversicherung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den theoretischen Grundlagen der Risikoaversion, Informationsasymmetrien (Hidden Characteristics und Hidden Action/Information) und der Prinzipal-Agenten-Theorie. Diese werden im Detail erläutert und auf den Kontext des Krankenversicherungsmarktes angewendet.
Welche Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Lösungsansätze, darunter Strategien zur Gestaltung von Versicherungsverträgen (z.B. Preis-Mengen-Kombinationen), die Rolle staatlicher Interventionen (z.B. Zwangsversicherung mit freiwilliger Ergänzungsversicherung), Instrumente zur Kostenbeteiligung und die Limitierung des Leistungskatalogs und des Anbieterkreises.
Wie werden die Auswirkungen der Praxisgebühr analysiert?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Praxisgebühr auf Moral Hazard im deutschen Gesundheitssystem. Sie präsentiert und interpretiert die empirischen Befunde von Schreyögg und Grabka zu den Auswirkungen der Praxisgebühr auf das Inanspruchnahmeverhalten im Gesundheitswesen.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die empirischen Daten und Methoden von Schreyögg und Grabka, um die Auswirkungen der Praxisgebühr auf das Inanspruchnahmeverhalten im Gesundheitswesen zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Studie werden detailliert dargestellt und diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit der verschiedenen Lösungsansätze für Adverse Selektion und Moral Hazard und insbesondere zur Wirksamkeit der Praxisgebühr bei der Eindämmung des Moral Hazard. Die Interpretation der empirischen Befunde bildet die Grundlage für diese Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adverse Selektion, Moral Hazard, Krankenversicherung, Informationsasymmetrie, Praxisgebühr, Kostenbeteiligung, Marktversagen, Prinzipal-Agenten-Theorie, empirische Evidenz, Gesundheitsökonomik.
- Citation du texte
- Thomas Bohm (Auteur), 2009, Adverse Selektion und Moral Hazard im Krankenversicherungsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145134