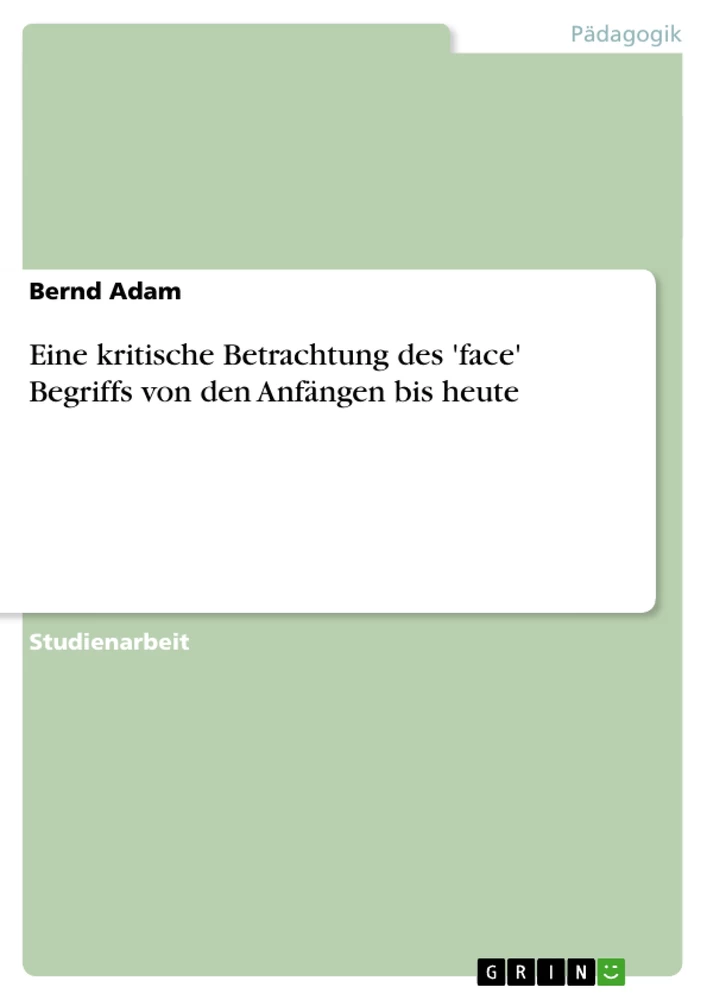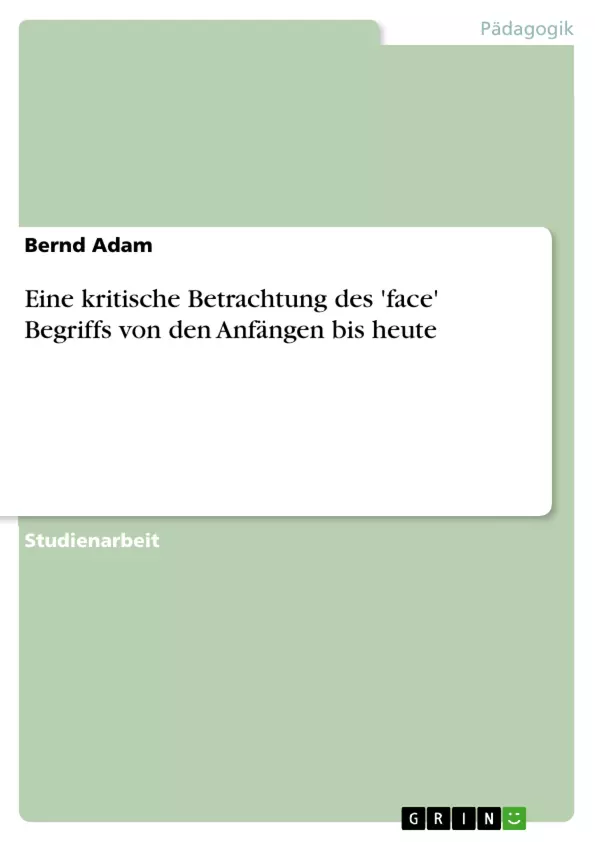Die Komplexität der Frage, was face genau bedeutet, wird einem spätestens dann klar, wenn man versucht den Begriff in ein paar einfachen Sätzen zu erklären. Das Problem des Begriffs an sich ist, dass er sich auf die Grundlagen der Gesellschaft an sich bezieht und dadurch sehr kompliziert wird. Allein die Zeitspanne von fast 100 Jahren, in der sich Menschen mit dieser Thematik beschäftig haben, zeigt, dass die Frage nach dem face und seiner Funktion nicht einfach zu beantworten ist. In Anlehnung an den französischen Soziologen Émile Durkheim untersuchte Erving Goffman 1967 in seinem Werk Interaction Ritual die Interaktionsebene zwischen Individuen genauer. Dabei entstanden die ersten Definitionen von face und face-work. Da dieser Ansatz bis heute Einfluss auf die face-Forschung hat, wird er auch Teil meiner Arbeit sein, in der ich mich anhand einiger ausgewählter Ansätze näher mit der komplexen Thematik des face befassen möchte. Dabei sollen die Probleme deutlich werden, die unter anderem durch verschiedene Kulturkreise und deren Auffassung von face entstehen. Neben Goffmans Arbeit werde ich dazu den modernen Ansatz von Brown / Levinson (1987) als Grundlage heranziehen und diesen beiden zwei postmoderne Ansätze gegenüberstellen, um die Kritikpunkte herauszuarbeiten, die die postmoderne gegenüber der modernen und traditionellen Forschung erhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der face Begriff nach Goffman
- Was ist face?
- Face-work
- Politeness Theory nach Brown / Levinson
- Gemeinsamkeiten mit Goffman
- Face als wants
- Postmoderne Ansätze
- Relational work nach Locher / Watts
- Relational work: Eine Kritik an Brown / Levinson
- Face im Zusammenhang mit relational work
- Rapport Management nach Spencer-Oatey
- Rapport Management
- Respectability face und identity face
- face und values
- Relational work nach Locher / Watts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem komplexen und vielschichtigen Begriff des face, der in der Soziologie seit über 100 Jahren diskutiert wird. Ziel ist es, die Entwicklung des face-Konzepts von seinen Anfängen bei Goffman bis zu postmodernen Ansätzen nachzuzeichnen und dabei die verschiedenen Perspektiven auf die Bedeutung von face in der sozialen Interaktion zu beleuchten.
- Die Entwicklung des face-Begriffs von Goffman bis zu postmodernen Ansätzen
- Die Bedeutung von face für die soziale Interaktion und das Selbstbild
- Die kulturellen Unterschiede in der Wahrnehmung von face
- Kritik an den traditionellen Theorien von face
- Moderne Ansätze zur Analyse von face-Arbeit in verschiedenen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema face und die Bedeutung seiner Erforschung vor. Sie beleuchtet die Komplexität des Begriffs und verweist auf die lange Tradition seiner Analyse. Kapitel 2 analysiert Goffmans Definition von face und erläutert die Rolle von face-work in der sozialen Interaktion. Kapitel 3 setzt sich mit der Politeness Theory von Brown / Levinson auseinander und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Goffmans Ansatz. Kapitel 4 präsentiert zwei postmoderne Ansätze, die Kritik an traditionellen face-Theorien üben und neue Perspektiven auf den Begriff eröffnen.
Schlüsselwörter
Face, Face-work, soziale Interaktion, Goffman, Politeness Theory, Brown / Levinson, postmoderne Ansätze, relational work, Rapport Management, kulturelle Unterschiede, Selbstbild, Identität.
- Quote paper
- Bernd Adam (Author), 2009, Eine kritische Betrachtung des 'face' Begriffs von den Anfängen bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145157