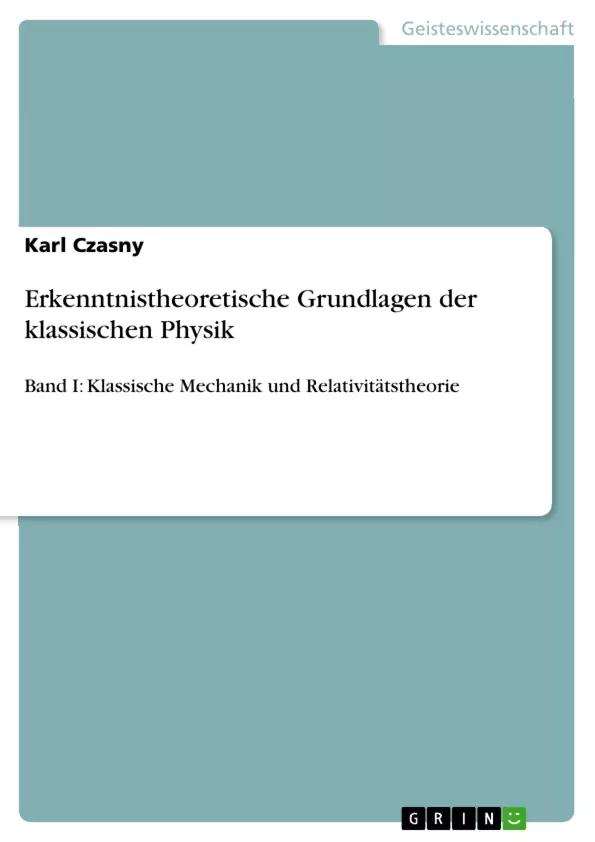Das tradierte Realitätsverständnis der Naturwissenschaften setzt beobachtungsunabhängig vorhandene Eigenschaften der Gegenstände voraus und ist somit nicht vereinbar mit den Hypothesen der Quantenmechanik, welche die Annahme einer wesentlich engeren Verzahnung von Subjekt und Objekt im Erfahrungsvorgang nahe legen. Es ist deshalb ein grundsätzliches Überdenken der jeder Beobachtung zugrunde liegenden Subjekt-Objekt-Relation erforderlich, zu dem der Autor mit seiner STUDIENREIHE ZU DEN ERKENNTNISTHEORETISCHEN GRUNDLAGEN DER PHYSIK beitragen will.
Diese Studienreihe nimmt zwar die großen Entdeckungen der Teilchenforscher zum Anlass für ihre Analyse der Subjekt-Objekt-Relation, setzt aber mit den Untersuchungen zunächst bei der klassischen Physik und deren formalwissenschaftlicher Basis an. Denn sie geht davon aus, dass erst eine saubere Aufarbeitung der Subjekt-Objekt-Problematik in den genannten Wissenschaftszweigen die Voraussetzung für eine Lösung der durch die Quantenmechanik aufgeworfenen erkenntnistheoretischen Fragen schafft.
Am Beginn der Studienreihe steht daher eine der klassischen Physik und ihren formalwissenschaftlichen Grundlagen gewidmete Arbeit. Sie umfasst zwei Bände: Der vorliegende, in sich abgeschlossene BAND I analysiert die erwähnte Thematik für die klassische Mechanik und die Relativitätstheorie, während der ebenfalls bei GRIN erschienene BAND II die Untersuchungen auf die Mathematik sowie die Logik ausweitet und den philosophischen Hintergrund der Reflexionen des Autors beleuchtet.
Die zuletzt fertig gestellte Publikation der Studienreihe trägt den Titel „QUANTENPHYSIK ALS HERAUSFORDERUNG DER ERKENNTNISTHEORIE“ und ist beim Verlag Karl Alber in der Reihe ‚Fermenta philosophica’ erschienen.
Die HOMEPAGE zur Studienreihe mit Leseproben aus allen drei Publikationen, Reaktionen anderer Autoren und einem Diskussionsforum findet sich unter:
http://www.erkenntnistheorie.at
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Aufbau der Studienreihe
- Ontologische und konstruktivistische Positionen
- Die Schwierigkeiten der Ontologie mit dem Subjekt
- Transzendentale Ansätze
- Die Grenzen der transzendentalen Analyse
- Raum und Zeit in der klassischen Mechanik
- Die versäumte Chance
- Welt ohne Raum und Zeit
- Komplementarität als universelles Konstitutionsprinzip
- Warum wir die Zeit vom Raum unterscheiden müssen
- Konstruktivistische Zeittheorie
- Die Zeit und der transzendentale Zirkel
- Physikalische und soziale Zeit
- Veränderung und Bewegung
- Raum und Zeit als Objekte
- Zeit als innerer Raum
- Geist und Materie
- Wie der Raum zu seinen Eigenschaften kommt
- Der Raum und das Geheimnis seiner Punkte
- Unendlichkeit und Absolutheit des physikalischen Raumes
- Die mißverstandene Dimensionalität
- Drei Standardrichtungen
- Die Dimension als Grenze des Raumes
- Symmetrie
- Die Raum-Zeit der speziellen Relativitätstheorie
- Verlaufsgeschwindigkeit von erlebter Zeit
- Erlebte und gemessene Zeit
- Verlaufsgeschwindigkeit von gemessener Zeit
- Die transzendentale Basis des Äthermodells
- Die Konstitution des synchronen Zeitverlaufes
- Klassische Relativität
- Spezielle Relativität
- Die Konstitution der Gleichzeitigkeit
- Gleichzeitigkeit im klassischen und relativistischen Sinne
- Die transzendentale Basis des Raum-Zeit-Kontinuums
- Kraft und Materie
- Warum wir Kraft von Materie unterscheiden müssen
- Die Konstitution der Objektsphäre
- Wechselwirkung als Kommunikationsbeziehung
- Die Gesetzmäßigkeit des Objektverhaltens
- Naturvorgang und zielorientiertes Handeln
- Die Erscheinung von Körpern
- Träge und schwere Masse
- Kraftwirkungen des Subjekts
- Kraftwirkungen der Körper
- Die Entwicklung des Kraft-Materie-Paradigmas
- Zur Urgeschichte der Physik
- Die Überwindung der Magie
- Der Übergang zur modernen Wissenschaft
- Kausalität und kapitalistische Warenproduktion
- Der pragmatistische Rahmen der Kausalität
- Das Leib-Seele-Problem in der Physik
- Die mißverstandene Kraft
- Die numerische Identität von schwerer und träger Masse
- Machsches Prinzip und kosmische Faulheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienreihe zielt darauf ab, die Subjekt-Objekt-Relation in der klassischen Physik zu untersuchen, um den Erkenntnistheoretischen Herausforderungen der modernen Physik zu begegnen. Der Autor argumentiert, dass eine saubere Aufarbeitung der Subjekt-Objekt-Problematik in den Wissenschaftszweigen wie klassischer Mechanik, Mathematik und Logik die Grundlage für eine Lösung der durch die moderne Physik aufgeworfenen Fragen schafft.
- Die Subjekt-Objekt-Relation in der klassischen Physik
- Die Konstitution von Raum und Zeit
- Die Rolle der Kraft und Materie in der Erfahrung
- Die Entwicklung des Kraft-Materie-Paradigmas
- Die transzendentale Basis der physikalischen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt die Fragestellung der Studienreihe ein, beleuchtet die Grenzen der traditionellen Realitätsauffassung in der Naturwissenschaft und erläutert die Notwendigkeit, die Subjekt-Objekt-Relation neu zu betrachten. Sie stellt den Aufbau der Studienreihe und die Rolle der klassischen Mechanik als Ausgangspunkt für die Analyse dar.
Raum und Zeit in der klassischen Mechanik
Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis von Raum und Zeit in der klassischen Mechanik und argumentiert, dass die Zeit als eine konstruierte Erfahrung verstanden werden muss. Der Autor diskutiert die Grenzen der transzendentalen Analyse und präsentiert eine konstruktivistische Sichtweise auf die Zeit und ihre Beziehung zum Raum.
Die Raum-Zeit der speziellen Relativitätstheorie
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Raum-Zeit der speziellen Relativitätstheorie und beleuchtet die transzendentale Basis des Äthermodells. Es geht auf die Konstitution des synchronen Zeitverlaufs und die Unterschiede zwischen klassischer und spezieller Relativitätstheorie ein.
Kraft und Materie
Dieses Kapitel behandelt die Beziehung zwischen Kraft und Materie. Der Autor argumentiert, dass die Kraft als eine Form der Kommunikation zwischen Subjekt und Objekt verstanden werden muss, und untersucht die Konstitution der Objektsphäre und die Gesetzmäßigkeiten des Objektverhaltens.
Die Entwicklung des Kraft-Materie-Paradigmas
Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Kraft-Materie-Paradigmas von der Urgeschichte der Physik bis zur modernen Wissenschaft. Es analysiert die Überwindung der Magie, den Übergang zur modernen Wissenschaft und die Rolle der Kausalität in der Physik.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Studienreihe sind: Subjekt-Objekt-Relation, klassische Mechanik, Relativitätstheorie, Raum und Zeit, Kraft und Materie, transzendentale Analyse, Konstruktivismus, Erkenntnis und Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem der Subjekt-Objekt-Relation in der Physik?
Die klassische Physik geht von einer beobachterunabhängigen Realität aus. Die moderne Quantenmechanik legt jedoch nahe, dass Subjekt (Beobachter) und Objekt (Gegenstand) im Erfahrungsvorgang untrennbar verzahnt sind.
Wie wird Raum und Zeit in der klassischen Mechanik verstanden?
In der klassischen Mechanik werden Raum und Zeit oft als absolute, objektive Behälter betrachtet. Der Autor schlägt hingegen eine konstruktivistische Zeittheorie vor, in der Zeit als Ergebnis menschlicher Erfahrung konstituiert wird.
Was unterscheidet die spezielle Relativitätstheorie von der klassischen Physik?
Die spezielle Relativitätstheorie zeigt, dass Gleichzeitigkeit und Zeitverlauf vom Bezugssystem des Beobachters abhängen, was die transzendentale Basis unserer Raum-Zeit-Vorstellung verändert.
Warum müssen Kraft und Materie erkenntnistheoretisch unterschieden werden?
Die Unterscheidung ist notwendig, um die Konstitution der Objektsphäre zu verstehen. Kraft kann als eine Art Kommunikationsbeziehung oder Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt interpretiert werden.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus in dieser Arbeit?
Der Konstruktivismus dient als Ansatz, um zu zeigen, dass physikalische Grundbegriffe wie Raum, Zeit und Kausalität nicht einfach „da“ sind, sondern durch die Struktur unseres Erkenntnisapparates mitgeformt werden.
- Citar trabajo
- Dr. Karl Czasny (Autor), 2010, Erkenntnistheoretische Grundlagen der klassischen Physik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145325