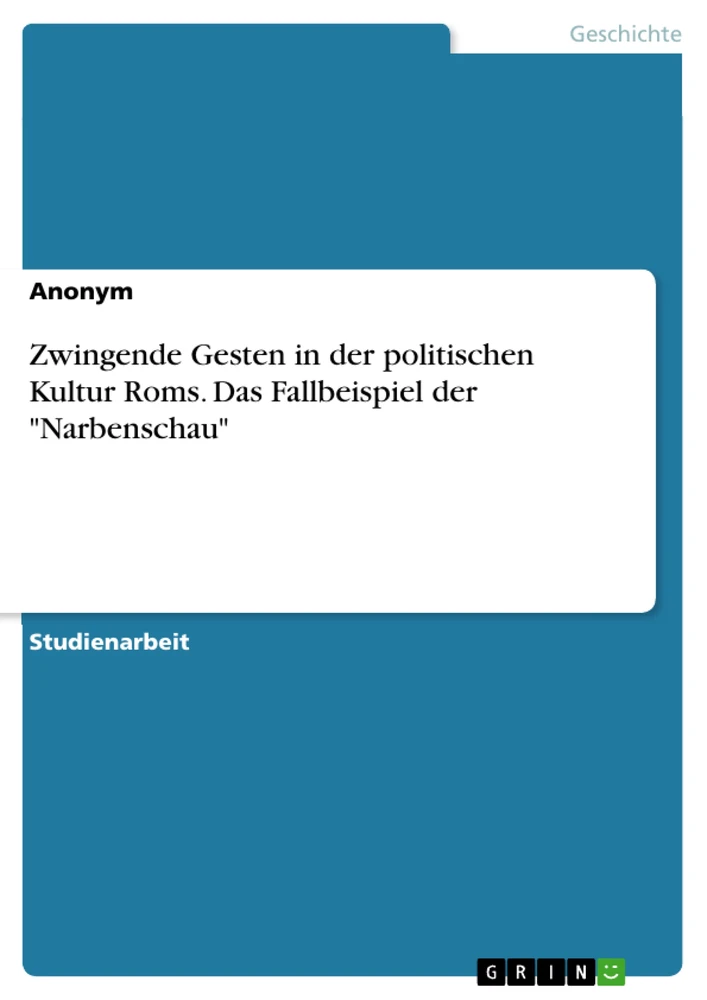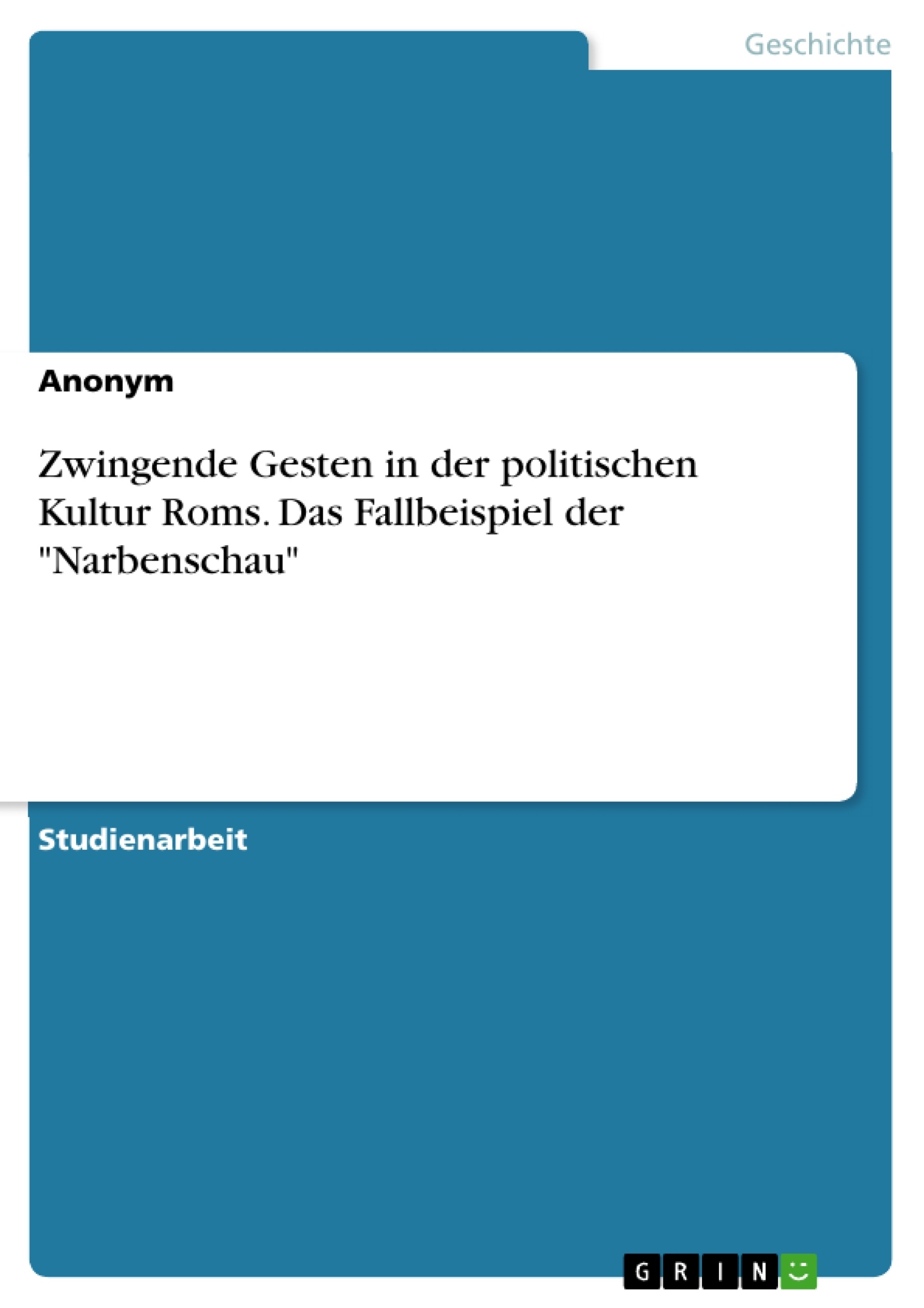Zwingende Gesten galten als fester Bestandteil der politischen Kultur Roms, deren Vielfalt anhand ihrer verschiedenen Erscheinungsformen zur Geltung kam. Dabei konnte es sich beispielsweise um Bittgesten handeln, die entweder im Rahmen von inneraristokratischen Konfliktsituationen oder vor dem versammelten Volk ausgeführt wurden. Aber auch das Weinen von Imperatoren vor meuternden Legionen gehörte in das Repertoire dieser stark symbolisch aufgeladenen und performativ vollzogenen sozialen Praktiken. Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll jedoch das Fallbeispiel der „Narbenschau“ dazu dienen, diese spezielle Form der politischen Ausdrucksweise zu ergründen und in den Kontext der politischen Kultur einzubetten. Leitend für diese Untersuchung ist dabei die Fragestellung nach dem Stellenwert und der Funktion zwingender Gesten für die politische Kultur Roms.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Betrachtung der soziokulturellen Hintergründe einer „Grammatik der römischen Politik❝
- Der Blick auf die Praxeologie – die Bedeutung sozialer Praktiken
- Habitus-Konzept, Kapitalsorten und Feldtheorie nach Pierre Bourdieu
- Der Blick auf die politische Klasse Roms...
- Der Habitus der römischen Nobilität..
- Die Ausdrucksseite der politischen Kultur Roms........
- Die Funktion und Bedeutung von zwingenden Gesten als „Disposition des Nachgebens“.
- Das Fallbeispiel der „,Narbenschau”
- Fazit........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert und die Funktion zwingender Gesten in der politischen Kultur Roms anhand des Fallbeispiels der „Narbenschau“. Sie beleuchtet die soziokulturellen Hintergründe einer „Grammatik der römischen Politik“, insbesondere die Bedeutung von sozialen Praktiken und das Habitus-Konzept, die Kapitalsorten und die Feldtheorie nach Pierre Bourdieu.
- Soziokulturelle Hintergründe der „Grammatik der römischen Politik“
- Bedeutung sozialer Praktiken und Praxeologie
- Habitus der römischen Nobilität
- Funktion und Bedeutung von zwingenden Gesten
- Das Fallbeispiel der „Narbenschau“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der zwingenden Gesten in der römischen Politik vor und erläutert die Bedeutung des Fallbeispiels der „Narbenschau“. Kapitel 2 beleuchtet die soziokulturellen Hintergründe einer „Grammatik der römischen Politik“ und beschäftigt sich mit der Praxeologie und den Lehren von Pierre Bourdieu. Kapitel 3 konzentriert sich auf die politische Klasse Roms, insbesondere den Habitus der römischen Nobilität, die Ausdrucksseite der politischen Kultur sowie die Funktion und Bedeutung von zwingenden Gesten.
Schlüsselwörter
Zwingende Gesten, politische Kultur, Rom, Praxeologie, Habitus, Kapitalsorten, Feldtheorie, soziale Praktiken, „Narbenschau“
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Zwingende Gesten in der politischen Kultur Roms. Das Fallbeispiel der "Narbenschau", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1453421