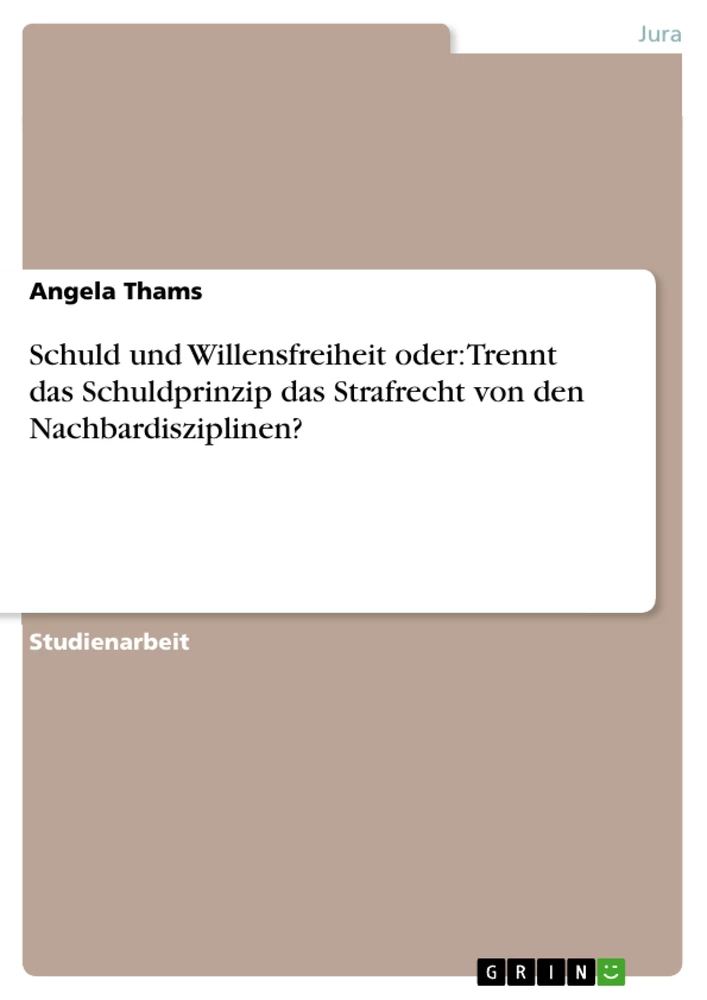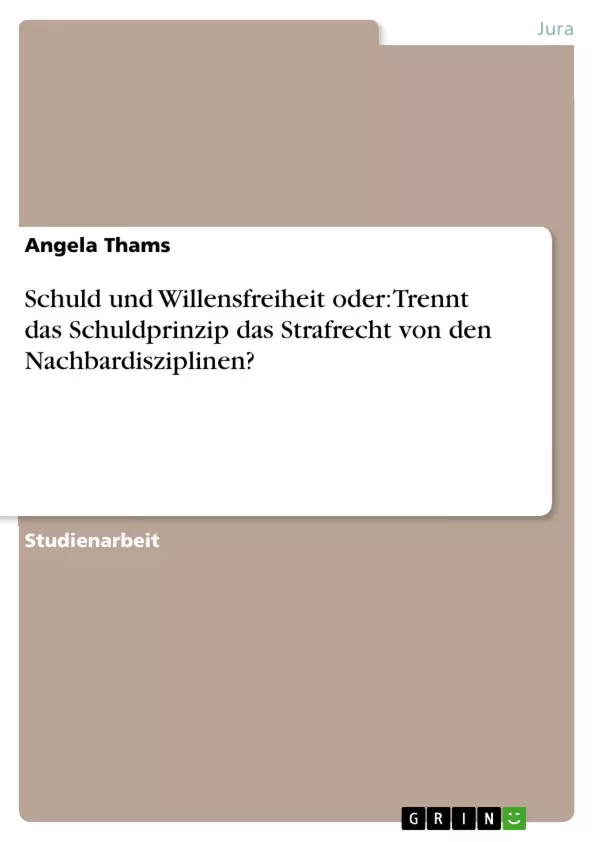Gerade als Juristin macht sich für mich das in Jahren eingeübte normative und von Dogmatik geprägte Denken bemerkbar, das es manchmal allzu beschwerlich macht, sich einer sozialwissenschaftlichen Thematik zu nähern. Die Unterschiede und die Schwierigkeiten zwischen den Disziplinen finden auch und gerade in Kommunikationsproblemen ihren Ausdruck. Wo genau liegen die Gründe für derartige Konflikte, und sind sie zu lösen? Diese Gedanken beschäftigten mich vor Beginn der Arbeit, und so ist es Ziel dieser Arbeit, das schwierige Verhältnis zwischen dem Strafrecht und den benachbarten Disziplinen (der Kriminologie und der Psychologie bzw. der Psychiatrie) näher zu beleuchten. Als Anknüpfungspunkt bot sich die Willensfreiheitsproblematik innerhalb des Schuldprinzips an, da sich an diesem Punkt die Geister scheiden und Kommunikationsprobleme sowie systematische Probleme deutlich werden.
Dabei sollen zunächst das Schuldprinzip und die Bedeutung der Willensfreiheit im Strafrecht analysiert werden, um im Anschluss die damit einhergehenden Probleme bei der Umsetzung in die Praxis, namentlich bei der Feststellung der Schuld im Strafverfahren, darzustellen. In diesem Bereich kommen die Schwierigkeiten des Strafrechts im Umgang mit Psychologie bzw. Psychiatrie zum Tragen.
Wenn im vierten Teil die Bedeutung des Schuldprinzips für die Kriminologie und ihre verschiedenen Richtungen dargestellt wird, sollen anhand der kriminologischen Hauptrichtungen, bzw. der für diese Problematik bedeutsamen Ansätze, Gründe für die geringe Verwertung kriminologischer Erkenntnisse im Strafrecht gefunden werden.
Im fünften Teil der Arbeit werden Lösungsversuche lediglich nachgezeichnet, ohne dass eine Entscheidung für einen der Wege fällt.
Schließlich bleibt alles offen und vielleicht ist gerade das der Weg, um den Dialog zwischen den Disziplinen nicht zum Stillstand zu bringen, sondern ihn weiterhin zu suchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Schuldprinzip im Strafrecht
- 2.1. Begriff der Schuldfähigkeit
- 2.1.1. §§19, 20 StGB Schuldunfähigkeit
- 2.1.2. §21 StGB verminderte Schuldfähigkeit
- 2.1.3. Rechtsfolgen
- 2.2. Schuld und Verantwortung
- 2.2.1. Der strenge Indeterminismus
- 2.2.2. Der relative Indeterminismus
- 2.2.3. Die Lehre von der Lebensführungsschuld
- 2.1. Begriff der Schuldfähigkeit
- 3. Feststellung der Schuld im Strafverfahren
- 4. Die Bedeutung des Schuldprinzips für die Kriminologie
- 4.1. Ätiologische Ansätze
- 4.1.1. Täterorientierte Ansätze
- 4.1.2. Makrosoziologische Ansätze
- 4.2. Der Labeling-Approach
- 4.1. Ätiologische Ansätze
- 5. Wege aus dem Dilemma
- 5.1. Maßnahmerecht statt Schuldstrafrecht (défense sociale)
- 5.2. Die Neue Sozialverteidigung
- 5.3. Limitierung des Schuldprinzips durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen dem Schuldprinzip im Strafrecht und den benachbarten Disziplinen Kriminologie und Psychologie/Psychiatrie. Der Fokus liegt auf der Willensfreiheitsproblematik im Kontext des Schuldprinzips und den daraus resultierenden Kommunikations- und Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Willensfreiheit im Strafrecht, die Herausforderungen bei der Feststellung der Schuld im Strafverfahren und die Relevanz des Schuldprinzips für verschiedene kriminologische Ansätze. Lösungsansätze werden aufgezeigt, ohne eine definitive Entscheidung zu treffen.
- Das Schuldprinzip im Strafrecht und die Bedeutung der Willensfreiheit
- Schwierigkeiten bei der Feststellung der Schuld im Strafverfahren und die Interaktion mit psychologischer/psychiatrischer Expertise
- Verhältnis des Schuldprinzips zu verschiedenen kriminologischen Theorien (ätiologische Ansätze, Labeling-Approach)
- Konflikte zwischen dem Schuldprinzip und kriminologischen Erkenntnissen
- Mögliche Lösungsansätze für die bestehenden Diskrepanzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Problematik des Verhältnisses zwischen Strafrecht und benachbarten Disziplinen, insbesondere die Schwierigkeiten in der Kommunikation und der Integration sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie benennt die Willensfreiheitsproblematik im Schuldprinzip als zentralen Fokus der Arbeit und umreißt den Aufbau der Argumentation, der die Analyse des Schuldprinzips, die Schwierigkeiten der Schuldfeststellung im Strafverfahren, die Bedeutung des Schuldprinzips für die Kriminologie und schließlich mögliche Lösungsansätze umfasst.
2. Das Schuldprinzip im Strafrecht: Dieses Kapitel beschreibt das Schuldprinzip und die Bedeutung der Willensfreiheit im Strafrecht. Es definiert Schuldfähigkeit und Schuldunfähigkeit gemäß §§ 19 und 20 StGB, sowie die verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 StGB. Es diskutiert verschiedene Auffassungen zur Willensfreiheit (strenger und relativer Indeterminismus) und die Lehre von der Lebensführungsschuld, um die zentrale Bedeutung der Willensfreiheit für das Schuldprinzip zu unterstreichen. Der Abschnitt verdeutlicht, dass trotz unterschiedlicher Interpretationen die Willensfreiheit als Grundprinzip des Strafrechts gilt.
3. Feststellung der Schuld im Strafverfahren: Dieses Kapitel analysiert die praktischen Herausforderungen der Schuldfeststellung im Strafverfahren. Es thematisiert die Spannung zwischen dem metaphysisch verankerten Schuldstrafrecht und der Notwendigkeit wissenschaftlich begründeter Gutachten. Es beleuchtet die Schwierigkeiten, den Freiheitsgrad eines Individuums in einer konkreten Situation zu bestimmen und die daraus resultierende Problematik der Zusammenarbeit zwischen Juristen und psychiatrischen Sachverständigen. Die unterschiedlichen Perspektiven und wissenschaftstheoretischen Ansätze des Rechts und der Sozialwissenschaften werden als zentrale Quelle der Konflikte identifiziert.
4. Die Bedeutung des Schuldprinzips für die Kriminologie: Dieses Kapitel beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen dem Schuldprinzip im Strafrecht und den Erkenntnissen der Kriminologie. Es analysiert, wie verschiedene kriminologische Ansätze (insbesondere ätiologische Ansätze und der Labeling-Approach) dem Indeterminismus-Postulat des Strafrechts entgegenstehen. Das Kapitel argumentiert, dass die Fokussierung auf individuelle Schuld im Strafrecht die Berücksichtigung sozialer und gesellschaftlicher Ursachen von Kriminalität behindert und die Verwertung kriminologischer Erkenntnisse erschwert.
5. Wege aus dem Dilemma: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Lösungsansätze, um den Konflikt zwischen dem Schuldprinzip und den Erkenntnissen aus den Sozialwissenschaften zu lösen. Es beschreibt das Konzept der „défense sociale“, die „neue Sozialverteidigung“ und den Versuch, das Schuldprinzip durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu begrenzen. Für jeden Ansatz werden die Stärken und Schwächen sowie die damit verbundenen Kritikpunkte diskutiert.
Schlüsselwörter
Schuldprinzip, Willensfreiheit, Strafrecht, Kriminologie, Psychologie, Psychiatrie, Schuldfähigkeit, Indeterminismus, Determinismus, Ätiologie, Labeling-Approach, défense sociale, Verhältnismäßigkeit, Rechtsfolgen, Gutachten, Interdisziplinarität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schuldprinzip im Strafrecht
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen dem Schuldprinzip im Strafrecht und den benachbarten Disziplinen Kriminologie und Psychologie/Psychiatrie. Der Fokus liegt auf der Willensfreiheitsproblematik im Kontext des Schuldprinzips und den daraus resultierenden Kommunikations- und Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Willensfreiheit im Strafrecht, die Herausforderungen bei der Feststellung der Schuld im Strafverfahren und die Relevanz des Schuldprinzips für verschiedene kriminologische Ansätze. Es werden verschiedene Auffassungen zur Willensfreiheit (strenger und relativer Indeterminismus) und die Lehre von der Lebensführungsschuld diskutiert. Die praktischen Herausforderungen der Schuldfeststellung im Strafverfahren, die Spannung zwischen dem metaphysisch verankerten Schuldstrafrecht und der Notwendigkeit wissenschaftlich begründeter Gutachten sowie die unterschiedlichen Perspektiven und wissenschaftstheoretischen Ansätze des Rechts und der Sozialwissenschaften werden beleuchtet. Schließlich werden verschiedene Lösungsansätze für den Konflikt zwischen dem Schuldprinzip und den Erkenntnissen aus den Sozialwissenschaften präsentiert (z.B. „défense sociale“, „neue Sozialverteidigung“, Verhältnismäßigkeit).
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das Schuldprinzip im Strafrecht (inkl. Schuldfähigkeit, §§19, 20 StGB, verminderte Schuldfähigkeit §21 StGB), 3. Feststellung der Schuld im Strafverfahren, 4. Die Bedeutung des Schuldprinzips für die Kriminologie (inkl. ätiologischer Ansätze und Labeling-Approach), 5. Wege aus dem Dilemma (inkl. „défense sociale“, „neue Sozialverteidigung“, Limitierung durch Verhältnismäßigkeit) und 6. Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Schuldprinzip, Willensfreiheit, Strafrecht, Kriminologie, Psychologie, Psychiatrie, Schuldfähigkeit, Indeterminismus, Determinismus, Ätiologie, Labeling-Approach, défense sociale, Verhältnismäßigkeit, Rechtsfolgen, Gutachten, Interdisziplinarität.
Welche Lösungsansätze werden in der Seminararbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Lösungsansätze für den Konflikt zwischen dem Schuldprinzip und kriminologischen Erkenntnissen, darunter Maßnahmerecht statt Schuldstrafrecht („défense sociale“), die Neue Sozialverteidigung und die Limitierung des Schuldprinzips durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Für jeden Ansatz werden Stärken und Schwächen sowie Kritikpunkte diskutiert.
Welche Bedeutung hat die Willensfreiheit in der Seminararbeit?
Die Willensfreiheitsproblematik steht im Zentrum der Arbeit. Sie wird im Kontext des Schuldprinzips analysiert, wobei verschiedene Auffassungen zur Willensfreiheit (strenger und relativer Indeterminismus) und deren Auswirkungen auf die Strafrechtspraxis beleuchtet werden.
Wie wird das Verhältnis zwischen Strafrecht und Kriminologie dargestellt?
Die Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen dem Schuldprinzip im Strafrecht und den Erkenntnissen der Kriminologie. Es wird gezeigt, wie verschiedene kriminologische Ansätze (insbesondere ätiologische Ansätze und der Labeling-Approach) dem Indeterminismus-Postulat des Strafrechts entgegenstehen und wie die Fokussierung auf individuelle Schuld im Strafrecht die Berücksichtigung sozialer und gesellschaftlicher Ursachen von Kriminalität behindert.
Welche Rolle spielen Gutachten in der Seminararbeit?
Die Arbeit thematisiert die Notwendigkeit wissenschaftlich begründeter Gutachten im Strafverfahren und die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Juristen und psychiatrischen Sachverständigen aufgrund unterschiedlicher Perspektiven und wissenschaftstheoretischer Ansätze.
- Quote paper
- Angela Thams (Author), 2000, Schuld und Willensfreiheit oder: Trennt das Schuldprinzip das Strafrecht von den Nachbardisziplinen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145536