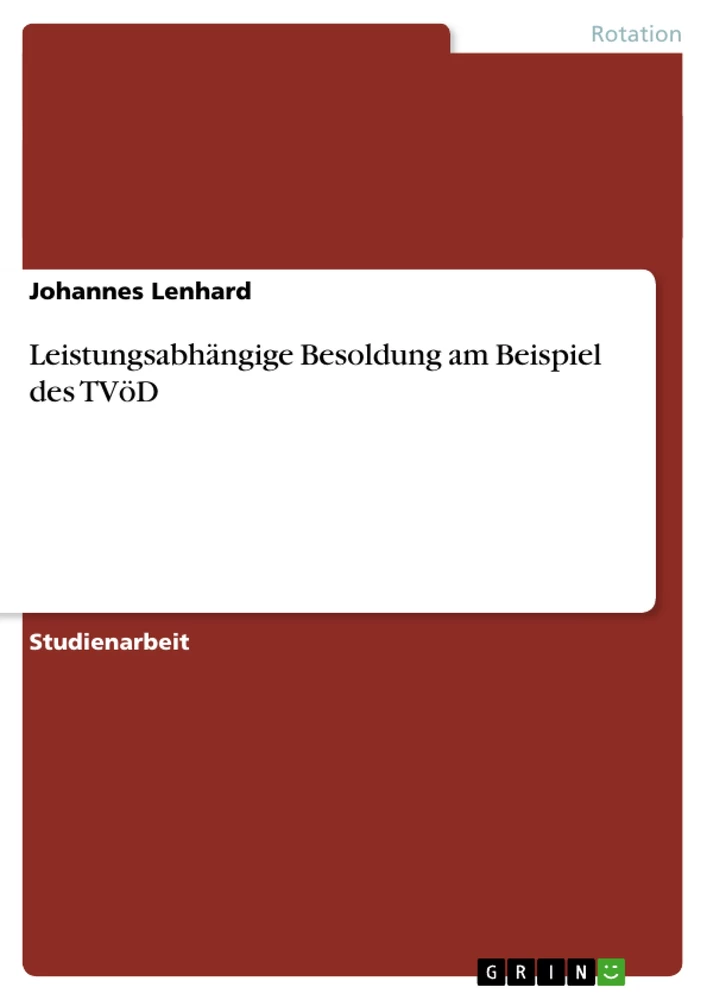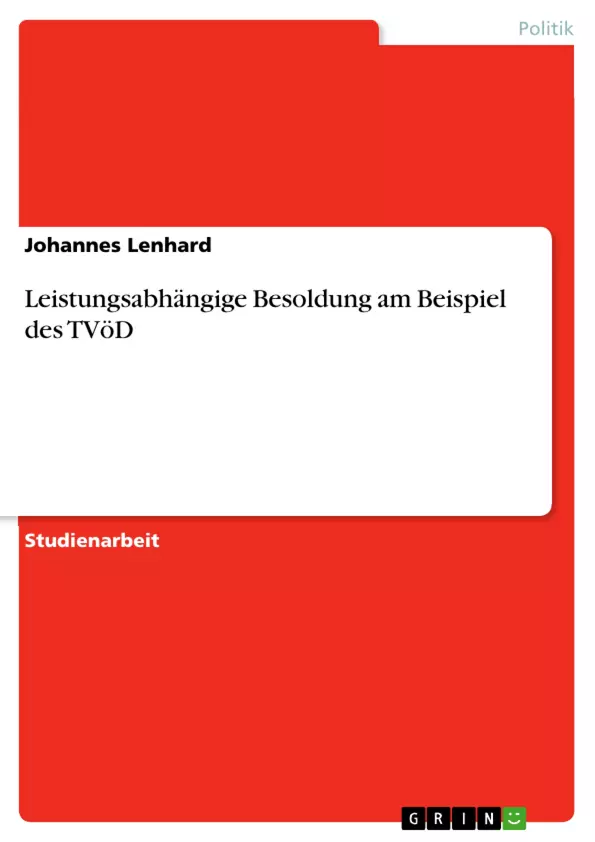„Die Rechts- und Organisationsformen, mit denen Nationen, Länder und Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen, unterliegen, wie die Gesellschaft auch, einem ständigen Wandel. […] Stillstand wäre Rückschritt. […] Aktuell ist die Managerialisierung Ökonomisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland in vollem Gange“ (Niederelz, 2007, S. 276)
Dieses Zitat beschreibt die gegenwärtige Situation sehr genau. Globalisierung, Terrorismus und Themen innerhalb der Gesellschaft, wie Familie und das soziale System üben einen ungeheuren Druck auf die Verwaltung aus, der vor allem einen Kostendruck darstellt.
Kosten müssen vermieden und Effektivität gesteigert werden. Das Instrument der leistungsbezogenen Entgelte stellt ein Mittel dar um dieser Tendenz entgegenzukommen.
Der Einsatz dieses „Allheilmittels“ muss jedoch gründlich vorbereitet werden um ihn zu einem erfolgreichen zu machen. Wie Befragungen zeigen, wird es in Zukunft zu einer verstärkten Nutzung des Instruments des §18 kommen, und das auf allen Ebenen der Verwaltung. Ob diese Nutzung jedoch positiv ist, hängt davon ab, wie viele Mittel man bereit ist im Vorfeld in die Verwaltung zu investieren, die sie später um ein Vielfaches wieder einsparen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Ökonomisierung im öffentlichen Dienst: Vom BAT zum TVöD
- 2. Die Leistungsabhängige Vergütung im TVöD
- 2.1 Begriffbestimmungen
- 2.1.1 Vergütung
- 2.1.2 Leistungslohn
- 2.2 Theoretische Grundlagen
- 2.2.1 Motivationstheoretische Ansätze
- 2.2.2 Principal-Agent-Theorem
- 2.3 Sinn und Nutzen der Einführung eines leistungsbezogenen Entlohnungssystems
- 2.4 Instrumente im TVöD
- 2.4.1 Geltungsbereich
- 2.4.2 Leistungstopf
- 2.4.3 Die tariflichen Formen des Leistungsentgelts
- 2.4.3.1 Leistungsprämie
- 2.4.3.2 Leistungszulage
- 2.4.3.3 Erfolgsprämie
- 2.5 Leistungsbemessung
- 3. Empirische Umsetzung
- 4. Kritik
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Einführung leistungsabhängiger Besoldung im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und analysiert deren Auswirkungen. Sie beleuchtet den Wandel vom traditionellen Besoldungssystem (BAT) zum leistungsorientierten TVöD im Kontext der Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes.
- Die Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes und der Übergang vom BAT zum TVöD.
- Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen leistungsabhängiger Vergütung.
- Instrumente und Mechanismen der leistungsbezogenen Entlohnung im TVöD.
- Motivationstheoretische Aspekte und deren Relevanz für die Leistungsabhängigkeit.
- Kritische Auseinandersetzung mit der empirischen Umsetzung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Ökonomisierung im öffentlichen Dienst: Vom BAT zum TVöD: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel im öffentlichen Dienst hin zu einem ökonomischeren Modell, beeinflusst vom New Public Management. Es vergleicht das traditionelle, leistungsunabhängige Besoldungssystem (BAT) mit dem neuen TVöD, der 2005 in Kraft trat. Der BAT, in Kraft seit 1961, basierte auf Dienstalter, Familienstand etc. und war unabhängig von der individuellen Leistung. Der TVöD hingegen versucht, internationale Reformbestrebungen aufzugreifen und die Beschäftigungsverhältnisse an die Zeitumstände anzupassen. Dieser Übergang stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel in der Verwaltung dar und ist der Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung leistungsabhängiger Vergütung.
2. Die Leistungsabhängige Vergütung im TVöD: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Konzept der leistungsabhängigen Vergütung im TVöD. Es beginnt mit einer Klärung der Begriffe „Vergütung“ und „Leistungslohn“, die im Kontext des §611 Abs. 1 BGB erläutert werden. Der Unterschied zwischen Leistungslohn und leistungsbezogenem Entgelt wird herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Höhe der Vergütung an die Arbeitsleistung gekoppelt wird und welche methodischen Ansätze der Leistungsbemessung existieren. Das Kapitel untersucht auch motivationstheoretische Ansätze, um den Zusammenhang zwischen Entlohnung und Motivation zu beleuchten und die Wirkung des leistungsabhängigen Entgelts zu analysieren. Die OECD-Studie von 1997 wird hier als relevantes Beispiel angeführt.
Schlüsselwörter
Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes, New Public Management, BAT, TVöD, leistungsabhängige Vergütung, Leistungslohn, Motivationstheorien, Personalmanagement, Entlohnungssysteme, Tarifvertrag.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Leistungsabhängige Vergütung im öffentlichen Dienst (TVöD)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Einführung leistungsabhängiger Besoldung im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und analysiert deren Auswirkungen. Sie beleuchtet den Wandel vom traditionellen Besoldungssystem (BAT) zum leistungsorientierten TVöD im Kontext der Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes und den Übergang vom BAT zum TVöD, Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen leistungsabhängiger Vergütung, Instrumente und Mechanismen der leistungsbezogenen Entlohnung im TVöD, motivationstheoretische Aspekte und deren Relevanz für die Leistungsabhängigkeit sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der empirischen Umsetzung.
Was ist der Unterschied zwischen BAT und TVöD?
Der BAT (Bundesangestelltentarif), in Kraft seit 1961, basierte auf Dienstalter, Familienstand etc. und war unabhängig von der individuellen Leistung. Der TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst), der 2005 in Kraft trat, versucht hingegen, internationale Reformbestrebungen aufzugreifen und die Beschäftigungsverhältnisse an die Zeitumstände anzupassen. Der Übergang stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel in der Verwaltung dar.
Welche Konzepte der leistungsabhängigen Vergütung werden erläutert?
Die Hausarbeit klärt die Begriffe „Vergütung“ und „Leistungslohn“ im Kontext des §611 Abs. 1 BGB. Der Unterschied zwischen Leistungslohn und leistungsbezogenem Entgelt wird herausgestellt. Es werden methodische Ansätze der Leistungsbemessung untersucht und motivationstheoretische Ansätze zur Beleuchtung des Zusammenhangs zwischen Entlohnung und Motivation analysiert.
Welche Instrumente der leistungsbezogenen Entlohnung im TVöD werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Instrumente im TVöD, darunter den Geltungsbereich, den Leistungstopf und die tariflichen Formen des Leistungsentgelts (Leistungsprämie, Leistungszulage, Erfolgsprämie).
Welche Motivationstheorien werden betrachtet?
Die Hausarbeit beleuchtet motivationstheoretische Ansätze (genauer benannt wird das Principal-Agent-Theorem und weitere Ansätze unter 2.2.1) um den Zusammenhang zwischen Entlohnung und Motivation zu beleuchten und die Wirkung des leistungsabhängigen Entgelts zu analysieren. Die OECD-Studie von 1997 wird als relevantes Beispiel angeführt.
Wie wird die Leistungsbemessung im TVöD behandelt?
Die Hausarbeit widmet sich der Frage, wie die Höhe der Vergütung an die Arbeitsleistung gekoppelt wird und welche methodischen Ansätze der Leistungsbemessung existieren (Kapitel 2.5).
Welche Kritikpunkte werden an der leistungsabhängigen Vergütung im TVöD geübt?
Die Hausarbeit enthält ein eigenes Kapitel (Kapitel 4) zur Kritik an der leistungsabhängigen Vergütung im TVöD (der genaue Inhalt ist aus der Zusammenfassung nicht ersichtlich).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Ökonomisierung des öffentlichen Dienstes, New Public Management, BAT, TVöD, leistungsabhängige Vergütung, Leistungslohn, Motivationstheorien, Personalmanagement, Entlohnungssysteme, Tarifvertrag.
- Quote paper
- Johannes Lenhard (Author), 2008, Leistungsabhängige Besoldung am Beispiel des TVöD , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145707