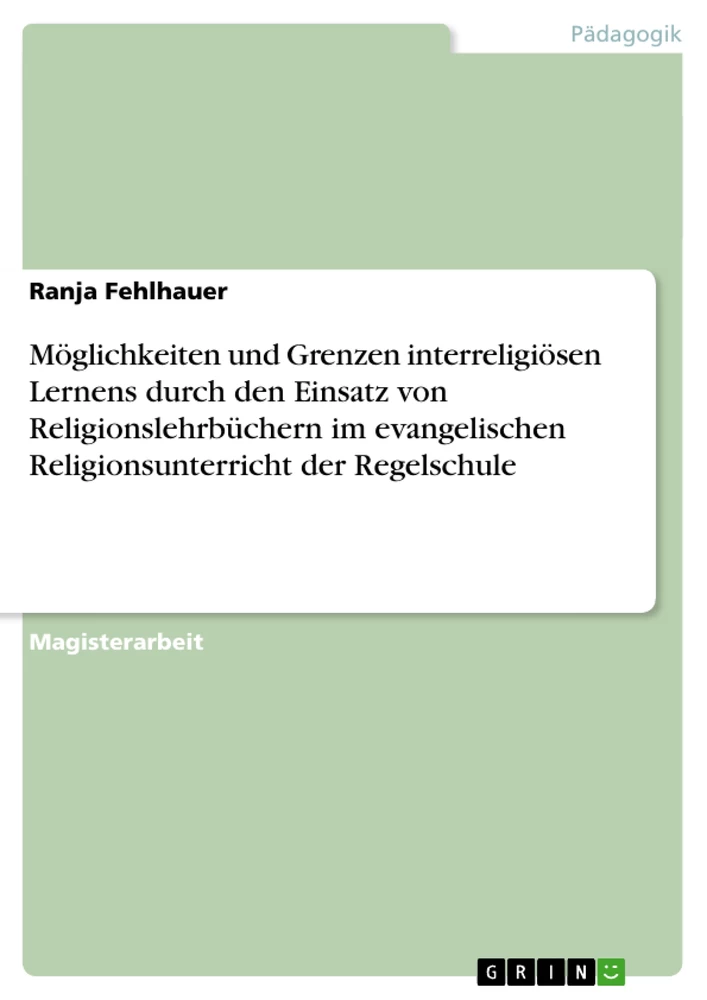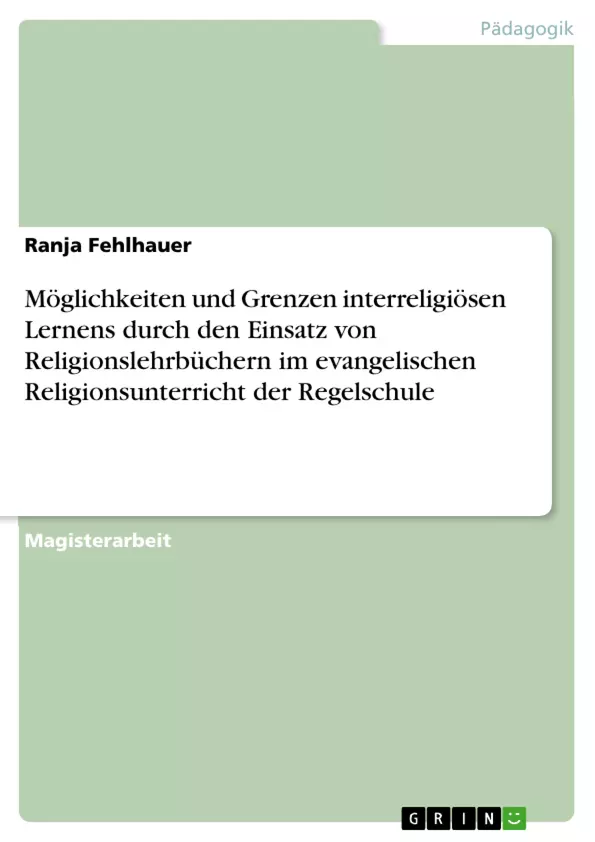Im Rahmen erster eigener Unterrichtsversuche im Fach Evangelische Religionslehre,
die in einer 5. bis 7. Klasse einer Erfurter Regelschule zum Thema Islam absolviert
wurden, stellte ich mit Erstaunen fest, dass in den relativ alten Lehrbüchern, die in der
Schule zur Verfügung standen, der Islam kaum thematisiert wird. Deshalb konnte ich
bei der Gestaltung der Unterrichtseinheit nicht auf diese Schulbücher zurückgreifen. Die
Schülerinnen und Schüler begegneten dem Islam in meinem Unterricht daher mithilfe
von Arbeitsblättern, Videos, Bildern und Anschauungsmaterialien, wie z.B. Koran,
Gebetsteppich und Gebetskette. Anschließend stellte sich mir natürlich die Frage, ob es
Kindern und Jugendlichen generell nicht möglich ist, anderen Religionen in
Lehrbüchern zu begegnen, oder ob das nur bei den relativ alten Lehrwerken der Schule,
in der ich unterrichtete, der Fall ist. Diese Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen
interreligiösen Lernens durch den Einsatz von Religionslehrbüchern im evangelischen
Religionsunterricht der Regelschule zu ergründen, ist das Ziel der vorliegenden
Magisterarbeit.
Die für eine Religionsbuchanalyse notwendigen theoretischen Grundlagen des Begriffes
„interreligiöses Lernen“, der aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen von zentraler
Bedeutung für den evangelischen Religionsunterricht ist, sollen daher zunächst
dargelegt werden. Neben Voraussetzungen, Zielen, begrifflichen Annäherungen und
Grundfragen soll dabei auch auf interreligiöses Lernen als Prozess eingegangen werden.
Außerdem wird die Rolle der Lehrbücher in Bezug auf interreligiöses Lernen
beleuchtet.
Die sich anschließende Religionsbuchanalyse soll eine Querschnittanalyse von drei
möglichst neuen Lehrbüchern sein, um zu zeigen, dass interreligiöses Lernen mithilfe
neuerer Religionslehrbücher durchaus möglich ist. Die Analyse bezieht sich ferner nur
auf Lehrwerke unterer Klassenstufen der Regelschule, da Schülerinnen und Schüler
möglichst früh anderen Religionen begegnen sollen, was durch die Lehrpläne, an denen
sich die Autorinnen und Autoren von Schulbüchern orientieren müssen, berücksichtigt
ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Grundlagen des interreligiösen Lernens
- Voraussetzungen interreligiösen Lernens
- Ziele des interreligiösen Lernens
- Interreligiöses Lernen – begriffliche Annäherungen
- Interreligiöses Lernen als Prozess
- Die Vorgaben des Thüringer Lehrplanes
- Fachwissenschaftliche Aspekte
- Fachdidaktische Aspekte
- Gesellschaftliche Aspekte
- Grundfragen zum interreligiösen Lernen
- Lehrbücher und interreligiöses Lernen
- Praxis des interreligiösen Lernens (Lehrbuchanalyse)
- Kriterien zur Lehrbuchanalyse
- Fachwissenschaftliche Kriterien
- Fachdidaktische Kriterien
- Gesellschaftliche Kriterien
- Ausgewählte Lehrbücher und deren „interreligiöser\" Befund
- ,,Kursbuch Religion elementar“
- Fachwissenschaftliche Aspekte
- Fachdidaktische Aspekte
- Gesellschaftliche Aspekte
- ,,Religion entdecken – verstehen - gestalten“
- Fachwissenschaftliche Aspekte
- Fachdidaktische Aspekte
- Gesellschaftliche Aspekte
- ,,RELI+wir❝
- Fachwissenschaftliche Aspekte
- Fachdidaktische Aspekte
- Gesellschaftliche Aspekte
- Ausgewählte Lehrbücher und deren „interreligiöse\" Analyse
- Möglichkeiten des interreligiösen Lernens mithilfe von Lehrbüchern
- Grenzen des interreligiösen Lernens mithilfe von Lehrbüchern
- Konsequenzen für die Gestaltung des evangelischen Religionsunterrichtes
- Die Bedeutung des interreligiösen Lernens im Kontext der kulturellen Vielfalt in Deutschland
- Die Rolle von Religionslehrbüchern bei der Förderung des interreligiösen Lernens
- Die Analyse von Lehrbüchern auf ihre „interreligiöse“ Ausrichtung
- Die Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Lernens durch den Einsatz von Religionslehrbüchern
- Konsequenzen für die Gestaltung des evangelischen Religionsunterrichtes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Lernens im evangelischen Religionsunterricht der Regelschule anhand des Einsatzes von Religionslehrbüchern. Die Arbeit untersucht, wie der Islam in Lehrbüchern behandelt wird und ob er Kindern und Jugendlichen im Unterricht einen Zugang zu anderen Religionen ermöglicht. Die Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des interreligiösen Lernens, den Voraussetzungen und Zielen, begrifflichen Annäherungen und Grundfragen. Sie analysiert drei neuere Lehrbücher auf ihren „interreligiösen“ Gehalt und untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Lernens, die sich durch den Einsatz dieser Lehrbücher ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Ausgangssituation und die Forschungsfrage beschreibt. Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen des interreligiösen Lernens vor, indem es Voraussetzungen, Ziele, begriffliche Annäherungen und Grundfragen des interreligiösen Lernens beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Praxis des interreligiösen Lernens und analysiert drei Lehrbücher auf ihren „interreligiösen“ Gehalt.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, Religionsunterricht, Lehrbuch, Islam, evangelisch, Regelschule, kulturelle Vielfalt, Pluralismus, Toleranz, Verständnis, Verständigung, Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Gesellschaftliche Aspekte
Häufig gestellte Fragen
Wie fördern Religionslehrbücher das interreligiöse Lernen?
Sie bieten Informationen, Bilder und Aufgabenstellungen zu anderen Religionen, um Vorurteile abzubauen und Verständnis für kulturelle Vielfalt zu wecken.
Wird der Islam in evangelischen Religionsbüchern ausreichend thematisiert?
Die Magisterarbeit zeigt, dass ältere Lehrwerke den Islam oft vernachlässigen, neuere Bücher ihn jedoch verstärkt als festen Bestandteil des Lehrplans integrieren.
Was sind die Ziele des interreligiösen Lernens?
Zentrale Ziele sind die Entwicklung von Toleranz, die Fähigkeit zum Dialog und das Verständnis für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Weltreligionen.
Welche Lehrbücher wurden in der Analyse untersucht?
Untersucht wurden moderne Werke wie „Kursbuch Religion elementar“, „Religion entdecken – verstehen – gestalten“ und „RELI+wir“.
Wo liegen die Grenzen des interreligiösen Lernens mit Lehrbüchern?
Lehrbücher können persönliche Begegnungen nicht ersetzen und vermitteln oft ein vereinfachtes oder statisches Bild von Religionen.
Welche Rolle spielt der Thüringer Lehrplan für diese Arbeit?
Der Lehrplan gibt vor, ab welcher Klassenstufe andere Religionen behandelt werden müssen, was die Grundlage für die Gestaltung der Lehrbücher bildet.
- Citar trabajo
- B.A. Ranja Fehlhauer (Autor), 2009, Möglichkeiten und Grenzen interreligiösen Lernens durch den Einsatz von Religionslehrbüchern im evangelischen Religionsunterricht der Regelschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145785