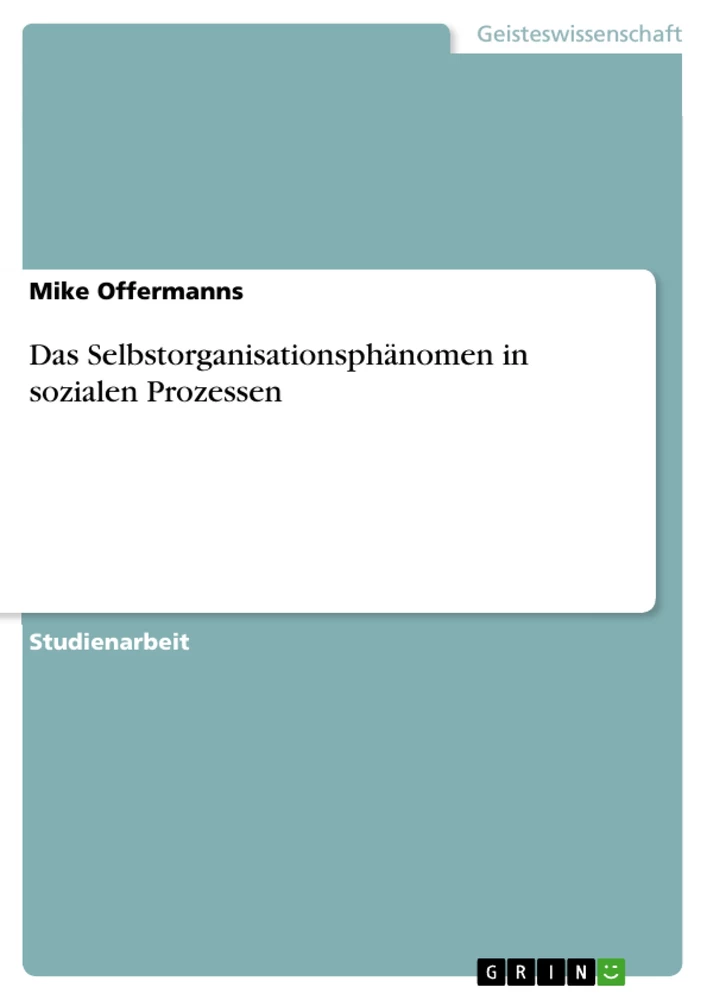Einführung in die Problemstellung
“Ordnung ist von uns wahrgenommene Regelmäßigkeit und Zuschreibbarkeit.”(1) Ordnung vermittelt uns Konsistenz und Kontinuität. Sie gibt uns die Möglichkeit, sich bei komplizierten
Institutionen oder komplexen Systemen zurechtzufinden und macht ein System überschaubar und zugänglich. Natürlich muß zwangsweise die Frage aufkommen, in wieweit Ordnung entstehen kann. Genauso muß man sich die Frage stellen, wie Ordnung garantiert werden kann.
Prost kennzeichnet alles, was verantwortlich für Ordnungsbildung und Ordnungserhaltung ist, mit Organisation.(2)
Damit aber kann man das Ordnungsphänomen nicht allein erklären. Es gibt auch spontane Prozesse der Ordnungsbildung, die nicht unbedingt gelenkt und durch Menschenhand bewußt gesteuert worden sind. Hier bekommt gerade in den letzten Jahren der Begriff “Selbstorganisation”
immense Bedeutung. Selbstorganisation ist generell eine Eigenschaft von Systemen.
Selbstorganisation ist ein Meta-Konzept für das Verstehen von Entstehung, Aufrechterhaltung und Entwicklung von Ordnungsmuster. Ein Meta-Konzept ist es deswegen, da die Ordnungsprozesse
immer aus ganzheitlicher Sicht zu sehen und nie isoliert zu betrachten sind. Rückschlüsse auf das ganze System ermöglicht dem Betrachter eine bessere Sichtweise und macht bestimmte Zusammenhänge und Vernetzungen verständlich. Teile eines Systems weisen immer
Interdependenzen mit dem ganzen System auf.
[...]
_____
1 Probst, Gilbert: Selbst-Organisation, Hamburg 1987, S. 9
2 ebenda, S.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Problemstellung
- Darstellung des Selbstorganisationsphänomen in sozialen Prozessen nach Gilbert J.B. Probst
- Verschiedene Systemarten auf verschiedenen Ebenen
- Das systemische und kybernetische Denken als Basis
- Prozesse der Ordnungsbildung in sozialen Systemen
- Bedeutung des Konstruktivismus
- intrinsische Charakteristiken
- Selbstreferenz
- Komplexität
- Redundanz
- Autonomie
- Organisieren im sozialen System
- Substantielles Organisieren
- Symbolisches Organisieren
- Organisieren im selbstorganisierenden System
- Neuere Analysen zur Selbstorganisation
- Neuerungen des Selbstorganisationsprozesses nach Helmut Kasper
- Luhmanns systemtheoretischer Ansatz
- Weicks Modell des Organisierens
- Kaspers Modell der "Handhabung selbstorganisierender Prozesse in formal organisierten Systemen"
- Das gradualistische Konzept von Kirsch und Knyphausen
- Über das entwickelte Konzept
- Die "biologische Anwendungsstrategie"
- Die Anwendung der allgemeinen Systemtheorie
- Das gradualitische Konzept
- Neuerungen des Selbstorganisationsprozesses nach Helmut Kasper
- Zusammenfassung aller Modelle und Herausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Zusammenfassung der drei Konzepte
- Versuch einer Abwägung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Selbstorganisationsphänomen in sozialen Prozessen und analysiert dessen Bedeutung für das Verständnis von Ordnungsbildung und -erhaltung. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung verschiedener Theorien und Modelle, die das Konzept der Selbstorganisation erklären und in unterschiedliche Systemtypen einordnen.
- Die Bedeutung des Konstruktivismus für das Verständnis von Selbstorganisation.
- Die Analyse von Selbstorganisationsprozessen in verschiedenen Systemtypen (physikalische, biologische, soziale Ebene).
- Die Integration von Selbstorganisation in gängige Managementtheorien und das Konzept des visionären Managements.
- Die Herausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in verschiedenen Modellen der Selbstorganisation.
- Die Untersuchung des Einflusses von Selbstorganisation auf die Gestaltung und Steuerung von sozialen Systemen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Selbstorganisation ein und erläutert die Bedeutung von Ordnung in sozialen Prozessen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie Ordnung entstehen und erhalten werden kann, wobei der Schwerpunkt auf spontanen Ordnungsbildungsprozessen liegt. Das Kapitel verdeutlicht die Bedeutung des Begriffs "Selbstorganisation" im Kontext der Systemtheorie und stellt die verschiedenen Aspekte der Selbstorganisation (z. B. Selbstreferenz, Komplexität, Redundanz, Autonomie) vor.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Darstellung des Selbstorganisationsphänomens nach Gilbert J.B. Probst. Es werden verschiedene Systemtypen auf verschiedenen Ebenen (physikalische, biologische, soziale) vorgestellt und die Rolle der Selbstorganisation in diesen Systemen erläutert. Zudem wird auf den konstruktivistischen Ursprung von Probsts Konzept eingegangen, wobei die Bedeutung des Beobachters für die Konstruktion von Ordnung hervorgehoben wird. Schließlich werden die Aspekte des "substantiellen" und "symbolischen Organisierens" in sozialen Systemen im Kontext der Selbstorganisation diskutiert.
Kapitel drei befasst sich mit neueren Analysen zur Selbstorganisation. Es werden die Ansätze von Helmut Kasper und die Gradualistische Theorie von Kirsch und Knyphausen vorgestellt. Kaspers Modell konzentriert sich auf die "Handhabung selbstorganisierender Prozesse in formal organisierten Systemen" und bezieht dabei die systemtheoretischen Ansätze von Luhmann und Weick ein. Im Gegensatz dazu entwickeln Kirsch und Knyphausen ein gradualistisches Konzept der Autopoesie, welches den verschiedenen Sinnmodellen von Organisationen Rechnung trägt.
Im letzten Kapitel werden die verschiedenen Modelle der Selbstorganisation zusammengefasst und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Es erfolgt eine Abwägung der verschiedenen Ansätze und eine Diskussion ihrer Relevanz für die Gestaltung und Steuerung von sozialen Systemen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Selbstorganisation, soziale Prozesse, Ordnungsbildung, Systemtheorie, Konstruktivismus, Management, visionäres Management, Autopoiesis, Gradualismus, Luhmann, Weick, Probst, Kasper, Kirsch, Knyphausen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Selbstorganisation“ in sozialen Systemen?
Selbstorganisation beschreibt spontane Prozesse der Ordnungsbildung, die nicht bewusst durch Menschenhand gesteuert oder von außen aufgezwungen werden.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus für dieses Konzept?
Der Konstruktivismus betont, dass Ordnung eine subjektive Wahrnehmung des Beobachters ist; Systeme konstruieren ihre eigene Realität und Ordnungsmuster.
Was sind die Kernmerkmale selbstorganisierender Systeme?
Wichtige Merkmale sind Selbstreferenz (Autopoiesis), Komplexität, Redundanz und Autonomie.
Wer sind die wichtigsten Theoretiker in diesem Bereich?
Die Arbeit behandelt Ansätze von Gilbert Probst, Niklas Luhmann (Systemtheorie), Karl E. Weick und Helmut Kasper.
Wie kann Selbstorganisation im Management genutzt werden?
Im visionären Management geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich produktive Selbstorganisationsprozesse innerhalb formaler Organisationen entfalten können.
- Citar trabajo
- Mike Offermanns (Autor), 1995, Das Selbstorganisationsphänomen in sozialen Prozessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458