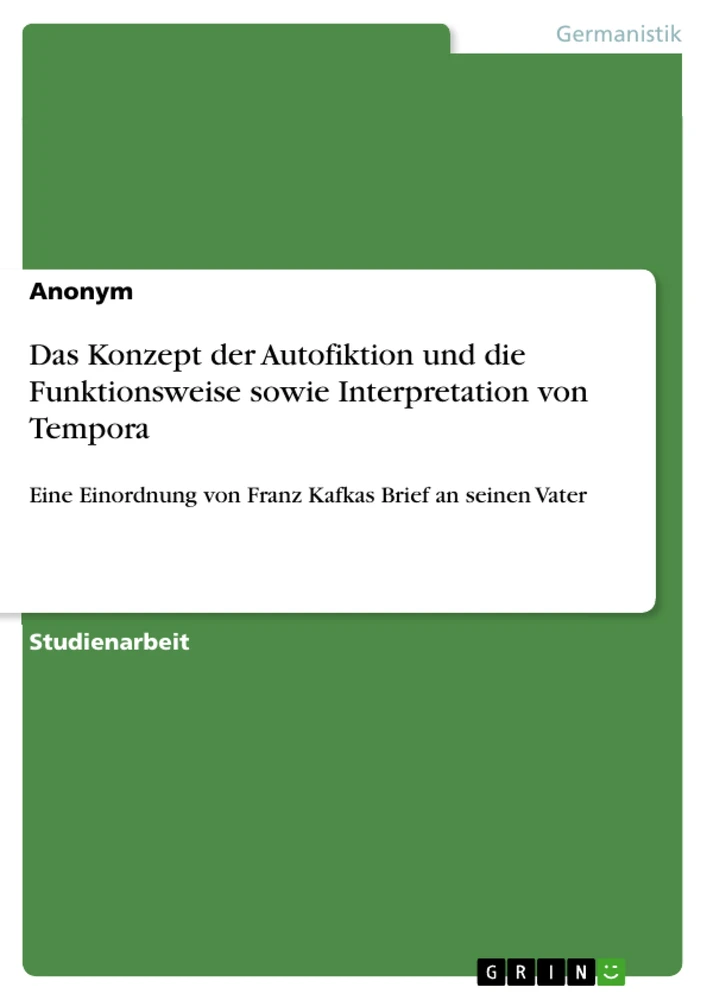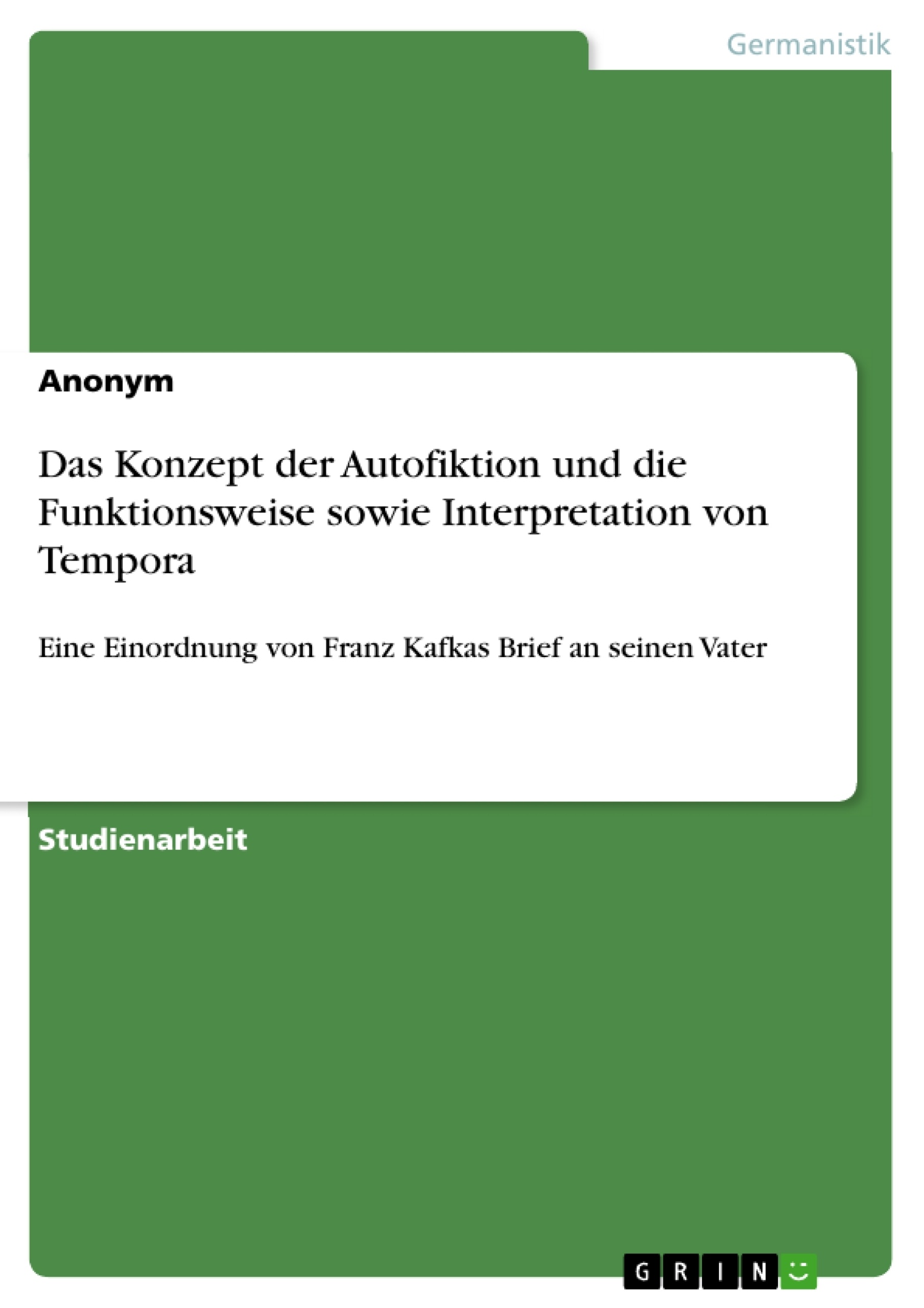Die Autofiktion hat in den letzten Jahren sowohl aus Sicht der Autoren als auch aus Sicht der Leser an Popularität gewonnen. Das liegt unter anderem an den vielfältigen, für die Leser häufig als spannender empfundenen Gestaltungsmöglichkeiten, die autofiktionale Texte im Vergleich zur Autobiographie bieten. Doubrovsky, der Begründer der Autofiktion, spricht von der Ermöglichung einer interessanteren sowie spannenderen Schreibweise, sodass prinzipiell jeder Autor, unabhängig von seinen Lebensumständen und seinem Bekanntheitsgrad, systemrelevante Texte verfassen kann. Im Zusammenhang damit steht auch die Literaturwissenschaftlerin Käte Hamburger, die in Anlehnung an die Fiktion ihre These zum epischen Präteritum vorstellt. Ihre These hätte folgenreiche Konsequenzen für die Sprachwissenschaft und ihre Interpretationsspielräume. Gisa Rauh stellt auf deiktischer Grundlage einen Bezug zu der These des epischen Präteritums her und macht das Phänomen auf diese Weise greif- und erklärbar. Die Hausarbeit verfolgt einerseits das Ziel herauszufinden, welches konzeptionelle Verständnis der Autofiktion zugrunde liegt, um auf dieser Grundlage den Brief Kafkas an seinen Vater einzuordnen. Andererseits sollen die Funktion und Interpretation der darin verwendeten Tempora aufschlussreiche Erkenntnisse über den Brief generieren und eine Forschungsgrundlage bilden, sodass hypothetische Ansätze entwickelt werden, inwieweit das Tempus rein temporal oder auch fiktional interpretiert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Autofiktion
- 2.1 Autobiographie
- 2.2 Autofiktionales Erzählen - Die Grenzen zwischen faktualer und fiktiver Welt?
- 3 Forschungsansätze
- 3.1 Käte Hamburger - Hamburger These
- 3.2 Gisa Rauh – Deixis
- 3.3 Rauhs deiktische Grundlage des epischen Präteritums
- 4 Modellanwendung – Der Brief von Kafka an seinen Vater
- 4.1 Inhaltsangabe
- 4.2 Einordnung des Briefes
- 4.3 Funktion und Interpretation des Tempus
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Autofiktion und wendet es auf Franz Kafkas Brief an seinen Vater an. Das Hauptziel ist es, das konzeptionelle Verständnis von Autofiktion zu erarbeiten und den Brief Kafkas in diesen Kontext einzuordnen. Weiterhin soll die Funktion und Interpretation der verwendeten Tempora analysiert werden, um Erkenntnisse über den Brief und die Möglichkeiten einer rein temporalen oder fiktionalen Interpretation des Tempus zu gewinnen.
- Begriffsbestimmung von Autofiktion im Vergleich zur Autobiographie
- Analyse der Hamburger These zum epischen Präteritum
- Anwendung des deiktischen Ansatzes von Gisa Rauh auf die Analyse von Tempus
- Einordnung von Kafkas Brief an seinen Vater im Kontext der Autofiktion
- Interpretation der Tempusfunktion in Kafkas Brief
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Autofiktion ein und beschreibt den wachsenden Einfluss dieses Genres in der Literatur. Sie hebt die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Autofiktion im Vergleich zur Autobiographie hervor und erwähnt die Beiträge von Doubrovsky, Käte Hamburger und Gisa Rauh. Die Arbeit skizziert ihre Ziele: die Klärung des Autofiktionskonzepts, die Einordnung von Kafkas Brief an seinen Vater und die Analyse der Tempusfunktion in diesem Brief, um die Interpretationsspielräume des Tempus zu beleuchten (rein temporal oder fiktional).
2 Autofiktion: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Definition und die verschiedenen theoretischen Ansätze zum autofiktionalen Erzählen. Es werden die Komponenten Autobiographie und Fiktion beleuchtet und ihr Spannungsverhältnis untersucht, um das vielschichtige Konzept der Autofiktion zu verstehen und einen Vergleich zum autobiographischen Ansatz zu ermöglichen. Die Arbeit thematisiert die Frage nach den Grenzen der Literatur, die durch Autofiktion aufgeworfen werden.
2.1 Autobiographie: Das Unterkapitel beginnt mit der Segmentierung des Begriffs "Autobiographie" (graphia, bios, auto) und erläutert die Definition von Georg Misch. Anschließend wird Lejeunes "autobiographischer Pakt" vorgestellt und kritisch diskutiert, wobei die Merkmale Retrospektive, Prosaform und persönliche Erfahrung sowie die Übereinstimmung von Autor, Erzähler und Protagonist hervorgehoben werden. Die Bedeutung der Erinnerung, ihre Selektivität und die damit verbundenen Verzerrungen der Darstellung werden untersucht, wobei das "Pars pro Toto"-Prinzip betont wird und die Frage nach der Wahrhaftigkeit in Autobiographien aufgeworfen wird.
3 Forschungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert die relevanten Forschungsansätze, die für die Analyse der Autofiktion und des Tempus in Kafkas Brief zentral sind. Es erläutert die Hamburger These zum epischen Präteritum und verknüpft diese mit Gisa Rauhs deiktischem Ansatz, um das Phänomen des epischen Präteritums greifbar und erklärbar zu machen. Diese theoretischen Grundlagen bilden die Basis für die nachfolgende Analyse von Kafkas Brief.
4 Modellanwendung – Der Brief von Kafka an seinen Vater: In diesem Kapitel wird die theoretische Grundlage auf Kafkas Brief angewendet. Die Analyse fokussiert darauf, ob der Brief als autobiographischer Text einzustufen ist und welche Funktion und Interpretation das darin verwendete Tempus besitzt. Eine detaillierte Inhaltsangabe und Einordnung des Briefes bilden die Grundlage für die Tempusanalyse und die Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Tempus rein temporal oder auch fiktional interpretiert werden kann.
Schlüsselwörter
Autofiktion, Autobiographie, Fiktion, episches Präteritum, Hamburger These, Deixis, Tempora, Franz Kafka, Brief an den Vater, Textinterpretation, literarische Gattungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Franz Kafkas Brief an den Vater im Kontext der Autofiktion
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Franz Kafkas Brief an seinen Vater unter dem Aspekt der Autofiktion. Sie untersucht, wie das Konzept der Autofiktion auf den Brief angewendet werden kann und welche Rolle das Tempus (Zeitform) in der Interpretation spielt. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das Tempus im Brief rein temporale Bedeutung hat oder auch fiktionale Aspekte trägt.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Forschungsansätze. Die Hamburger These zum epischen Präteritum und der deiktische Ansatz von Gisa Rauh bilden die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Tempus in Kafkas Brief. Der Begriff der Autofiktion wird im Vergleich zur Autobiographie definiert und diskutiert.
Wie wird Autofiktion definiert und von Autobiographie abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und differenziert die Begriffe Autofiktion und Autobiographie. Sie beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Genres und untersucht das Spannungsverhältnis zwischen autobiographischen Elementen und fiktiven Gestaltungsmitteln in autofiktionalen Texten. Die Frage nach den Grenzen zwischen faktualer und fiktiver Welt wird thematisiert.
Welche Rolle spielt das Tempus (Zeitform) in der Analyse?
Das Tempus spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht die Funktion und Interpretation des in Kafkas Brief verwendeten Tempus. Es wird analysiert, ob das Tempus rein temporal (zeitlich) verstanden werden kann oder ob es auch fiktionale Bedeutungen trägt. Die Analyse verbindet die theoretischen Ansätze von Hamburger und Rauh mit der konkreten Anwendung auf den Brief Kafkas.
Wie wird Kafkas Brief an seinen Vater in die Analyse eingebunden?
Kafkas Brief an seinen Vater dient als Modellanwendung für die theoretischen Überlegungen. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Inhaltsangabe und Einordnung des Briefes. Die Tempusanalyse konzentriert sich darauf, ob der Brief als autobiographischer Text betrachtet werden kann und welche Bedeutung die gewählte Zeitform für die Interpretation hat.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Autofiktion (mit Unterkapitel zur Autobiographie), Forschungsansätze (Hamburger These und Rauhs Deixis), Modellanwendung – Kafkas Brief an seinen Vater (Inhaltsangabe, Einordnung, Tempusanalyse), Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autofiktion, Autobiographie, Fiktion, episches Präteritum, Hamburger These, Deixis, Tempora, Franz Kafka, Brief an den Vater, Textinterpretation, literarische Gattungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, das konzeptionelle Verständnis von Autofiktion zu erarbeiten und den Brief Kafkas in diesen Kontext einzuordnen. Die Analyse der Tempusfunktion soll Erkenntnisse über den Brief und die Möglichkeiten einer rein temporalen oder fiktionalen Interpretation des Tempus liefern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Das Konzept der Autofiktion und die Funktionsweise sowie Interpretation von Tempora, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1459005