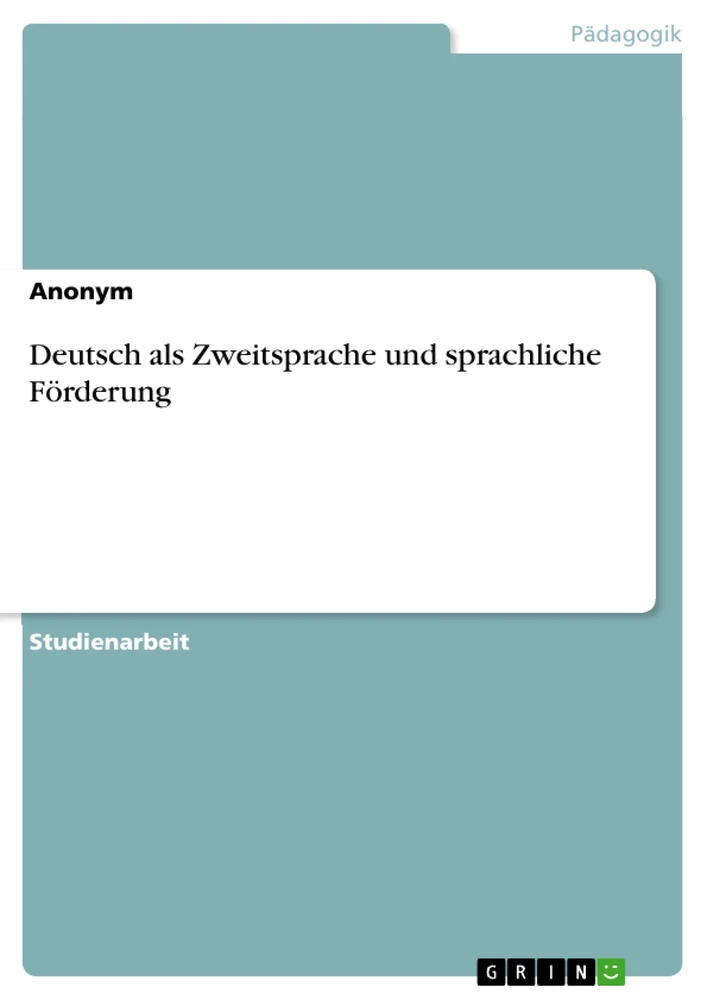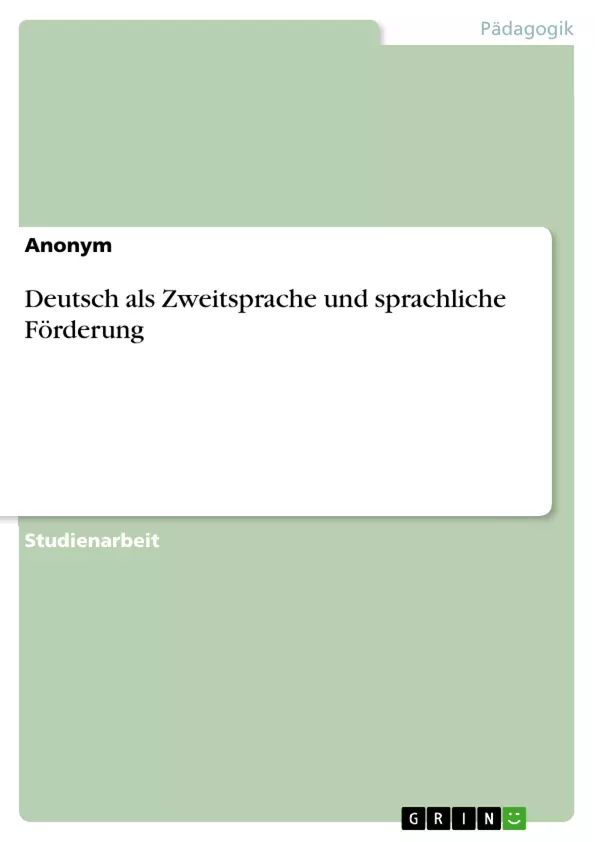Bei der folgenden Lerngruppe handelt es sich um eine sechste Klasse des X Gymnasiums. Insgesamt umfasst die Regelklasse 27 Schülerinnen und Schüler, wobei alle Lernenden Deutsch als Erstsprache (L1) erworben haben. Auf Grund dessen ist die Klasse durch eine auffallend hohe sprachliche Homogenität gekennzeichnet. Der Erwerb einer sukzessiv früh oder spät erworbenen Zweitsprache (L2) ist weder in Deutsch noch in einer anderen Sprache gegeben, da in jeder der Familien zuhause Deutsch gesprochen wird. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist monolingual aufgewachsen, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler seit ihrer Geburt ausschließlich eine Sprache (Deutsch), als alleinige Erstsprache erlernt haben. Der Spracherwerb in der Muttersprache Deutsch hat bei allen Schülerinnen und Schüler durch Imitation enger Bezugspersonen und der alltäglichen Umgebung mit der deutschen Sprache stattgefunden.
Lediglich zwei Schülerinnen und Schüler der Klasse sind zweisprachig/ bilingual aufgewachsen und haben einen simultan- bilingualen Erstspracherwerb durchlaufen. Der doppelte Erstspracherwerb hat hierbei ungesteuert und anhand von muttersprachlichem Input stattgefunden. Daraus resultierend sprechen, schreiben und lesen die Schülerin und der Schüler beide Sprachen gleichermaßen gut. Zusätzlich sind die Schülerin und der Schüler in der Lage, ohne Probleme von einer Sprache in die andere zu wechseln, was nach Lüdi als code switchig bezeichnet wird. Mit Blick auf den Migrationsstatus lassen sich die Schülerin und der Schüler der "2,5 Generation" zuordnen. Dies bedeutet, dass jeweils ein Elternteil im Ausland geboren wurde, der andere Elternteil und das Kind dagegen im Inland. Insgesamt kann die Mehrheit der Klasse zwischen der im außerschulischen Kontext gesprochenen Alltagssprache und der im Schulkontext gesprochenen Bildungssprache differenzieren. Auch wenn sich die Ausprägung der Fach- und Bildungssprache noch in den Anfängen befindet, ist dennoch ein überdurchschnittlich gutes Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler zu beobachten. Dies lässt sich durch den hohen sozioökonomischen Status der Eltern begründen und dem damit verbundenen gut ausgeprägten Sprach- und Bildungsniveau der Eltern.
Inhaltsverzeichnis
- Sprachliche Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Lerngruppe
- Fachliche Kompetenzen der Unterrichtseinheit
- Sprachliche Anforderungen der fachlichen Ziele der Unterrichtseinheit
- Sprachliche Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die Unterrichtsziele und Ableitung sprachlicher Lernziele
- Sprachsensible Unterrichtsgestaltung mit Bezugnahme auf sprachsensible Unterrichtsmethoden und Sprachförderkonzepte
- Wesentliche Merkmale der Praktikumsschule und Konzepte sprachlicher Bildung auf der Ebene der Bildungseinrichtung
- Aufgabe im Rahmen des Seminars
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Heterogenität einer sechsten Klasse und untersucht, wie die spezifischen sprachlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht Berücksichtigung finden können. Sie stellt die fachlichen Kompetenzen der Unterrichtseinheit „Spaß am Laufen – Wir trainieren unsere Ausdauer“ dar und beleuchtet die sprachlichen Anforderungen, die sich aus den Lernzielen ergeben. Darüber hinaus werden sprachsensible Unterrichtsmethoden und Sprachförderkonzepte vorgestellt, die eine adäquate Unterstützung der Lernenden im Bereich der Fachsprache gewährleisten.
- Sprachliche Heterogenität in der Lerngruppe
- Fachliche Kompetenzen im Sportunterricht
- Sprachliche Anforderungen im Kontext der Unterrichtseinheit
- Sprachsensible Unterrichtsgestaltung
- Sprachförderung im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt die sprachliche Heterogenität der Lerngruppe und analysiert die sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Das zweite Kapitel erläutert die fachlichen Kompetenzen der Unterrichtseinheit „Spaß am Laufen – Wir trainieren unsere Ausdauer“ und stellt die Lernziele sowie die methodischen Vorgehensweisen vor. Im dritten Kapitel werden die sprachlichen Anforderungen der Unterrichtseinheit im Detail betrachtet und die notwendigen sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler herausgearbeitet. Die Kapitel 4 und 5 beschäftigen sich mit der sprachsensiblen Unterrichtsgestaltung und präsentieren verschiedene Methoden und Konzepte zur Sprachförderung im Sportunterricht.
Schlüsselwörter
Sprachliche Heterogenität, Fachsprache, Sportunterricht, Sprachförderung, Sprachsensible Unterrichtsgestaltung, Sprachförderkonzepte, Ausdauertraining, Lerngruppe, Unterrichtsziele, Lernziele, Methoden, Konzept, Unterrichtseinheit, Praktikumsschule.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2023, Deutsch als Zweitsprache und sprachliche Förderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1460092