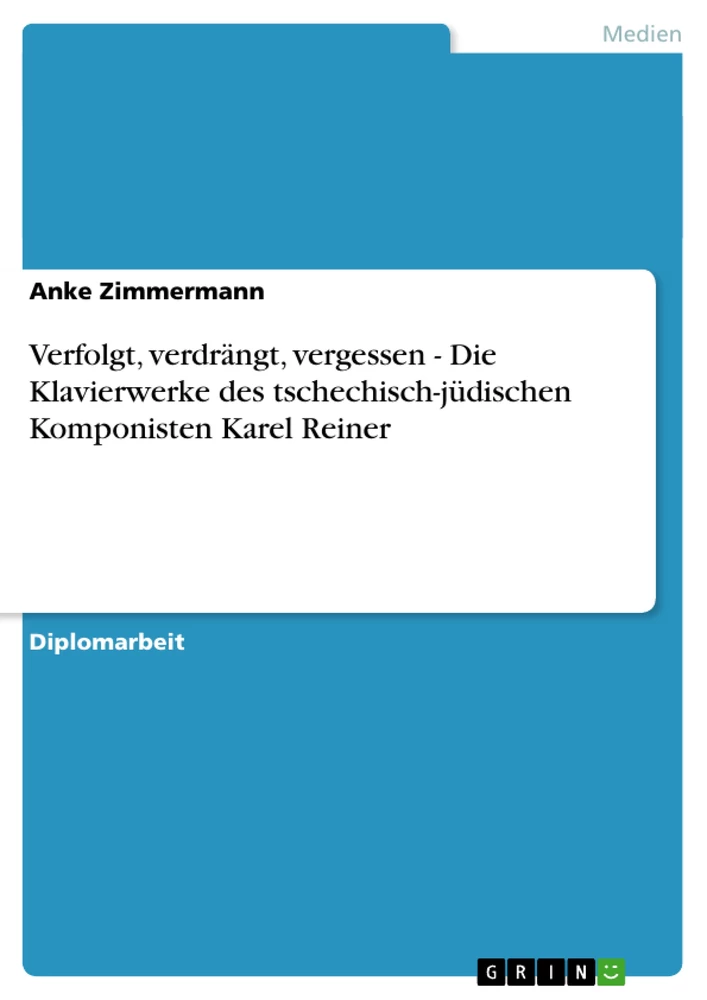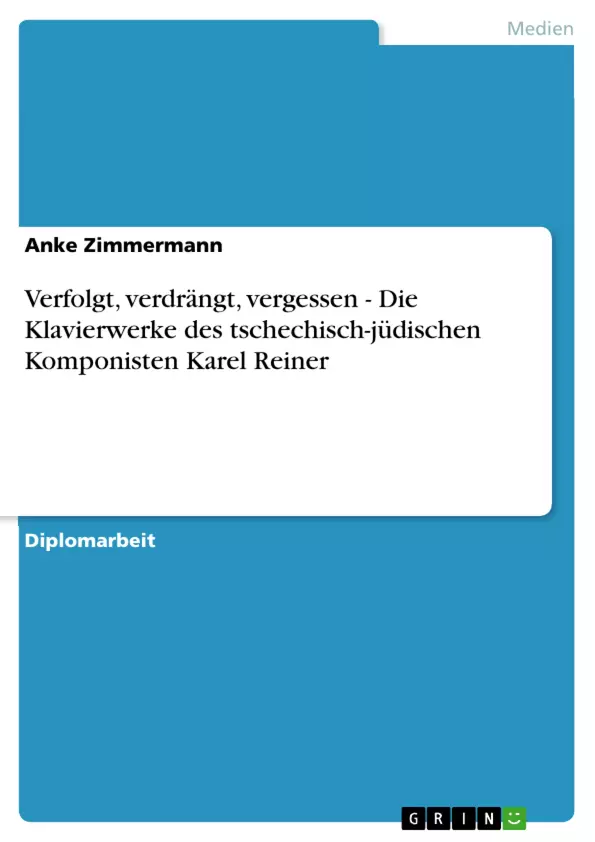Karel Reiner, einer der wichtigsten Vertreter der tschechischen Avantgarde-Musik, war unter zwei Diktaturen aus unterschiedlichen Gründen politischer Verfolgung bzw.Diskriminierung ausgesetzt. Die vorliegende Arbeit versucht, am Beispiel der Biografie
und des Klavierwerkes dieses jüdischen Komponisten die komplexen Zusammenhänge von politischen Rahmenbedingungen und dem Schaffen dieses Künstlers aufzuzeigen und zu erörtern. Ausgehend von Selbstzeugnissen Karel Reiners und Aussagen engster Vertrauter und
Freunde sowie umfangreicher Archivrecherchen, werden in der vorliegenden Arbeit biografisch und künstlerisch relevante Stationen des Werdeganges eines Opfers zweier Diktaturen aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht.
In der Darstellung werden bewusst biografische und werkanalytische Gesichtspunkte miteinander verflochten, da auf diesem Wege die Beantwortung der Frage nach den wechselweisen Zusammenhängen von politischem Kontext, Entstehungsgeschichte und
Komponistenintention am ehesten realisierbar scheint.Im Rahmen dieser Arbeit soll auch kritisch hinterfragt werden, warum die Musik Karel Reiners, der als Komponist und Pianist im Ghetto Theresienstadt wirkte, bis heute kaum Beachtung im Rahmen sich ständig mehrender Gedenkkonzerte findet. Diese Gedenkkonzerte werden nur allzu oft mit Bezeichnungen, wie „Musik aus Theresienstadt“ etikettiert und wirken damit gelegentlich sogar der eigentlichen Intention solcher Veranstaltungen kontraproduktiv entgegen, indem sie den Fokus auf die zweifellos
zahlreichen kulturellen Aktivitäten hinter Stacheldraht richten, nicht jedoch auf die eigentliche von Elend und Tod geprägte Lagerrealität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand und Fragestellung
- Quellen und Material
- Geburtsstunden: Kindheit und Jugend Karel Reiners zwischen Weltkrieg und Neubeginn in der ersten Tschechoslowakischen Republik
- Politische Wirren der Nachkriegszeit
- Vielfalt in der Einheit: Auf der Suche nach dem persönlichen Stil
- Lehrjahre
- Josef Suk und Alois Hába
- Musikalischer Spagat zwischen „Volkston“ und „Viertelton“
- Vielschichtige Aufgaben: Emil František Burian und das Theater D 34-38
- Wachsende Bedrohung: Nationalsozialistische Machtübernahme und Liquidierung der Tschechoslowakischen Republik
- Flucht in die Illegalität: Private Hauskonzerte
- Musikalischer Protest
- Theresienstadt
- ,,Mehr als nur die physische Existenz ...“: Musik hinter Stacheldraht und Ghettowall
- „Freizeitgestaltung“ als Propaganda
- Dem Tode entkommen: Rückkehr nach Prag
- Neubeginn in der „Sozialistischen Republik“
- Kader, Kunst und Komponisten
- Gescheiterte Träume: Der „Prager Frühling“ und seine Konsequenzen
- Parteiaustritt mit Folgen
- Erneute Verdrängung
- Zu Möglichkeiten und Grenzen der „Oral History“ für die Biografie-Forschung am Beispiel des Komponisten Karel Reiner
- Politische Dimensionen im (Klavier)-Werk Karel Reiners
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Leben und Werk des tschechisch-jüdischen Komponisten Karel Reiner im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts zu erforschen. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen Reiner in seiner Karriere begegnete, und untersucht die Auswirkungen dieser Erfahrungen auf seine musikalische Entwicklung.
- Karel Reiners musikalischer Werdegang im Spannungsfeld von Politik und Kunst
- Die Beeinflussung von Reiners Kompositionsweise durch die politischen Ereignisse in der Tschechoslowakei
- Die Rolle der Musik in Reiners Leben während der nationalsozialistischen Herrschaft und im Ghetto Theresienstadt
- Die Verdrängung und Vergessenheit von Reiners Werk nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Rezeption von Reiners Musik im Kontext von "Oral History" und Biografieforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie bietet einen Überblick über die Quellen und Materialien, die für die Untersuchung herangezogen wurden.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Reiners Kindheit und Jugend zwischen Weltkrieg und Neubeginn in der ersten Tschechoslowakischen Republik. Es analysiert den Einfluss der politischen Wirren auf Reiners musikalische Entwicklung und seine Suche nach einem persönlichen Stil.
Kapitel drei beleuchtet Reiners Lehrjahre unter den einflussreichen Komponisten Josef Suk und Alois Hába. Es untersucht den Spagat zwischen "Volkston" und "Viertelton" in Reiners musikalischer Ausbildung.
Das vierte Kapitel widmet sich den zunehmenden Bedrohungen durch die nationalsozialistische Machtübernahme und die Liquidierung der Tschechoslowakischen Republik. Es beschreibt Reiners Flucht in die Illegalität und seinen musikalischen Protest gegen die Naziherrschaft.
Kapitel fünf beleuchtet Reiners Zeit in Theresienstadt und die Bedeutung der Musik im Ghetto. Es analysiert die Rolle der Musik als Mittel der Propaganda und der geistigen Widerstandes.
Kapitel sechs untersucht Reiners Rückkehr nach Prag und seinen Neubeginn in der "Sozialistischen Republik". Es beleuchtet die Schwierigkeiten, denen er als Künstler und Komponist im kommunistischen System begegnete.
Kapitel sieben analysiert die Auswirkungen des "Prager Frühlings" auf Reiners Leben und Karriere. Es beschreibt seinen Parteiaustritt und die erneute Verdrängung seines Werkes.
Schlüsselwörter
Karel Reiner, tschechisch-jüdischer Komponist, Musikgeschichte, 20. Jahrhundert, politische Umbrüche, Nationalsozialismus, Theresienstadt, "Oral History", Biografieforschung, Verdrängung, Vergessenheit, musikalische Entwicklung, Kompositionsstil.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Karel Reiner?
Ein tschechisch-jüdischer Komponist und Vertreter der Avantgarde, der unter dem Nationalsozialismus und später im kommunistischen System verfolgt wurde.
Welche Rolle spielte die Musik für Reiner in Theresienstadt?
Reiner wirkte im Ghetto als Pianist und Komponist. Die Musik diente dort sowohl dem geistigen Widerstand als auch der (erzwungenen) Propaganda der Nationalsozialisten.
Warum ist Karel Reiner heute weitgehend vergessen?
Die Arbeit untersucht die doppelte Verdrängung: erst durch die Nazis und später durch das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei nach dem Prager Frühling.
Was zeichnet seinen musikalischen Stil aus?
Sein Werk bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen tschechischem „Volkston“ und moderner „Vierteltonmusik“, beeinflusst durch Alois Hába.
Was kritisiert die Arbeit an heutigen Gedenkkonzerten?
Oft wird der Fokus zu sehr auf die kulturelle Aktivität („Musik aus Theresienstadt“) gelegt, statt die grausame Lagerrealität und das Elend angemessen zu berücksichtigen.
- Citation du texte
- Anke Zimmermann (Auteur), 2004, Verfolgt, verdrängt, vergessen - Die Klavierwerke des tschechisch-jüdischen Komponisten Karel Reiner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146060