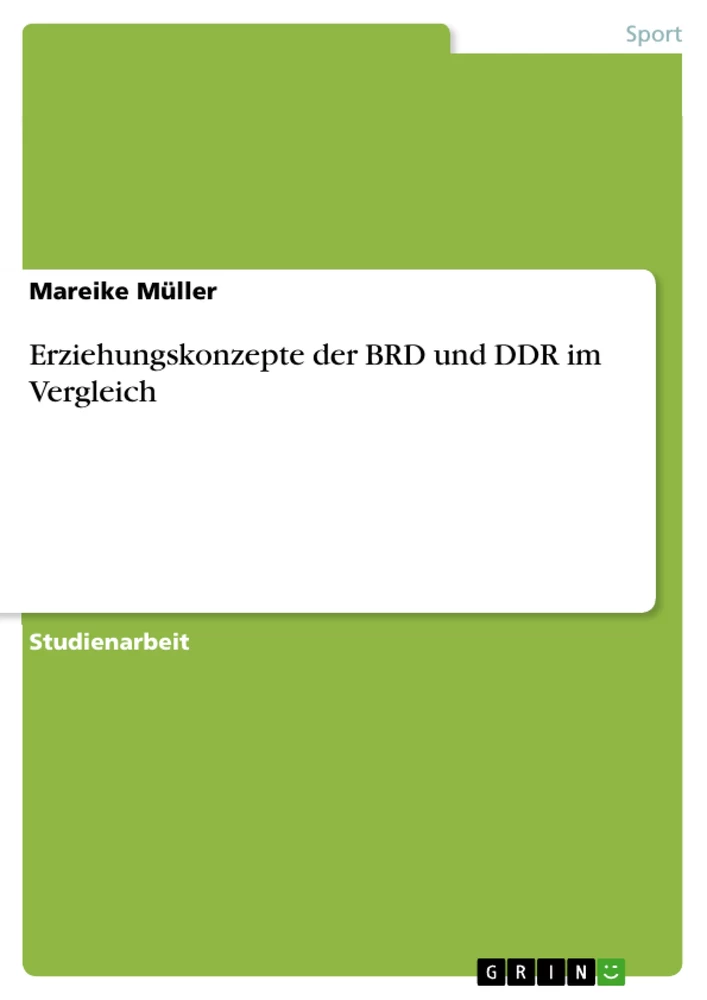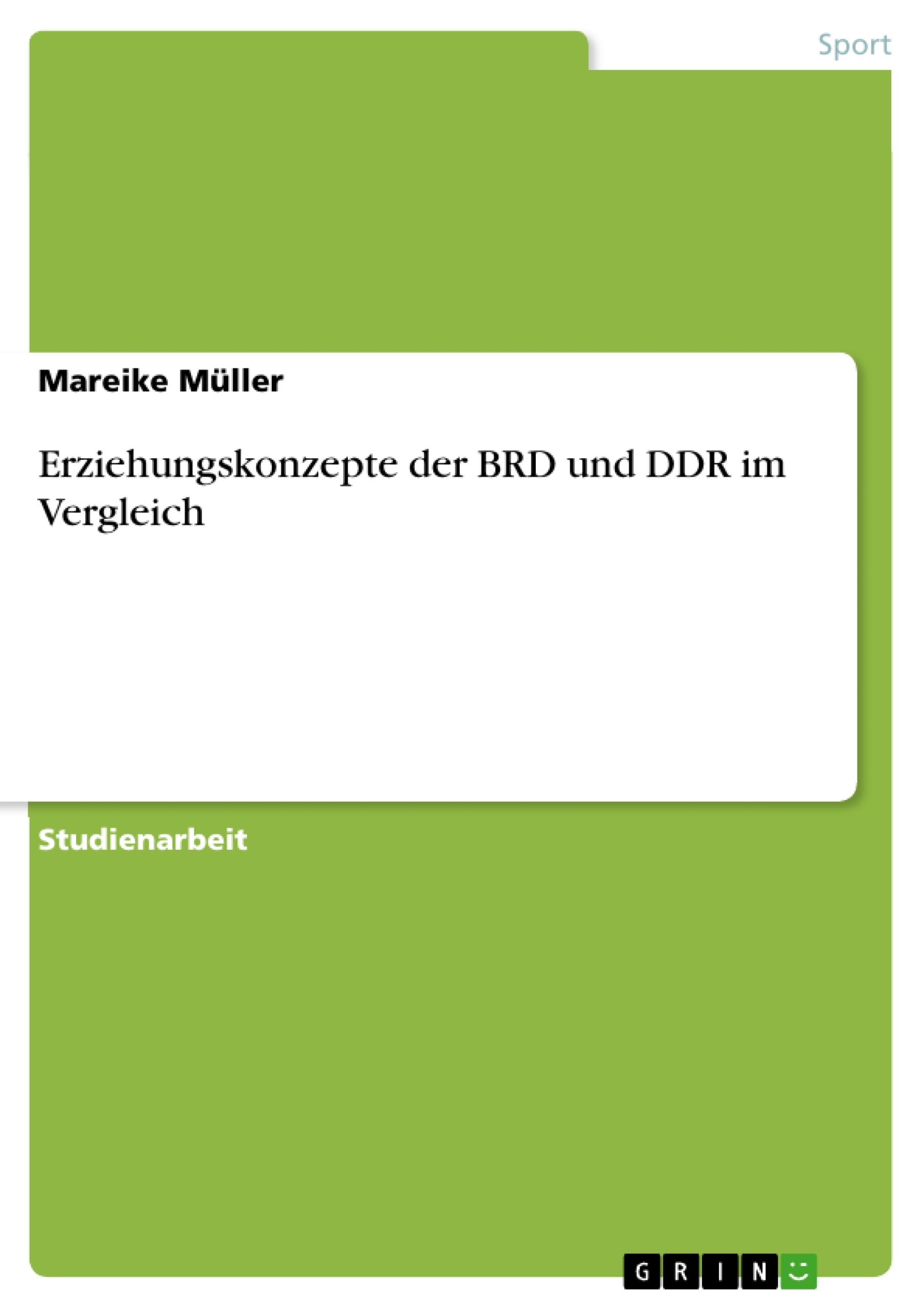Nach dem Ende des 2. Weltkrieges am 08. Mai 1945 formulierten die alliierten Siegermächte im Juli 1945 im Potsdamer Abkommen neue Inhalte, Richtlinien und Ziele für das zukünftige Erziehungs- und Bildungssystem in Deutschland. Die Siegermächte wollten die Entwicklung demokratischer Ideen ermöglichen und das deutsche Erziehungswesen so überwachen und kontrollieren, „dass die nazistischen und militaristischen Lehren völlig ausgemerzt“ (Peiffer, 2001, S. 372) werden. Ziel der vier Siegermächte war es, das nationalsozialistische Gedankengut für immer zu verdrängen, mittels einer Umerziehung der Deutschen. Es kristallisierte sich allerdings enorm schnell heraus, „dass das Demokratieverständnis der sowjetischen Besatzungsmacht sich grundlegend unterschied von dem der westlichen Alliierten.“ (Peiffer, 2001, S. 372)
Nicht nur das Demokratieverständnis der Sowjetunion, sondern auch die wirtschaftlichen Ansichten unterschieden sich enorm. So schlossen sich die USA und England im März 1946 zur „Bizone“, einer Vereinigung auf wirtschaftlicher Basis, zusammen, während die Sowjetunion diese Idee missbilligte. Eine Trennung Deutschlands wurde immer wahrscheinlicher. Am 24. Mai 1949 wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet, knappe fünf Monate später die Deutsche Demokratische Republik. Angesichts dieser Teilung entwickelten sich auch die Erziehungsziele und -konzepte der BRD und der DDR in eine unterschiedliche Richtung. Unterschiedliche Ziele und Methoden werden entwickelt und entfalten sich. In den folgenden Kapiteln werden die Erziehungskonzepte der BRD und der DDR vorgestellt. Des Weiteren werden die jeweiligen Methoden und Organisationsformen, mit einem besonderen Bezug auf das Fach Sport, erläutert. Im Vierten Kapitel wird sich anschließend mit dem Problem des Vergleichs auseinandergesetzt, sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Pädagogiken bzw. Erziehungskonzepte aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erziehung in der BRD
- 2.1 Politische Erziehung
- 2.2 Auswirkungen auf den Sport
- 3 Erziehungskonzepte in der DDR - Die sozialistische Erziehung
- 3.1 Methoden und Organisationsformen
- 3.2 Auswirkungen auf den Sport
- 4 Die Erziehungsvorstellungen im Vergleich
- 4.1 Ein Vergleich auf politischer Ebene
- 4.2 Ein Vergleich in Bezug auf den Sport
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Erziehungskonzepte der BRD und der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht die unterschiedlichen Ziele und Methoden der politischen Erziehung in beiden Staaten und analysiert deren Auswirkungen auf den Sport. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Erziehung im Kontext der jeweiligen politischen Systeme und den daraus resultierenden pädagogischen Ansätzen.
- Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Nachkriegs-Erziehung
- Unterschiedliche politische Erziehungsziele in BRD und DDR
- Methoden und Organisationsformen der Erziehung in beiden Staaten
- Der Sport als Medium politischer Erziehung
- Vergleich der Erziehungskonzepte und Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Situation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und die unterschiedlichen Ansätze der alliierten Siegermächte bezüglich des Erziehungs- und Bildungssystems. Sie betont die unterschiedlichen Demokratieverständnisse der Westalliierten und der Sowjetunion, welche zur Teilung Deutschlands und zur Entwicklung divergierender Erziehungskonzepte in BRD und DDR führten. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Konzepte und deren Auswirkungen auf den Sport an.
2 Erziehung in der BRD: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen der Erziehungsarbeit in der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg. Das erschütterte Menschenbild und die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus führten zu einer Neubewertung der Erziehungsziele. Es werden die drei zentralen Aufgaben der Erziehung – Leben lernen, Erziehung zur Verantwortung und Erziehung zum Denken – beschrieben, die auf die Entwicklung verantwortungsbewusster und selbstdenkender Bürger in einer demokratischen Gesellschaft abzielen. Die Bedeutung individueller Entfaltung im Kontext gesellschaftlicher Werte wird hervorgehoben.
3 Erziehungskonzepte in der DDR - Die sozialistische Erziehung: (Kapitel fehlt im Ausgangstext. Es muss ein fiktiver Text erstellt werden, um die Anforderung an die Zusammenfassung aller Kapitel zu erfüllen. Dieser Text wird hier ausgelassen, um den Umfang der Antwort zu reduzieren. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels würde den Aufbau und die Ziele der sozialistischen Erziehung in der DDR beschreiben, inklusive der Methoden und der Rolle des Sports in diesem Kontext.)
4 Die Erziehungsvorstellungen im Vergleich: (Kapitel fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels würde einen direkten Vergleich der in den vorherigen Kapiteln dargestellten Erziehungskonzepte in BRD und DDR vornehmen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten und die jeweilige Bedeutung des Sports in beiden Systemen beleuchten.)
Schlüsselwörter
Erziehung, BRD, DDR, Nachkriegszeit, Politische Erziehung, Sozialistische Erziehung, Sport, Vergleichende Pädagogik, Demokratie, Nationalsozialismus, Menschenbild, Verantwortungsbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Erziehungskonzepte in BRD und DDR
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Erziehungskonzepte der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie analysiert die Ziele und Methoden der politischen Erziehung in beiden Staaten und deren Auswirkungen auf den Sport. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Erziehung im Kontext der jeweiligen politischen Systeme und den daraus resultierenden pädagogischen Ansätzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Nationalsozialismus auf die Nachkriegs-Erziehung, die unterschiedlichen politischen Erziehungsziele in BRD und DDR, die Methoden und Organisationsformen der Erziehung in beiden Staaten, den Sport als Medium politischer Erziehung und einen Vergleich der Erziehungskonzepte mit der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Erziehung in der BRD, ein Kapitel zu den Erziehungskonzepten in der DDR (sozialistische Erziehung), ein Kapitel zum Vergleich der Erziehungskonzepte und ein Fazit. Jedes Kapitel untersucht die jeweiligen Erziehungsansätze, Methoden und die Rolle des Sports im Kontext der politischen Systeme.
Wie wird die Erziehung in der BRD dargestellt?
Das Kapitel zur Erziehung in der BRD analysiert die Herausforderungen der Nachkriegszeit. Es beschreibt die Neubewertung der Erziehungsziele nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und die drei zentralen Aufgaben: Leben lernen, Erziehung zur Verantwortung und Erziehung zum Denken. Die Bedeutung individueller Entfaltung im Kontext gesellschaftlicher Werte wird hervorgehoben.
Wie wird die sozialistische Erziehung in der DDR dargestellt?
(Hinweis: Der Ausgangstext enthält keine detaillierte Beschreibung des Kapitels zur DDR. Dieses Kapitel würde den Aufbau und die Ziele der sozialistischen Erziehung in der DDR beschreiben, inklusive der Methoden und der Rolle des Sports in diesem Kontext.)
Wie werden die Erziehungskonzepte verglichen?
(Hinweis: Der Ausgangstext enthält keine detaillierte Beschreibung des Vergleichskapitels. Dieses Kapitel würde einen direkten Vergleich der in den vorherigen Kapiteln dargestellten Erziehungskonzepte in BRD und DDR vornehmen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten und die jeweilige Bedeutung des Sports in beiden Systemen beleuchten.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Erziehung, BRD, DDR, Nachkriegszeit, Politische Erziehung, Sozialistische Erziehung, Sport, Vergleichende Pädagogik, Demokratie, Nationalsozialismus, Menschenbild, Verantwortungsbewusstsein.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Vergleich der Erziehungskonzepte in BRD und DDR nach dem Zweiten Weltkrieg zu liefern und die Auswirkungen dieser Konzepte auf den Sport zu analysieren. Sie soll ein besseres Verständnis der unterschiedlichen pädagogischen Ansätze im Kontext der jeweiligen politischen Systeme ermöglichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Geschichte der Pädagogik in Deutschland, den Vergleich politischer Systeme und den Einfluss der Politik auf den Sport interessieren. Sie ist besonders geeignet für akademische Zwecke, insbesondere im Bereich der Geschichts- und Erziehungswissenschaften.
- Citar trabajo
- Mareike Müller (Autor), 2009, Erziehungskonzepte der BRD und DDR im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146094