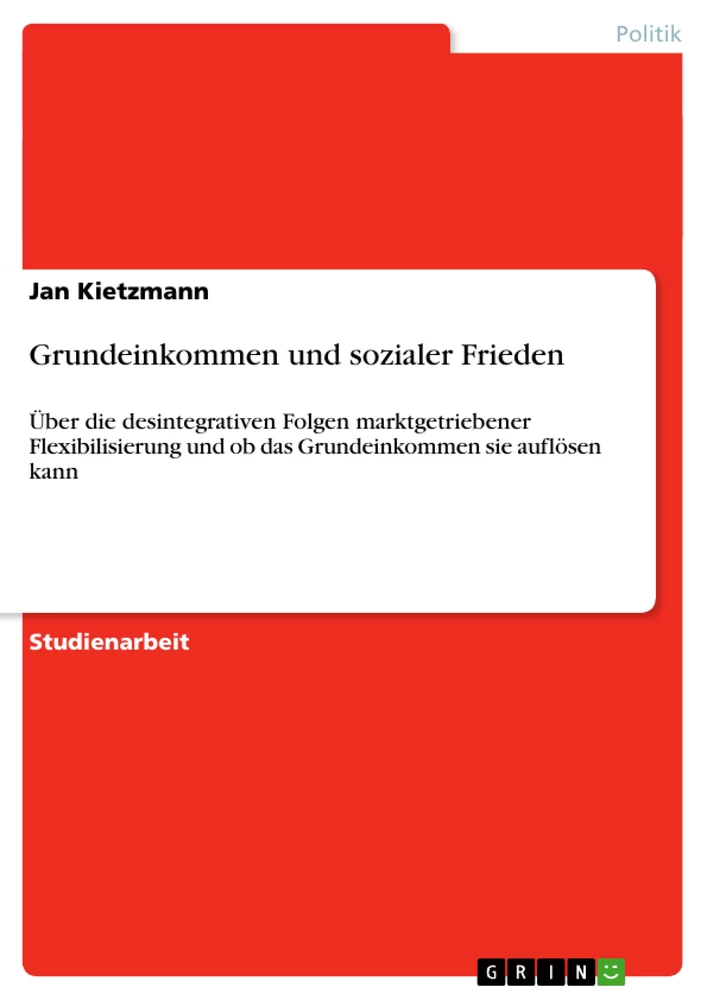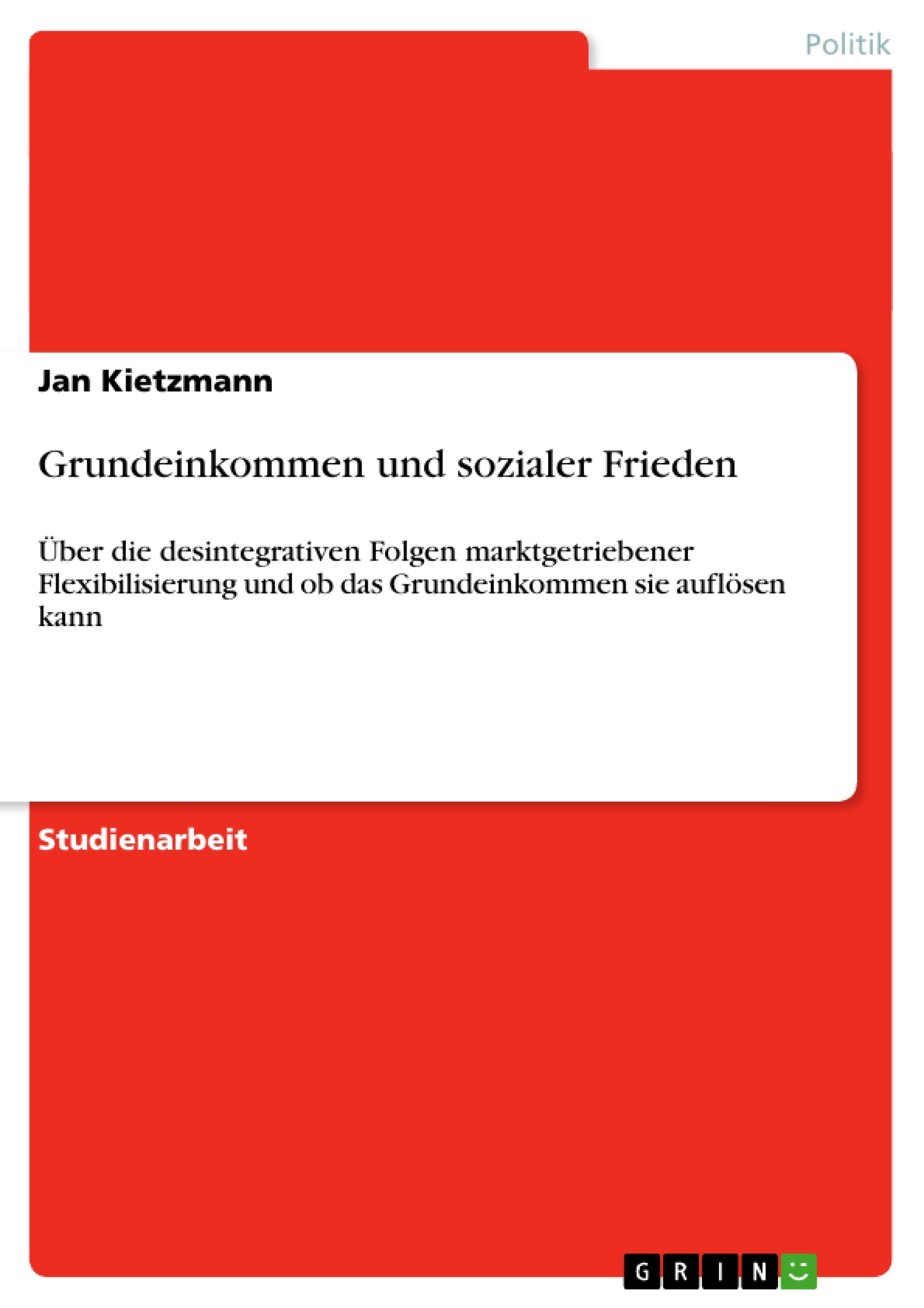Diese Arbeit untersucht ein viel diskutiertes sozialpolitisches Instrument auf seine potentielle Wirksamkeit wider die negativen sozialen Folgen von Prekarisierung: Das bedingungslose Bürgereinkommen bzw. Grundeinkommen. Wenngleich es freilich nur eine potentielle Möglichkeit von vielen darstellt, ist es doch die wohl am kontroversesten diskutierte. Skeptiker sehen die Gesellschaft zu Grunde gehen, sollte es je eingeführt werden. Ihnen zufolge raubt es dem Menschen jegliche Motivation zur Arbeit und führte zum wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Kollaps, auf keine Fall jedoch sei es geeignet, die derzeitigen Probleme des deutschen Sozialstaates zu lösen. In den Augen der Befürworter hingegen ist es die "Antithese gegen gesellschaftliche Spaltung und Exklusion". Ihnen scheint es eine viel versprechende Alternative zum derzeitigen Sozialstaatsmodell zu sein, welches bei steigenden Kosten zu immer weniger Leistungen im Stande ist und die existenzielle Absicherung der Bürger auf lange Sicht nicht mehr garantieren kann.
Es wird, nach einer Einordnung der zentralen Begrifflichkeiten und der konkreten Zielsetzung, zunächst auf das desintegrative Potential von Prekarität bzw. Prekarisierung im individuellen wie im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang eingegangen. Im letzten Teil wird das bedingungslose Bürgereinkommen daraufhin untersucht, ob es diesen Negativentwicklungen etwas entgegenzusetzen hat oder sie gar umzukehren bzw. aufzulösen vermag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Zentrale Begriffe und das Ziel dieser Arbeit
- 1.1 Zentrale Begriffe
- 1.1.1 Flexibilisierung
- 1.1.2 Prekär, Prekarität, Prekarisierung
- 1.1.3 Bedingungsloses Bürgereinkommen (Grundeinkommen)
- 1.2 Ziel dieser Arbeit
- 1.1 Zentrale Begriffe
- 2 Soziale Desintegration durch marktgetriebene Flexibilisierung
- 2.1 Die Wurzel allen Übels: Marktgetriebene Flexibilisierung
- 2.2 Desintegrative Folgen - Die Spaltung der Gesellschaft
- 2.2.1 Per Gesetz zweitklassig
- 2.2.2 Finanzielle Unsicherheit, Zukunftsängste
- 2.2.3 Individualisierung und Vereinzelung
- 2.2.4 Status- und Anerkennungsverlust
- 2.3 Fazit: Gesellschaftliche Spaltung und sozialer Unfrieden
- 3 Das bedingungslose Bürgereinkommen - Sozialer Frieden oder Gesellschaftlicher Untergang?
- 3.1 Pro und Kontra
- 3.2 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die desintegrativen Folgen marktgetriebener Flexibilisierung und die potentielle Wirksamkeit des bedingungslosen Bürgereinkommens (Grundeinkommen) als Gegenmaßnahme. Der Fokus liegt auf der Analyse der gesellschaftlichen Auswirkungen von Prekarisierung und der Erörterung, ob das Grundeinkommen soziale Spaltung und Unfrieden reduzieren kann.
- Marktgetriebene Flexibilisierung und ihre Folgen
- Soziale Desintegration durch Prekarisierung
- Das bedingungslose Bürgereinkommen als sozialpolitisches Instrument
- Pro und Contra des Grundeinkommens
- Potentielle Auswirkungen des Grundeinkommens auf soziale Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den zunehmenden Anteil atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland, insbesondere im Kontext der Hartz-Reformen und der Globalisierung. Sie hebt die ökonomisch motivierte Flexibilisierung des Arbeitsmarktes hervor und kritisiert den unzureichenden Blick auf die sozialen Folgen dieser Entwicklung. Der Rückbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme und die daraus resultierende Unsicherheit werden als Bedrohung für die gesellschaftliche Stabilität dargestellt. Die Arbeit wird als Untersuchung des bedingungslosen Bürgereinkommens als mögliches Gegenmittel positioniert.
1 Zentrale Begriffe und das Ziel dieser Arbeit: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Flexibilisierung, Prekarität und das bedingungslose Bürgereinkommen. Flexibilisierung wird als Prozess beschrieben, der Arbeitgebern mehr Spielräume bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen verschafft, oft auf Kosten der sozialen Absicherung der Arbeitnehmer. Prekarität wird im Kontext von unsicheren und schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen erläutert. Das Ziel der Arbeit wird klar umrissen: die Untersuchung des Potenzials des bedingungslosen Bürgereinkommens im Hinblick auf die negativen sozialen Folgen der Prekarisierung.
2 Soziale Desintegration durch marktgetriebene Flexibilisierung: Dieses Kapitel analysiert die desintegrativen Folgen marktgetriebener Flexibilisierung. Es zeigt auf, wie die zunehmende Prekarisierung zu finanzieller Unsicherheit, Zukunftsängsten, Individualisierung und Vereinzelung sowie zu Status- und Anerkennungsverlust führt. Die gesellschaftliche Spaltung und der soziale Unfrieden werden als direkte Konsequenzen dieser Entwicklung dargestellt. Die Hartz-Reformen werden als Beispiel für eine Politik kritisiert, die die ökonomischen Aspekte priorisiert und die sozialen Folgen vernachlässigt.
Schlüsselwörter
Grundeinkommen, bedingungsloses Bürgereinkommen, Prekarisierung, Flexibilisierung, soziale Desintegration, sozialer Frieden, Markt, Arbeitsmarkt, Globalisierung, Hartz-Reformen, soziale Gerechtigkeit, Soziale Absicherung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Soziale Desintegration durch marktgetriebene Flexibilisierung und das bedingungslose Bürgereinkommen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die negativen sozialen Folgen marktgetriebener Flexibilisierung und analysiert das Potenzial des bedingungslosen Bürgereinkommens (Grundeinkommens) als mögliche Gegenmaßnahme. Der Fokus liegt auf der gesellschaftlichen Spaltung und dem sozialen Unfrieden, die durch Prekarisierung entstehen.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie Flexibilisierung (als Prozess, der Arbeitgebern mehr Gestaltungsspielraum bei Arbeitsplätzen verschafft, oft auf Kosten der Arbeitnehmer), Prekarität (unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse) und das bedingungslose Bürgereinkommen.
Welche Folgen marktgetriebener Flexibilisierung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die desintegrativen Folgen, darunter finanzielle Unsicherheit, Zukunftsängste, Individualisierung und Vereinzelung sowie Status- und Anerkennungsverlust. Die gesellschaftliche Spaltung und der soziale Unfrieden werden als direkte Konsequenzen dargestellt. Die Hartz-Reformen werden als Beispiel für eine Politik kritisiert, die ökonomische Aspekte priorisiert und soziale Folgen vernachlässigt.
Welche Rolle spielt das bedingungslose Bürgereinkommen in dieser Arbeit?
Das bedingungslose Bürgereinkommen wird als mögliches sozialpolitisches Instrument untersucht, um den negativen Folgen der Prekarisierung entgegenzuwirken und sozialen Frieden zu fördern. Die Arbeit beleuchtet die Argumente für und gegen ein Grundeinkommen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition zentraler Begriffe und Zielsetzung, ein Kapitel zur Analyse der sozialen Desintegration durch marktgetriebene Flexibilisierung und ein Kapitel zum bedingungslosen Bürgereinkommen. Sie beinhaltet außerdem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die Kernaussagen jedes Kapitels prägnant zusammen: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, Kapitel 1 definiert die zentralen Begriffe, Kapitel 2 analysiert die Folgen der Flexibilisierung und Kapitel 3 diskutiert das bedingungslose Bürgereinkommen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Grundeinkommen, bedingungsloses Bürgereinkommen, Prekarisierung, Flexibilisierung, soziale Desintegration, sozialer Frieden, Markt, Arbeitsmarkt, Globalisierung, Hartz-Reformen, soziale Gerechtigkeit und soziale Absicherung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die desintegrativen Folgen marktgetriebener Flexibilisierung aufzuzeigen und das Potenzial des bedingungslosen Bürgereinkommens als Gegenmaßnahme zu untersuchen. Sie möchte die gesellschaftlichen Auswirkungen von Prekarisierung analysieren und erörtern, ob das Grundeinkommen soziale Spaltung und Unfrieden reduzieren kann.
- Citation du texte
- Jan Kietzmann (Auteur), 2009, Grundeinkommen und sozialer Frieden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146111