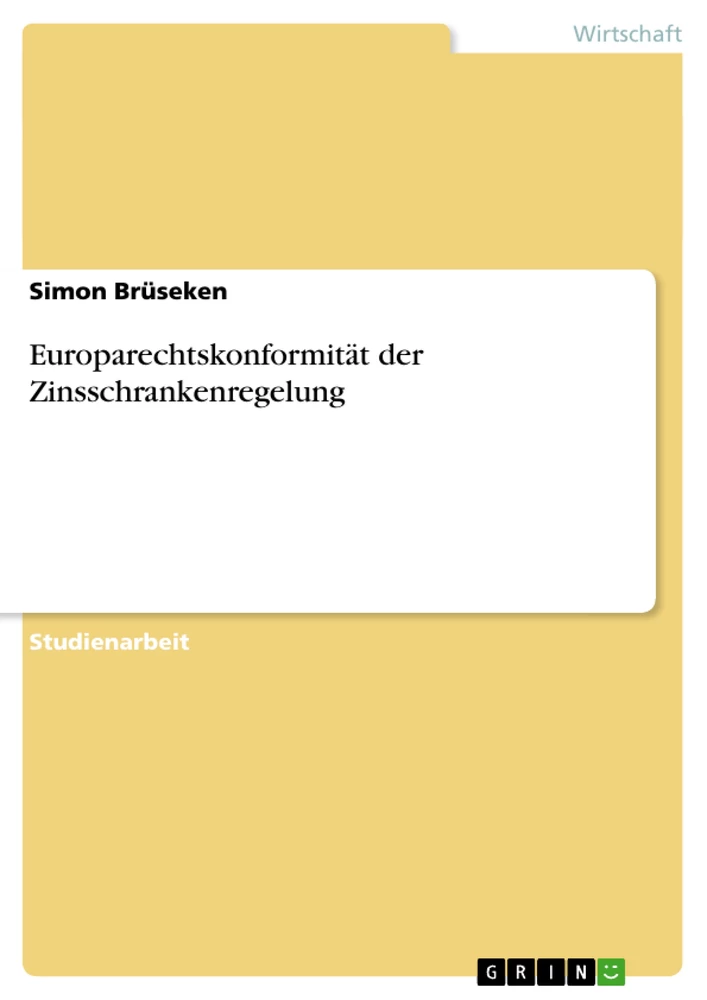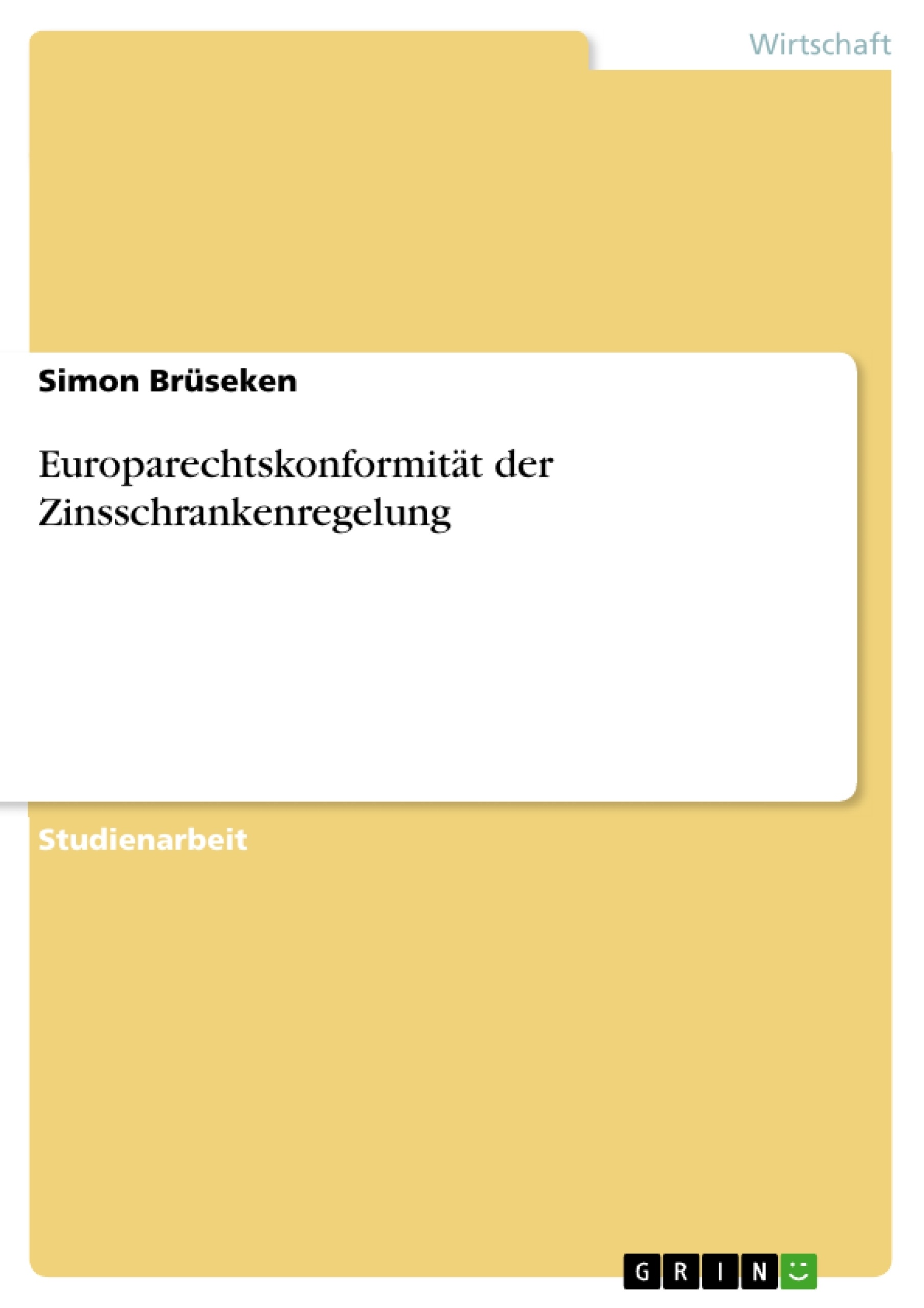Die Arbeit beschäftigen sich mit einer der im Rahmen der Unternehmensteuerreform eingeführten Maßnahmen zur Gegenfinanzierung und Missbrauchsbekämpfung, namentlich der Zinsschrankenregelung der §§ 4h EStG, 8a KStG, durch die die steuerliche Abzugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen massiv eingeschränkt wurde. Neben systematischen und verfassungsrechtlichen lässt die Zinsschranke insbesondere europarechtliche Bedenken aufkommen und muss sich an den Grundfreiheiten messen lassen. Wie sich zeigt, stellt die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes der Konzernklausel durch Bildung einer Organschaft eine verdeckte Diskriminierung dar. Die Diskussion möglicher Rechtfertigungsgründe ergab, dass der Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit weder durch die Kohärenz des Steuersystems, noch durch das Territorialitätsprinzip oder die Missbrauchsbekämpfung zu rechtfertigen ist. Letzteres stellt sich zwar als ein anerkannter „zwingender Grund des Allgemeininteresses“ dar, es fehlt im konkreten Fall der Zinsschranke aber an der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zinsschrankenregelung der §§ 4h EStG, 8a KStG
- 2.1 Grundtatbestand
- 2.2 Ausnahmetatbestände
- 2.2.1 Freigrenze
- 2.2.2 Konzernklausel
- 2.2.3 Escape-Klausel
- 3. Europarechtliche Grundlagen
- 3.1 Gemeinsamer Markt und Binnenmarkt
- 3.2 Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot sowie Rechtfertigung
- 4. Europarechtskonformität der Zinsschrankenregelung
- 4.1 Betriebsfiktion gem. § 15 S. 1 Nr. 3 KStG
- 4.2 Exkurs: Organschaften im deutschen Steuerrecht
- 4.3 Diskriminierungsvorwurf: Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit
- 4.4 Mögliche Rechtfertigung
- 4.4.1 Kohärenz des Steuersystems
- 4.4.2 Territorialitätsprinzip
- 4.4.3 Missbrauchsbekämpfung
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die europarechtliche Konformität der Zinsschrankenregelung der §§ 4h EStG, 8a KStG, die im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 eingeführt wurde. Sie untersucht, ob diese Regelung mit den Grundfreiheiten des Europäischen Binnenmarkts vereinbar ist, insbesondere mit der Niederlassungsfreiheit.
- Die Zinsschrankenregelung im Detail
- Relevante europarechtliche Grundlagen
- Mögliche Diskriminierung durch die Zinsschrankenregelung
- Rechtfertigungsgründe für die Regelung
- Zusammenfassende Bewertung der Europarechtskonformität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zinsschrankenregelung und ihre Bedeutung im Kontext der Unternehmensteuerreform 2008 einführt. Das zweite Kapitel erläutert den Regelungsmechanismus der Zinsschrankenregelung, indem es den Grundtatbestand und die Ausnahmetatbestände (Freigrenze, Konzernklausel und Escape-Klausel) detailliert beschreibt.
Kapitel 3 befasst sich mit den europarechtlichen Grundlagen der Zinsschrankenregelung, insbesondere mit den Konzepten des Gemeinsamen Marktes und des Binnenmarktes. Des Weiteren wird ein Überblick über die Grundfreiheiten gegeben, wobei das Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot sowie die Möglichkeiten der Rechtfertigung im Vordergrund stehen.
Im vierten Kapitel wird die Europarechtskonformität der Zinsschrankenregelung im Detail beleuchtet. Dabei werden insbesondere die möglichen Auswirkungen der Organschaftsbildung auf die Anwendung der Zinsschrankenregelung und der damit verbundene Diskriminierungsvorwurf im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit untersucht. Außerdem werden mögliche Rechtfertigungsgründe für die Zinsschrankenregelung wie Kohärenz des Steuersystems, Territorialitätsprinzip und Missbrauchsbekämpfung analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Zinsschrankenregelung, Europarecht, Grundfreiheiten, Niederlassungsfreiheit, Diskriminierung, Rechtfertigung, Organschaft, Unternehmensteuerreform, Steuermissbrauch und Kohärenz des Steuersystems.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt die Zinsschranke im deutschen Steuerrecht?
Die Zinsschranke (§§ 4h EStG, 8a KStG) schränkt die steuerliche Abzugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen ein, um Gewinnverschiebungen ins Ausland zu verhindern.
Welche Ausnahmetatbestände gibt es bei der Zinsschranke?
Es gibt drei wesentliche Ausnahmen: die Freigrenze (bis 3 Mio. Euro), die Konzernklausel und die Escape-Klausel (Eigenkapitalvergleich).
Warum gibt es europarechtliche Bedenken gegen diese Regelung?
Es besteht der Verdacht einer verdeckten Diskriminierung, die gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, insbesondere im Zusammenhang mit der Bildung von Organschaften.
Kann die Zinsschranke durch „Missbrauchsbekämpfung“ gerechtfertigt werden?
Obwohl Missbrauchsbekämpfung ein legitimer Grund ist, kommt die Arbeit zu dem Schluss, dass die Regelung in ihrer konkreten Ausgestaltung oft nicht verhältnismäßig ist.
Was ist das Territorialitätsprinzip in diesem Kontext?
Es ist ein Argument zur Rechtfertigung von Steuergesetzen, das besagt, dass ein Staat nur Einkünfte besteuern kann, die auf seinem Staatsgebiet erwirtschaftet wurden – im Fall der Zinsschranke reicht dies jedoch oft nicht zur Rechtfertigung eines Verstoßes gegen die Grundfreiheiten aus.
- Citation du texte
- Simon Brüseken (Auteur), 2008, Europarechtskonformität der Zinsschrankenregelung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146145