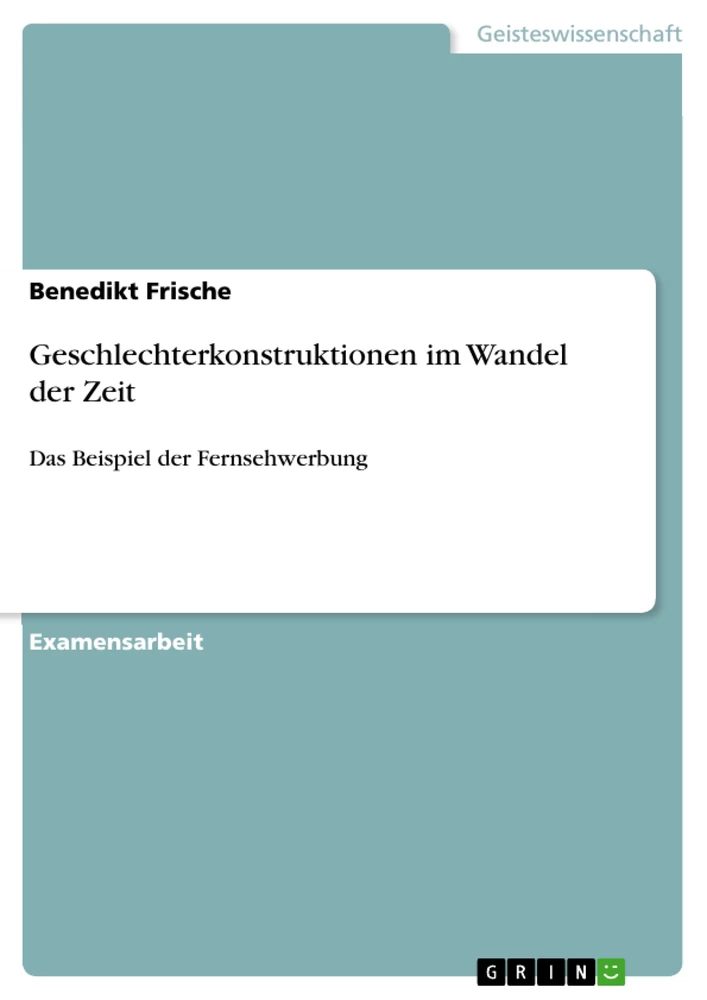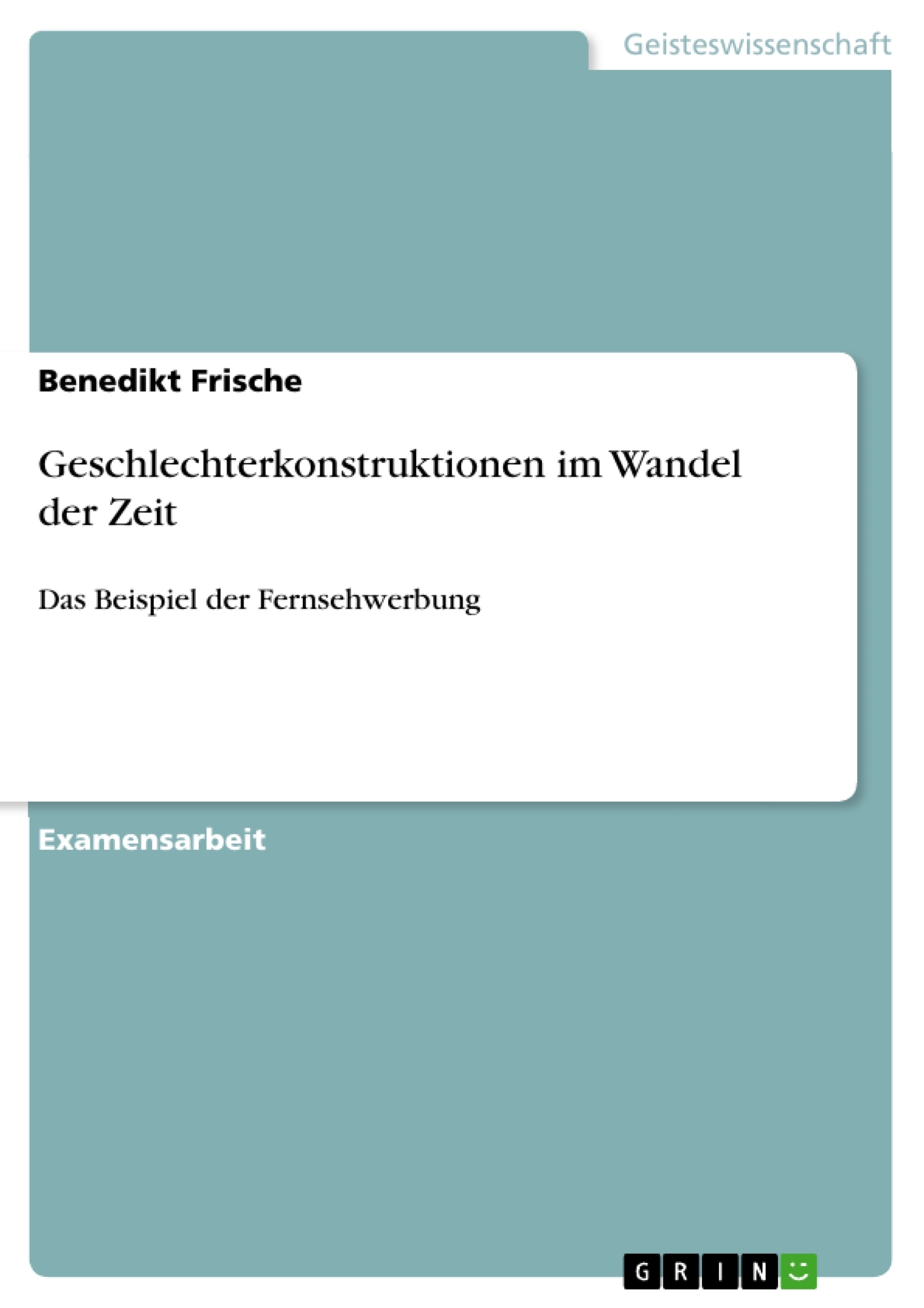„Hinter der Werbung steht vielfach die Überlegung, dass jeder Mensch eigentlich zwei sind: einer, der er ist, und einer, der er sein will.”
(William Feather )
Dieses Zitat des amerikanischen Werbefachmanns William Feather macht die Einstellung der Menschen gegenüber der Werbung deutlich: Die Werbung zeigt uns das, was wir sehen wollen beziehungsweise das, was wir gerne wären. Um dies zu erreichen, werden viele verschiedene Medien verwendet; seien es stilistische Mittel, wie Ironie oder Sarkasmus, musikalische Untermalungen, bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen oder simples Klischeedenken der Bürgerinnen und Bürger.
In der heutigen Zeit kommt man nicht mehr an der Werbung vorbei, denn sie ist überall und jeder wird mit ihr konfrontiert. Sei es in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio, Kino, Internet oder Fernsehen. Die Werbeindustrie bedient sich an den geschaffenen Klischees und Stereotypen, die sie teilweise auch in ihren Slogans definieren. So heißt es zum Beispiel: „Für das Beste im Mann“ (Gillette), „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“ (Bauknecht), „Der Duft, der Frauen provoziert“ (Axe) oder „Weil Männer keine Frauen sind“ (DMAX). Doch welchen Einfluss haben diese geschaffenen Stereotype auf den realistischen Wandel der Geschlechterkonstruktionen?
Um genau dieses Thema handelt es sich in meiner Examensarbeit:
„Der Wandel der Geschlechterkonstruktionen: Das Beispiel der Fernsehwerbung“
Innerhalb dieser Arbeit möchte ich mehreren Fragen nachgehen, die eng mit dieser Thematisierung verbunden sind:
o Welche Klischees und Stereotypen wurden seit den 50er Jahren in der deutschen TV-Werbung bedient?
o Wie wurde das Geschlecht mit Hilfe dieses Medium konstruiert?
o Was versteht man unter einer Geschlechterrolle bzw. einer Geschlechterkonstruktion?
o In welchem Verhältnis stehen diese beiden zueinander und wie haben sie sich im Laufe der letzten 60 Jahre gewandelt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Werbung
- 2.1. Funktionen und Ziele der Werbung
- 2.1.1. Definition
- 2.1.2. Funktionen
- 2.1.3. Ziele
- 2.2. Werbearten
- 2.2.1. Werbung in Zeitungen
- 2.2.2. Werbung per Post
- 2.2.3. Werbung in Anzeigeblättern
- 2.2.4. Außenwerbung
- 2.2.5. Werbung im Radio
- 2.2.6. Werbung im Kino
- 2.2.7. Onlinewerbung
- 2.3. Fernsehwerbung
- 2.3.1. Historischer Abriss
- 2.3.2. Aufbau eines Werbespots
- 2.3.3. Vor- und Nachteile von Fernsehwerbung
- 3. Geschlechterkonstruktion
- 3.1. Definition Geschlechterrolle / -differenzierung
- 3.2. Konstruktion von Geschlecht
- 3.2.1. Soziale Konstruktion
- 3.2.2. Symbolische Konstruktion
- 3.3. Geschlechterbilder im Wandel
- 4. Bemerkungen zum Analyseteil
- 4.1. Grundlagen
- 4.2. Aufbau und Herangehensweise
- 5. Geschlechterbilder in der Werbung
- 5.1. Geschlechterbilder in den 50er Jahren
- 5.1.1. Drei Glocken (Frauenbilder)
- 5.1.2. Coca-Cola (Männerbilder)
- 5.1.3. Zusammenfassung
- 5.2. Geschlechterbilder in den 60er Jahren
- 5.2.1. Dr. Oetker (Frauenbilder)
- 5.2.2. Miele (Männerbilder)
- 5.2.3. Zusammenfassung
- 5.3. Geschlechterbilder in den 70er Jahren
- 5.3.1. Palmolive (Frauenbilder)
- 5.3.2. Persil (Männerbilder)
- 5.3.3. Zusammenfassung
- 5.4. Geschlechterbilder in den 80er Jahren
- 5.4.1. Clearasil (Frauenbilder)
- 5.4.2. Kinderschokolade (Männerbilder)
- 5.4.3. Zusammenfassung
- 5.5. Geschlechterbilder in den 90er Jahren
- 5.5.1. bebe young care (Frauenbilder)
- 5.5.2. Nimm2 (Männerbilder)
- 5.5.3. Zusammenfassung
- 5.6. Geschlechterbilder in den 2000er Jahren
- 5.6.1. Vorwerk (Frauenbilder)
- 5.6.2. Melitta (Männerbilder)
- 5.6.3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Geschlechterkonstruktionen anhand von Beispielen aus der deutschen Fernsehwerbung seit den 1950er Jahren. Die zentrale Frage ist, wie sich Klischees und Stereotype in der Werbung widerspiegelten und wie das Geschlecht durch dieses Medium konstruiert wurde. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Geschlechterrollen, Geschlechterkonstruktionen (sowohl sozialer als auch symbolischer Natur) und deren Entwicklung über die Jahrzehnte.
- Analyse der Klischees und Stereotype in der deutschen Fernsehwerbung verschiedener Jahrzehnte.
- Untersuchung der Konstruktion von Geschlecht in der Werbung.
- Differenzierung zwischen Geschlechterrollen und Geschlechterkonstruktionen.
- Beschreibung des Wandels der Geschlechterbilder im 20. und frühen 21. Jahrhundert.
- Beziehung zwischen den dargestellten Geschlechterbildern und der gesellschaftlichen Entwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterkonstruktionen in der Fernsehwerbung ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Wandel dieser Konstruktionen und den dabei verwendeten Klischees und Stereotypen in den Fokus. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die Methodik der Analyse.
2. Werbung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Funktionen, Ziele und Arten von Werbung. Es werden verschiedene Werbeformen vorgestellt und die spezifische Rolle der Fernsehwerbung herausgestellt. Ein historischer Abriss der Fernsehwerbung sowie der Aufbau und die Vor- und Nachteile von Werbespots werden diskutiert. Dies bildet die Grundlage für das Verständnis des Kontextes, in dem die Geschlechterkonstruktionen analysiert werden.
3. Geschlechterkonstruktion: Das Kapitel definiert die Begriffe Geschlechterrolle und Geschlechterdifferenzierung und unterscheidet zwischen sozialer und symbolischer Konstruktion von Geschlecht. Es beschreibt den Wandel der Geschlechterbilder im Laufe des 20. Jahrhunderts, um einen Vergleichsrahmen für die spätere Analyse der Werbespots zu schaffen. Die Diskussion über die verschiedenen Konstruktionsansätze legt den theoretischen Rahmen für die Analyse der Fernsehwerbung fest.
4. Bemerkungen zum Analyseteil: Dieser Abschnitt beschreibt die Methodik der Analyse der Werbespots. Es werden die Grundlagen und die Vorgehensweise detailliert dargelegt, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyse zu gewährleisten. Die detaillierte Erklärung der methodischen Vorgehensweise sorgt für die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.
5. Geschlechterbilder in der Werbung: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse der Geschlechterdarstellungen in der deutschen Fernsehwerbung der 50er bis 2000er Jahre. Für jedes Jahrzehnt werden ausgewählte Werbespots (mit Beispielen wie Drei Glocken, Coca-Cola, Dr. Oetker, Miele, Palmolive, Persil, Clearasil, Kinderschokolade, bebe young care, Nimm2, Vorwerk und Melitta) analysiert und die jeweiligen Geschlechterbilder kritisch beleuchtet. Die Zusammenfassung jedes Jahrzehnts fasst die zentralen Beobachtungen zusammen und stellt Veränderungen und Kontinuitäten heraus. Die Analyse zeigt die Entwicklung der Geschlechterrollen und -stereotype in der Werbung auf.
Schlüsselwörter
Geschlechterkonstruktion, Fernsehwerbung, Geschlechterrollen, Stereotype, Klischees, Werbung, Sozialisation, Symbolische Konstruktion, Geschlechterbilder, Wandel, Deutschland, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Medienanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechterkonstruktionen in der deutschen Fernsehwerbung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wandel von Geschlechterkonstruktionen in der deutschen Fernsehwerbung vom Jahr 1950 bis in die 2000er Jahre. Sie untersucht, wie Geschlechterklischees und -stereotype in der Werbung dargestellt wurden und wie Geschlecht durch dieses Medium konstruiert wurde. Im Fokus steht die Beziehung zwischen Geschlechterrollen, Geschlechterkonstruktionen (sozial und symbolisch) und deren Entwicklung über die Jahrzehnte.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie haben sich Klischees und Stereotype in der Werbung im Laufe der Zeit verändert und wie wurde Geschlecht in diesem Medium konstruiert? Zusätzlich wird untersucht, wie sich Geschlechterrollen und Geschlechterkonstruktionen unterscheiden und wie sich die dargestellten Geschlechterbilder mit der gesellschaftlichen Entwicklung verbinden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 ist die Einleitung, welche die Thematik und die Forschungsfrage einführt. Kapitel 2 gibt einen Überblick über Werbung, inklusive Funktionen, Ziele und Arten. Kapitel 3 definiert Geschlechterrollen und Geschlechterkonstruktionen und beschreibt deren Wandel. Kapitel 4 erläutert die Methodik der Analyse. Kapitel 5 analysiert detailliert Geschlechterbilder in der Werbung der 50er bis 2000er Jahre anhand ausgewählter Werbespots.
Welche Werbebeispiele werden analysiert?
Die Analyse in Kapitel 5 umfasst diverse bekannte Werbespots aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter Drei Glocken, Coca-Cola, Dr. Oetker, Miele, Palmolive, Persil, Clearasil, Kinderschokolade, bebe young care, Nimm2, Vorwerk und Melitta. Diese Beispiele werden jeweils nach Jahrzehnten gruppiert und hinsichtlich der Darstellung von Geschlechterrollen und -stereotypen untersucht.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Kapitel 4 beschreibt detailliert die Methodik der Analyse der Werbespots. Die Vorgehensweise wird transparent und nachvollziehbar dargestellt, um die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Geschlechterkonstruktion, Fernsehwerbung, Geschlechterrollen, Stereotype, Klischees, Werbung, Sozialisation, Symbolische Konstruktion, Geschlechterbilder, Wandel, Deutschland, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert und Medienanalyse.
Welche Zusammenfassung der Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Entwicklung der Geschlechterrollen und -stereotype in der Werbung über mehrere Jahrzehnte auf. Jedes Jahrzehnt wird mit einer Zusammenfassung der zentralen Beobachtungen abgeschlossen, wobei Veränderungen und Kontinuitäten hervorgehoben werden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will den Wandel von Geschlechterkonstruktionen in der deutschen Fernsehwerbung anhand von konkreten Beispielen nachweisen und analysieren. Sie beleuchtet, wie Klischees und Stereotype in der Werbung zum Ausdruck kamen und wie das Geschlecht durch dieses Medium konstruiert wurde. Sie soll somit ein Verständnis für die Entwicklung von Geschlechterrollen und -bildern im Kontext der Medienlandschaft schaffen.
- Arbeit zitieren
- Benedikt Frische (Autor:in), 2010, Geschlechterkonstruktionen im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146203