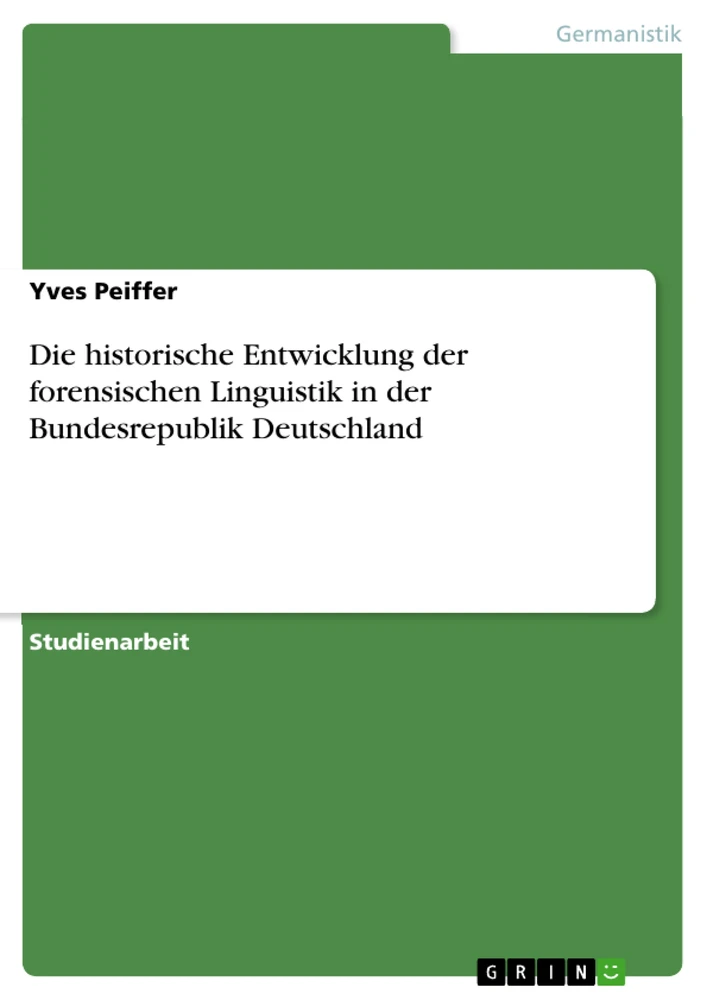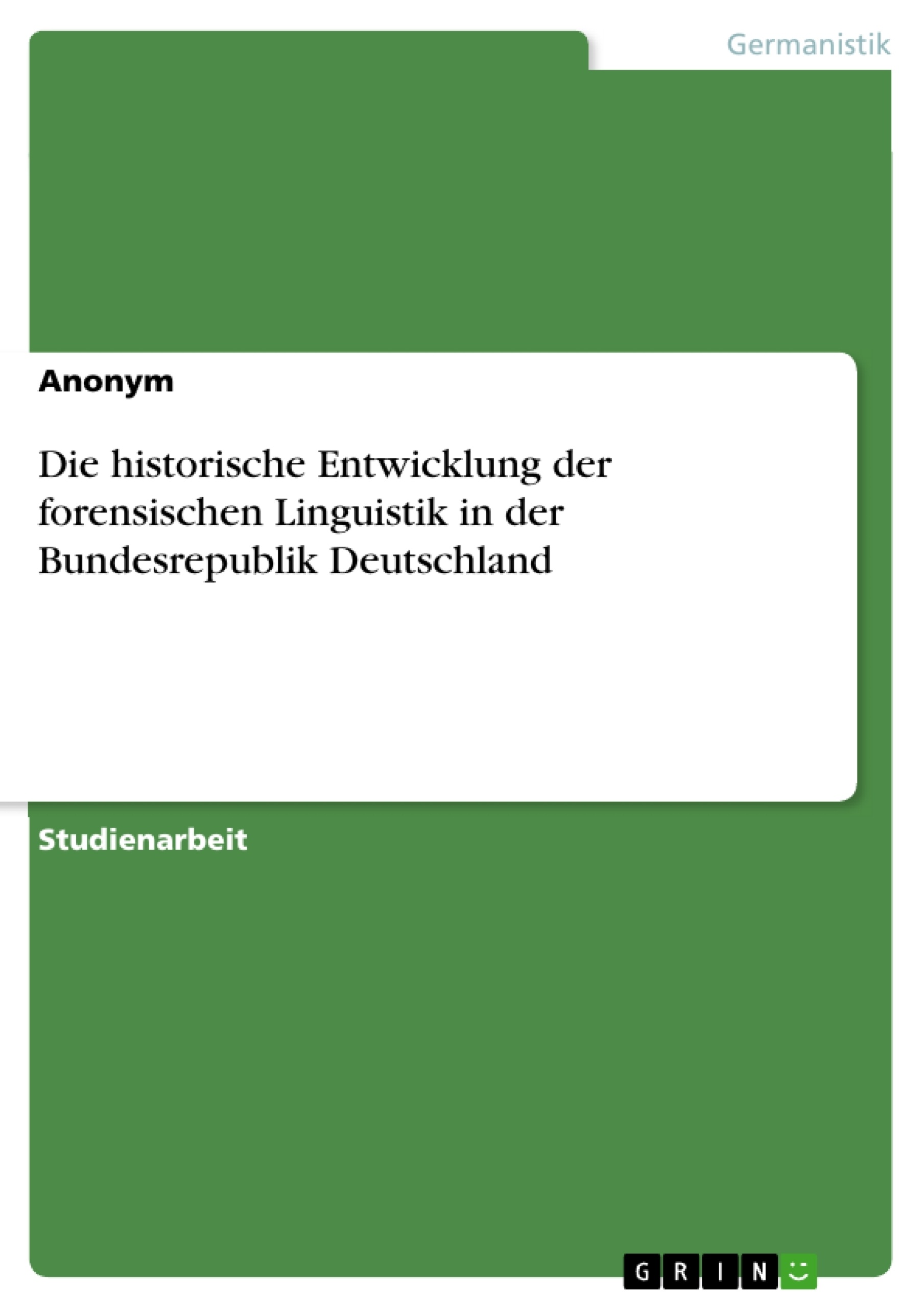Die forensische Linguistik ist in der breiten Öffentlichkeit weit weniger bekannt bei Kriminalfällen als z.B. die Gerichtsmedizin oder die forensische Ballistik. Doch trotzdem spielte sie bei vielen Fällen in der Kriminalgeschichte in Deutschland eine herausragende Rolle. Schriftliche Bekennerschreiben sind das Aushängeschild von terroristischen Vereinigungen. Erpressungen werden in vielen Fällen nur schriftlich mitgeteilt. Jeden Tag werden in Deutschland Drohungen, Beleidigungen und sogar Erpressungen in schriftlicher Form übermittelt. Besonders in Fällen wo es keine Zeugen, DNA-Spuren oder Fingerabdrücke gibt, kann die forensische Linguistik helfen den Täter zu fassen. In dieser Arbeit wird anhand von einigen Beispielen die Entwicklung dieses Fachgebiets in Deutschland beschrieben. Die öffentliche Wahrnehmung und die Reaktionen der einzelnen Akteure stehen dabei im Vordergrund. Es soll die Frage beantwortet werden welchen Schwierigkeiten sich die forensische Linguistik ausgesetzt war. Welche Vorteile sie bietet, aber auch welche Risiken und Schwächen sich gezeigt haben. Als ein Teilgebiet der angewandten Linguistik entwickelte sie sich seit den 1950er Jahren von einer Randerscheinung zu einem festen Bestandteil kriminaltechnischer Untersuchung. Die ersten großen Anwendungen in Deutschland beginnen mit den Terroraktionen der Roten Armee Fraktion in den 1970er Jahren, wo die Bekennerschreiben eine große Rolle in den Aktivitäten dieser terroristischen Vereinigung spielten. Daher wird im zweiten Teil dieser Arbeit auf die Sprache der RAF, unter linguistischen Betrachtungen, eingegangen. Die Sprache von Terroristen als Sondersprache, die Rückschlüsse auf Ideologie, Autorenschaft und Motive gibt. Es wird ebenso der aktuelle Stand der Forschung in Deutschland beschrieben und somit können die früheren Fälle mit der heutigen Vorgehensweise verglichen werden. Aber auch die Risiken der heutigen technischen Möglichkeiten werden erwähnt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die historische Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland
- 2.1 Die Ursprünge
- 2.2 Der Entführungsfall Richard Oetker
- 2.3 Der Fall Uwe Barschel
- 2.4 Das Symposium des BKA
- 3. Aktueller Forschungsstand
- 4. Die Sprache der RAF
- 4.1 Vorbemerkung
- 4.2 Das Bekennerschreiben des Attentats auf das Springer-Hochhaus
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland, wobei der Fokus auf der öffentlichen Wahrnehmung und den Reaktionen der Akteure liegt. Es werden die Schwierigkeiten, Vorteile, Risiken und Schwächen des Fachgebiets beleuchtet. Die Arbeit analysiert anhand konkreter Fälle, wie sich die forensische Linguistik von einer Randerscheinung zu einem festen Bestandteil kriminaltechnischer Untersuchungen entwickelte.
- Historische Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland
- Anwendung der forensischen Linguistik in bekannten Kriminalfällen
- Öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz der forensischen Linguistik
- Herausforderungen und Grenzen der forensischen Linguistik
- Linguistische Analyse von RAF-Bekennschreiben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der forensischen Linguistik ein und betont deren Bedeutung bei der Aufklärung von Kriminalfällen, insbesondere dort, wo andere Beweismittel fehlen. Sie hebt die Rolle schriftlicher Dokumente wie Bekennerschreiben und Drohbriefe hervor und kündigt die Untersuchung der historischen Entwicklung und der Anwendung der forensischen Linguistik in Deutschland an, mit besonderem Fokus auf die öffentliche Wahrnehmung und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse konkreter Fälle und der Beantwortung der Frage nach den Schwierigkeiten, Vorteilen, Risiken und Schwächen des Fachgebiets.
2. Die historische Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland, beginnend mit den frühen Anwendungen in den 1950er Jahren im Bereich des Marken- und Wettbewerbsrechts am sprachwissenschaftlichen Institut der Universität Bonn. Es beschreibt die zunehmende Bedeutung der forensischen Linguistik im Kontext des RAF-Terrors in den 1970er Jahren, wo die Analyse von Bekennerschreiben eine zentrale Rolle spielte. Das Kapitel beleuchtet die anfänglichen Herausforderungen und die kritische Auseinandersetzung mit der Zuverlässigkeit linguistischer Gutachten im Vergleich zu exakteren Naturwissenschaften. Es wird die Methode der forensischen Linguistik mit der forensischen Psychiatrie verglichen, wobei betont wird, dass sie primär keine Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Autors zulässt. Die Gründung der forensischen Linguistik in Deutschland durch Dietrich Jöns und Hannes Kniffka wird erwähnt, sowie deren Beteiligung an wichtigen Fällen.
2.1 Die Ursprünge: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Anfängen der forensischen Linguistik, beginnend mit der Prägung des Begriffs durch Jan Svartvik und dessen Anwendung im Fall eines zu Unrecht verurteilten Mannes. Er beschreibt die frühen linguistischen Untersuchungen in Rechtsfragen in Deutschland ab den 1950er Jahren und die erste offizielle Einbindung von Linguisten in deutsche Ermittlungsbehörden in den 1970er Jahren, im Kontext des RAF-Terrors. Die anfängliche Fokussierung auf Schriftvergleichungen und die allmähliche Entdeckung linguistischer Zusammenhänge werden detailliert dargestellt. Der Abschnitt betont die anhaltende Kritik an der forensischen Linguistik und deren Herausforderungen bezüglich Präzision und Zuverlässigkeit, gleichzeitig aber deren wichtige Rolle bei der Eingrenzung des Täterkreises.
2.2 Der Entführungsfall Richard Oetker: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Entführungsfall Richard Oetker aus dem Jahr 1976 und dessen Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung der forensischen Linguistik in Deutschland. Er beschreibt den Prozess von 1980, der sich primär auf Indizienbeweise stützte, da es keine Zeugen gab. Die unterschiedlichen linguistischen Gutachten und deren Bewertung durch das Gericht werden analysiert, wobei die Herausforderungen der forensischen Linguistik aufgrund unzureichender Datenmengen und der damaligen Forschungslage hervorgehoben werden. Der Abschnitt erläutert die von Gericht berücksichtigten Merkmale, wie die dialektale Prägung der Schreiben, und betont die Bedeutung dieses Falles für die Entwicklung und Akzeptanz der forensischen Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Forensische Linguistik in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland. Sie analysiert die öffentliche Wahrnehmung und die Reaktionen der Akteure, beleuchtet Schwierigkeiten, Vorteile, Risiken und Schwächen des Fachgebiets und untersucht anhand konkreter Fälle die Entwicklung der forensischen Linguistik von einer Randerscheinung zu einem festen Bestandteil kriminaltechnischer Untersuchungen.
Welche Fälle werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem den Entführungsfall Richard Oetker (1976) und den Fall Uwe Barschel. Ein besonderer Fokus liegt auf der linguistischen Analyse von Bekennerschreiben der Rote Armee Fraktion (RAF), insbesondere des Schreibens zum Attentat auf das Springer-Hochhaus.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland, die Anwendung in bekannten Kriminalfällen, die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz, Herausforderungen und Grenzen des Fachgebiets sowie die linguistische Analyse von RAF-Bekennschreiben. Der Fokus liegt auf der Rolle schriftlicher Dokumente wie Bekennerschreiben und Drohbriefe.
Wie wird die historische Entwicklung der forensischen Linguistik dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung von den Anfängen in den 1950er Jahren (u.a. im Marken- und Wettbewerbsrecht) über die zunehmende Bedeutung im Kontext des RAF-Terrors in den 1970er Jahren bis hin zum aktuellen Forschungsstand. Sie thematisiert die anfänglichen Herausforderungen, die kritische Auseinandersetzung mit der Zuverlässigkeit linguistischer Gutachten und den Vergleich mit anderen forensischen Methoden wie der forensischen Psychiatrie.
Welche Rolle spielt die öffentliche Wahrnehmung?
Die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz der forensischen Linguistik wird als wichtiger Aspekt der Arbeit betrachtet. Die Arbeit analysiert, wie die öffentliche Meinung und die Reaktionen von Akteuren die Entwicklung und Anwendung der forensischen Linguistik beeinflusst haben.
Welche Herausforderungen und Grenzen der forensischen Linguistik werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten, Vorteile, Risiken und Schwächen der forensischen Linguistik. Dies beinhaltet die Diskussion über die Präzision und Zuverlässigkeit linguistischer Gutachten im Vergleich zu exakteren Naturwissenschaften und die Herausforderungen durch unzureichende Datenmengen, wie im Fall Oetker deutlich wird.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung der forensischen Linguistik in Deutschland (mit Unterkapiteln zu den Ursprüngen, dem Fall Oetker, dem Fall Barschel und dem BKA-Symposium), ein Kapitel zum aktuellen Forschungsstand, ein Kapitel zur Sprache der RAF, und eine Schlussbemerkung.
Wie wird die Sprache der RAF untersucht?
Die Arbeit analysiert die Sprache der RAF anhand von Beispielen wie dem Bekennerschreiben zum Attentat auf das Springer-Hochhaus. Die Analyse fokussiert sich auf linguistische Merkmale der Texte.
Wer sind die wichtigsten Personen, die in der Arbeit erwähnt werden?
Die Arbeit erwähnt unter anderem Dietrich Jöns und Hannes Kniffka als Gründer der forensischen Linguistik in Deutschland sowie Jan Svartvik im Zusammenhang mit der frühen Entwicklung des Gebiets.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse von Dokumenten, Gerichtsakten und der Literatur basiert. Die linguistische Analyse von Texten spielt eine zentrale Rolle.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die historische Entwicklung der forensischen Linguistik in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1465997