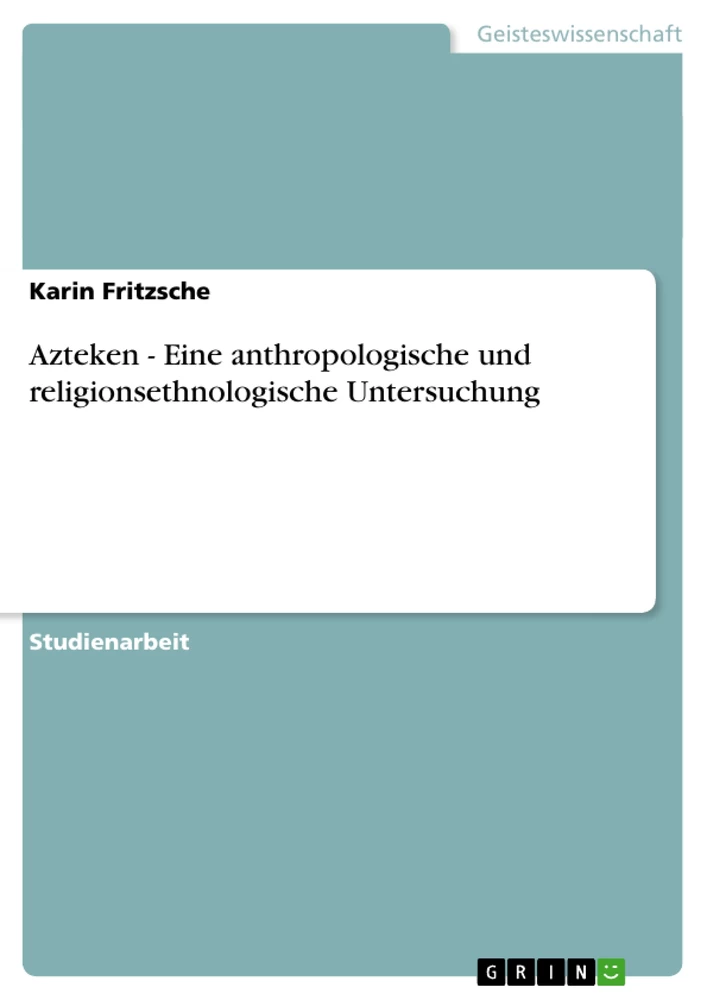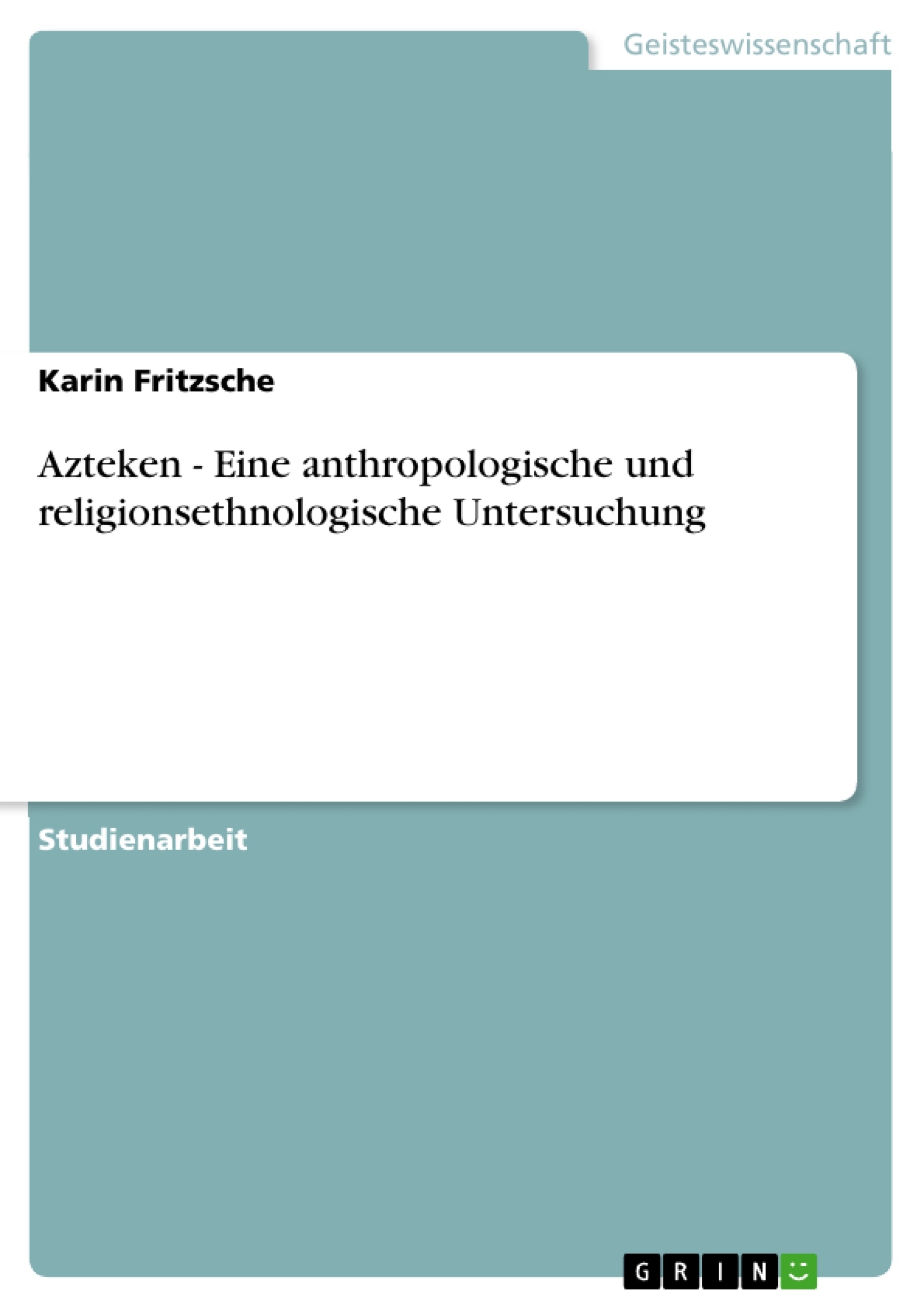Der Mensch ist ein „zweibeiniges Tier ohne Federn“ und „ vernunftbegabt“. Er ist „Ebenbild Gottes“, auch ein „kleiner Gott“. Das menschliche Wesen ist ein „Tier, das sich selbst vervollkommnen kann“, denn es ist „das Wesen, welches will“.
(Quelle: www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/anthro/anthrop3.htm)
Die oberen Aussagen aus verschiedenen Jahrhunderten stammen von Philosophen und Dichtern Europas: Platon, Aristoteles, Augustinus, Leibniz, Kant, Schiller. Auch wenn sie die unterschiedlichsten Epochen europäischer Kultur repräsentieren, haben sie eines gemeinsam: Sie zeigen, dass sich der Mensch seiner Sonderstellung in der Welt bewusst ist. Warum? Hat der Mensch eine besondere Aufgabe und deshalb besondere Fähigkeiten? Ist es ihm vorbestimmt, andere Lebewesen zu regieren, wie es in der Bibel steht?
Warum ist der Mensch, wie er ist? Warum ist er überhaupt? Diese Fragen bewegen die Menschen unseres Erdteiles schon lange.
Mein Interesse für die alten Kulturen Amerikas bewegte mich zu erforschen, wie z.B. mesoamerikanische Hochkulturen, wie die Azteken, ihre Welt und sich selbst sahen. Die Suche nach geeignetem Material führte mich zu der Erkenntnis, dass uns die Azteken selbst kaum verwertbares Material hinterlassen haben. Wenige Geistliche und Mexikopioniere haben versucht, bald nach der Eroberung Gebräuche, Kulthandlungen und Mythen von den überlebenden Mexica selbst aufzunehmen. Vor allem Bernardino de Sahagun, Bernal Diaz del Castillo und Fray Diego Duran hinterließen Aufzeichnungen, die ein reales Bild der indianischen Lebensweise und Weltsicht entstehen lassen. Meine Überlegungen stützen sich vor allem auf ihre Berichte und die von ihnen notierten Legenden.
Auf der einen Seite registriert der Rezipient große Fertigkeiten in der Baukunst, Tempel so groß wie die Cheops- Pyramide, ein durchdachtes Kalenderwesen; andererseits wird von der Schlachtung vieler Opfer berichtet, die nur Unverständnis hervorruft.
Wie entsteht ein solch widersprüchliches Bild von den alten Mexica? Welchen Wert hatte ein Menschenleben für sie? Welches Weltbild/ Götterbild/ Menschenbild leitete sie?
Diese Fragen werde ich versuchen zu beantworten, indem ich auch naturwissenschaftliche sowie kultur- und sozialanthropologische Aspekte einbeziehe.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemfindung
- 2 Herkunft der Azteken
- 2.1 Wissenschaftliche Recherche
- 2.2 Mythologie
- 3 Der Mensch im Aztekenreich
- 3.1 Soziale Ordnung
- 3.2 Religion
- 3.2.1 Mensch- Natur- Götter
- 3.2.2 Huitzilopochtli und der Krieg
- 3.2.3 Schicksalhaftigkeit und Jenseitsvorstellungen
- 4 Gesamteindruck und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Bild vom Menschenbild der Azteken zu vermitteln, indem die Herkunft des Volkes, seine soziale Ordnung und seine religiösen Vorstellungen beleuchtet werden. Die Arbeit untersucht die Widersprüchlichkeiten im Bild der Azteken, das durch brutale Opferzeremonien einerseits und beeindruckende Baukunst und ein komplexes Kalendersystem andererseits geprägt ist.
- Die Herkunft der Azteken und ihre Wanderung
- Die soziale Ordnung im Aztekenreich
- Die Religion der Azteken und ihre zentrale Rolle im Leben
- Das aztekische Menschenbild und der Wert des menschlichen Lebens
- Die Widersprüchlichkeiten im Bild der Azteken und ihre Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemfindung: Der einleitende Abschnitt reflektiert über verschiedene philosophische Menschenbilder aus der europäischen Tradition und kontrastiert diese mit dem Ziel, die aztekische Sichtweise zu untersuchen. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit, sich mit dem komplexen und widersprüchlichen Bild der Azteken auseinanderzusetzen, das durch Berichte von brutalen Opferritualen einerseits und beeindruckenden kulturellen Leistungen andererseits geprägt ist. Die Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens im aztekischen Kontext und das Verständnis ihrer Welt- und Götterbilder werden als zentrale Fragestellungen formuliert. Der Fokus liegt auf der Analyse vorhandener Quellen und ihrer Interpretation, insbesondere der Berichte von Bernardino de Sahagun, Bernal Diaz del Castillo und Fray Diego Duran.
2 Herkunft der Azteken: Dieses Kapitel beschreibt die lange Wanderung der Mexica/Chichimeken aus ihrem Ursprungsort, möglicherweise Aztlan, bis zur Gründung ihrer Hauptstadt Tenochtitlan. Die Wanderung wird als eine Phase von kriegerischen Auseinandersetzungen dargestellt, die durch das anmaßende Verhalten der Mexica selbst oft verursacht wurden. Ein besonders drastisches Beispiel ist die Opferung der Braut des Königs von Colhuacan. Die Bedeutung der Übernahme von Kultur- und religiösen Elementen der Tolteken wird hervorgehoben, und es wird auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten während der Wanderung eingegangen. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Ausdehnung des aztekischen Staates in seiner Blütezeit und der Beschreibung von Tenochtitlan als kosmopolitische Weltstadt mit einer komplexen sozialen Struktur. Es wird auch auf die Manipulation der aztekischen Geschichte durch Itzcoatl eingegangen, welche die historische Darstellung verfälschte und für eine ideologische Rechtfertigung der aztekischen Herrschaft diente.
Schlüsselwörter
Azteken, Mexica, Tenochtitlan, Aztlan, Huitzilopochtli, Opferrituale, soziale Ordnung, Religion, Menschenbild, Weltbild, anthropologische Forschung, archäologische Forschung, Kriegerkultur, Hochkultur Mesoamerikas.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Azteken - Menschenbild und Gesellschaft
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Menschenbild der Azteken umfassend. Sie beleuchtet die Herkunft des Volkes, seine soziale Ordnung und religiösen Vorstellungen, und untersucht die scheinbaren Widersprüche in ihrem Bild, das durch brutale Opferrituale und beeindruckende kulturelle Leistungen geprägt ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herkunft der Azteken und ihre Wanderung, die soziale Ordnung im Aztekenreich, die aztekische Religion und ihre zentrale Rolle, das aztekische Menschenbild und den Wert des menschlichen Lebens sowie die Interpretation der Widersprüchlichkeiten im Bild der Azteken.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Kapitel 1 (Problemfindung) reflektiert über verschiedene philosophische Menschenbilder und begründet die Notwendigkeit, sich mit dem komplexen Bild der Azteken auseinanderzusetzen. Kapitel 2 (Herkunft der Azteken) beschreibt die Wanderung der Mexica/Chichimeken, ihre kriegerischen Auseinandersetzungen und die Übernahme von Kultur- und religiösen Elementen der Tolteken. Es wird auch auf die Manipulation der aztekischen Geschichte eingegangen. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Ausdehnung des aztekischen Staates und Tenochtitlan.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Interpretation vorhandener Quellen, insbesondere der Berichte von Bernardino de Sahagun, Bernal Diaz del Castillo und Fray Diego Duran.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Bild vom Menschenbild der Azteken zu vermitteln, indem die Herkunft des Volkes, seine soziale Ordnung und seine religiösen Vorstellungen beleuchtet werden. Die Arbeit untersucht die Widersprüchlichkeiten im Bild der Azteken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Azteken, Mexica, Tenochtitlan, Aztlan, Huitzilopochtli, Opferrituale, soziale Ordnung, Religion, Menschenbild, Weltbild, anthropologische Forschung, archäologische Forschung, Kriegerkultur, Hochkultur Mesoamerikas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, zusammenfassende Kapitelbeschreibungen und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was ist das zentrale Problem der Arbeit?
Das zentrale Problem ist die Analyse des komplexen und widersprüchlichen Bildes der Azteken, das durch Berichte über brutale Opferrituale einerseits und beeindruckende kulturelle Leistungen andererseits geprägt ist. Die Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens im aztekischen Kontext und das Verständnis ihrer Welt- und Götterbilder stehen im Mittelpunkt.
- Quote paper
- Karin Fritzsche (Author), 2002, Azteken - Eine anthropologische und religionsethnologische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146617