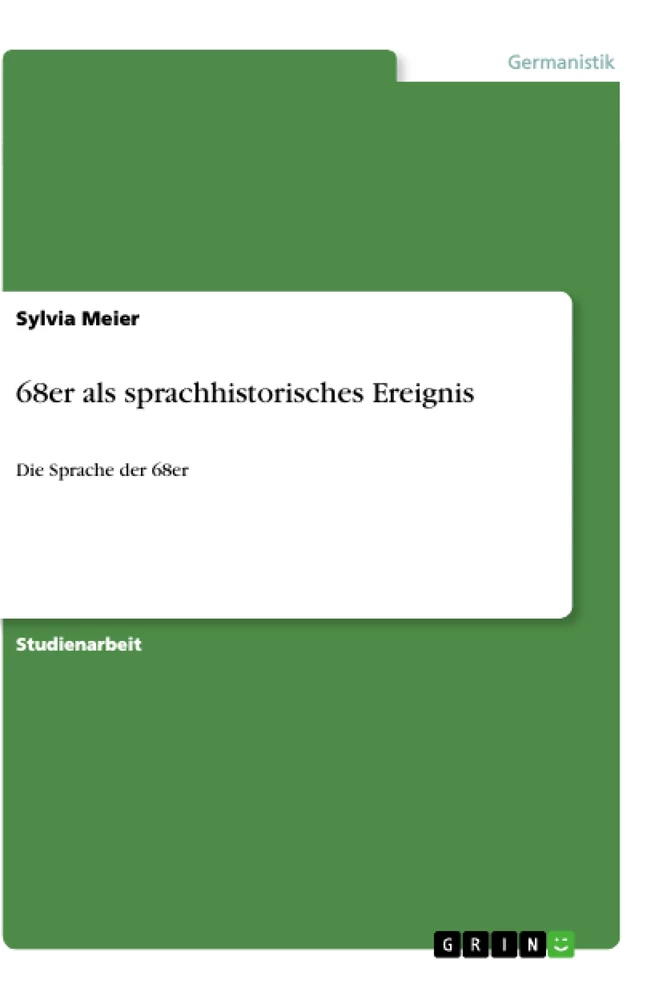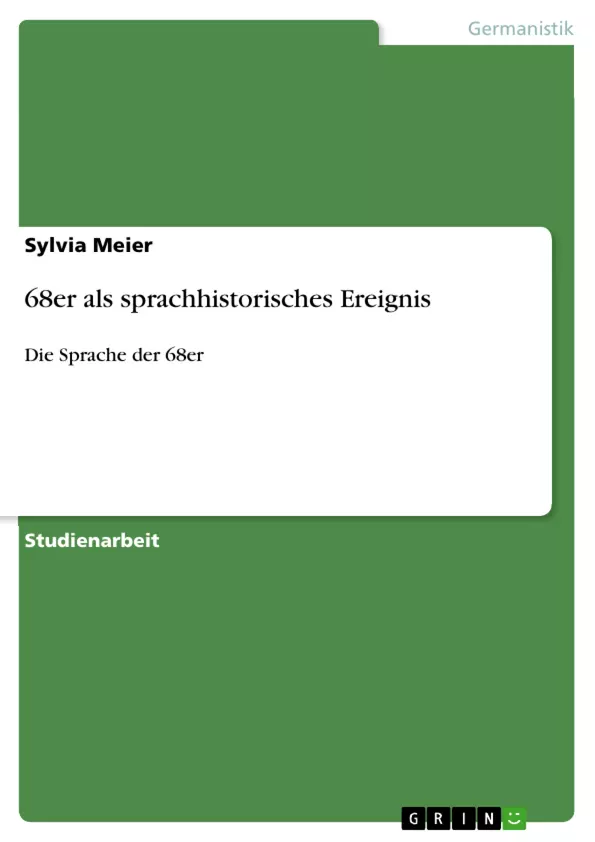Die 68er- ein grosser Begriff. Doch was sind sie denn nun wirklich, diese ominösen 68er- Jahre? Ein
fernes Zeitalter? Für mich sind sie jedenfalls nicht ganz greifbar, wenn auch legendär und irgendwie
mythologisiert. Kraushaar beschäftigt sich ebenfalls mit dieser Frage und kommt dabei zur Annahme,
dass die 68er bei vielen Jüngeren wohl Unverständnis, gar Ärgernis auslöse oder zumindest auf
Desinteresse stosse. Trotzdem sei es kein fernes Zeitalter, da noch „zuviel von dem lebendig“ sei,
„was eine junge Generation vor drei Jahrzehnten auf die Straßen getrieben“ habe. Kraushaar (2000:
7) Es ist nicht zuletzt die Fülle an Literatur, die unterschtreicht, dass dieses Zeitalter eine Zäsur, einen
wichtigen, bewegenden Einschnitt in der Geschichte der BRD darstellt. Zweifelsohne sprechen wir
von einem historischen Ereignis. Die Revolten dieser jungen, neuen Generation, die die Gesellschaft
ihrer Zeit hinterfragt, sind uns bekannt. Doch was mich nun interessiert, ist, wie sie sich artikuliert,
wie sie ihre Sprache einsetzt, um ihre Bedürfnisse wirksam auszudrücken. Die 68er- sind sie auch in
sprachhistorischer Hinsicht ein Ereignis? Fungiert die Sprache gewissermassen als Spiegel der
gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen, die sich in der BRD um 1968 zutragen? Welche
Wirkungskraft erzielt sie tatsächlich auf politischem Gebiet? Welchem Vokabular bedient sie sich und
welche linguistischen Formen machen ihr Wesen aus? Wer ist für ihre Konstituierung verantwortlich
und bemächtigt sich ihrer? Welche Ziele werden mit Hilfe der Sprache angestrebt und werden sie
auch erreicht? Wie wird dabei auf den neuen Sprachgebrauch reagiert – und dies sowohl von Seiten
der politischen Gegenparteien wie auch der Bevölkerung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Kontext
- 2.1 Die politischen Verhältnisse in der BRD um 1968
- 2.2 Studentenbewegung/ -revolte (Gesellschaftskritik)
- 3. Die Sprache der 68er
- 3.1 Die Sprache der APO
- 3.1.1 Sprachkritik
- 3.2 Die Sprache der SPD
- 3.2.1 Kampf um Wörter
- 3.2.2 Hochwertvokabeln
- 3.1 Die Sprache der APO
- 4. Kritische Betrachtung der „linken Sprache“
- 4.1 Sprachherrschaft
- 4.2 Diskrepanz zwischen Sprache und Realität
- 5. Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprache der 68er-Bewegung in der BRD als sprachhistorisches Ereignis. Ziel ist es, die Konzeption dieser Sprache zu analysieren und ihren Dialog mit dem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Umfeld zu beleuchten. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf den historischen Kontext und den sprachlichen Gebrauch in der BRD.
- Die politischen Verhältnisse in der BRD um 1968
- Die Studentenbewegung und ihre Gesellschaftskritik
- Die sprachlichen Ausdrucksmittel der APO
- Der Einfluss der Kritischen Theorie auf die Sprache der 68er
- Die Reaktion auf den neuen Sprachgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der 68er-Bewegung als sprachhistorisches Ereignis ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Konzeption der Sprache der 68er und ihrem Dialog mit dem Umfeld. Die Arbeit konzentriert sich auf den historischen Kontext und den sprachlichen Gebrauch in der BRD und kündigt die methodische Vorgehensweise an: linguistische Analyse und Beleuchtung verschiedener Kritikansätze, unter Einbezug von Originaltexten und Flugblättern.
2. Historischer Kontext: Dieses Kapitel liefert den notwendigen Hintergrund für das Verständnis der Sprache der 68er-Bewegung. Es beschreibt die politischen Verhältnisse in der BRD um 1968, einschließlich der Großen Koalition unter Kiesinger, des Wirtschaftswachstums und der Debatte um die Notstandsverfassung. Es beleuchtet die Studentenbewegung als antiautoritäre Revolte, die etablierte Werte und Normen radikal hinterfragte, und ihre unterschiedlichen Kritikpunkte an verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Themen. Das Kapitel führt die APO (außerparlamentarische Opposition) ein und beschreibt ihre Rolle in der Verbreitung der Kritik durch Diskussionsveranstaltungen, Demonstrationen, Zeitschriften und Flugblätter.
3. Die Sprache der 68er: Dieses Kapitel beginnt mit der Erläuterung des Verhältnisses von Sprache und Ideologie, wobei die unterschiedlichen Auffassungen und die damit verbundenen Meinungsverschiedenheiten hervorgehoben werden. Es analysiert die Sprache der APO, ihren Einfluss durch die Frankfurter Schule und Persönlichkeiten wie Marcuse und Adorno. Der Abschnitt zur Sprachkritik der Studentenbewegung thematisiert die Ablehnung der herrschenden Selbstzufriedenheit und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Schlüsselwörter
68er-Bewegung, Studentenbewegung, APO, Sprachgeschichte, BRD, Politische Sprache, Kritische Theorie, Sprachkritik, Gesellschaftskritik, Ideologie, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur sprachlichen Analyse der 68er-Bewegung
Was ist der Gegenstand dieser sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Sprache der 68er-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) als sprachhistorisches Ereignis. Sie untersucht die Konzeption dieser Sprache und ihren Dialog mit dem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Umfeld der Zeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die politischen Verhältnisse in der BRD um 1968, die Studentenbewegung und ihre Gesellschaftskritik, die sprachlichen Ausdrucksmittel der Außerparlamentarischen Opposition (APO), den Einfluss der Kritischen Theorie auf die Sprache der 68er und die Reaktionen auf den neuen Sprachgebrauch. Ein Schwerpunkt liegt auf der linguistischen Analyse der Sprache der APO und ihrer Sprachkritik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Historischer Kontext) beschreibt die politischen Verhältnisse und die Studentenbewegung. Kapitel 3 (Die Sprache der 68er) analysiert die Sprache der APO und die Sprachkritik der Studentenbewegung. Kapitel 4 (Kritische Betrachtung der „linken Sprache“) beleuchtet Aspekte wie Sprachherrschaft und die Diskrepanz zwischen Sprache und Realität. Kapitel 5 (Zusammenfassung und Schlusswort) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine linguistische Analyse und beleuchtet verschiedene Kritikansätze. Sie bezieht Originaltexte und Flugblätter der 68er-Bewegung mit ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: 68er-Bewegung, Studentenbewegung, APO, Sprachgeschichte, BRD, Politische Sprache, Kritische Theorie, Sprachkritik, Gesellschaftskritik, Ideologie, Linguistik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Konzeption der Sprache der 68er-Bewegung zu analysieren und ihren Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Umfeld zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf den historischen Kontext und den sprachlichen Gebrauch in der BRD.
- Citar trabajo
- Sylvia Meier (Autor), 2007, 68er als sprachhistorisches Ereignis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146627