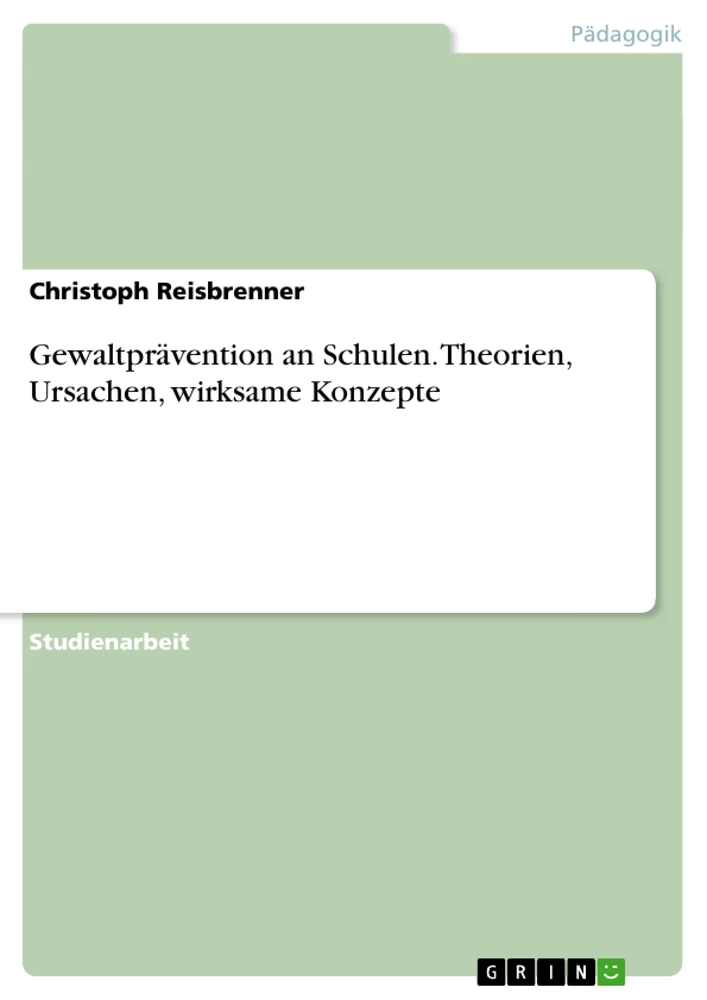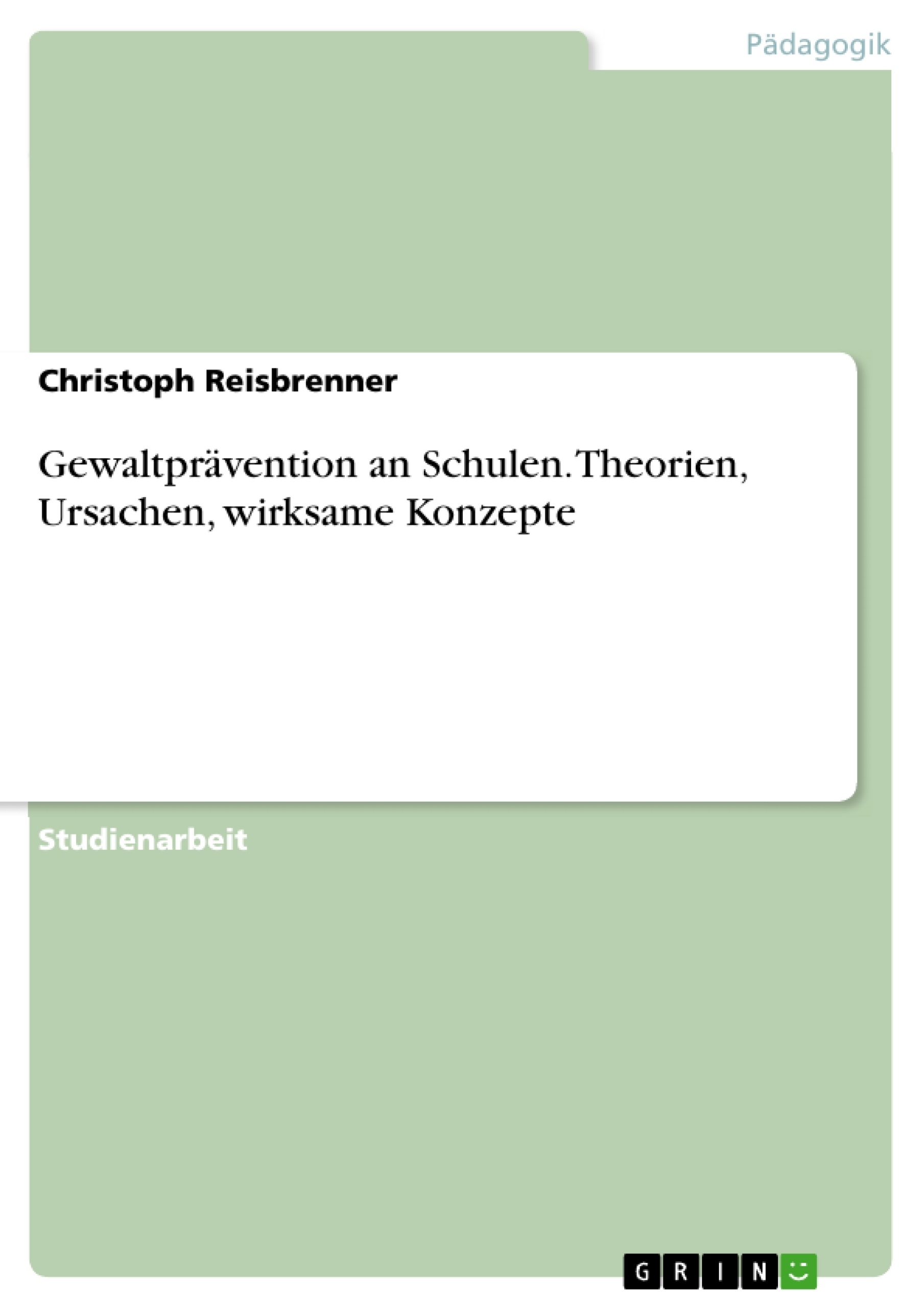Diese Arbeit möchte einen kurzen Einblick in die Problematik von Gewalt an deutschen Schulen geben. Was versteht man eigentlich unter Gewalt? Wie kommt sie zustande und wie äußert sie sich?Wie sehen erfolgreiche Konzepte gegen Gewalt aus, und worauf sind sie ausgerichtet? Ist der Schüler immer das Übel in der Schule? Wem kann man hier den „Schwarzen Peter“ zuschieben? Kann man erfolgreiche Modelle vorweisen? Ist vielleicht aufgrund des zunehmenden öffentlichen Interesses sogar von einem Zuwachs schulischer Gewalt auszugehen? Diesen Fragen möchte ich in der folgenden Abhandlung nachgehen zum Schluss soll eine eigene kleine Stellungnahme diese Arbeit abrunden[...]
Wir dürfen nicht den Schülern die Schuld an ihrem „Fehlverhalten“ geben. Denn die Schuld haben wir zu tragen, wir, die Erwachsenen, die Eltern, die Lehrer, der Staat, die Erwachsenen, die Medien. Die Schüler sind so, weil wir sie zu dem gemacht haben was sie sind, weil wir es zugelassen haben, dass wir ihre Bedürfnisse ignoriert haben, und sie um jeden Preis in die Gesellschaft einpassen wollen. Wir müssen sehen, dass wir im Schulwesen umdenken, weg vom Leistungsprinzip (vor allem auch weg von 12-Jahre-Abitur) und hin zur Förderung jedes einzelnen Schülers, zu mehr Sozialkompetenzen. Vor allem die Tatsache, dass sich viele Lehrer immer noch zum Frontalunterricht bekennen, spiegelt deutlich die vorzufindende Erdrückung der Kinder im Klassenraum wieder, und ist alles andere als zeit- und kindgerecht. Sie müssen gegen ihren Willen zuhören und stillsitzen. Es ist doch kein Wunder, dass manche Schüler anfangen vor lauter Prüfungs- und Disziplindruck zu rebellieren. Denn Wut ist ein Ausdruck innerer Unzufriedenheit und weist auf einen Mangelzsutand in der äußeren und inneren Realität hin[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff
- 2.1 Gewalt im Alltag
- 2.2 Gewalt in Familien
- 2.3 Gewalt gegen Kinder
- 3. Gewalttheorie
- 3.1 Psychologie, Soziologie und EZW
- 3.2 Ansätze der Gewaltprävention
- 4. Ursachen für Gewalt in Schulen
- 5. Nimmt die Gewalt zu?
- 6. Präventionskonzepte
- 7. Determinanten der Gewalt
- 7.1 Handlung bei Konflikten
- 7.2 Resilienz
- 7.3 Emotionale Intelligenz
- 7.4 Soziale Wahrnehmung
- 7.5 Sport und Fair Play
- 8. Gewaltprävention aktuell
- 9. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen von Gewalt an deutschen Schulen. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte von Gewalt, von der Definition des Begriffs über Ursachen und Theorien bis hin zu Präventionskonzepten. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Problematik zu schaffen und wirksame Strategien zur Gewaltprävention zu diskutieren.
- Definition und Abgrenzung des Gewaltbegriffs
- Ursachen und Theorien von Gewalt an Schulen
- Analyse verschiedener Präventionsansätze
- Bewertung der Effektivität von Gewaltpräventionsmaßnahmen
- Diskussion der aktuellen Situation der Gewaltprävention an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Gewalt an deutschen Schulen ein und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Es werden Fragen nach der Definition von Gewalt, ihren Ursachen, wirksamen Präventionskonzepten und der Entwicklung der Gewalt an Schulen aufgeworfen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung des Problems und der Suche nach Lösungen.
2. Begriff: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Gewalt. Es wird deutlich, dass ein einheitlicher Gewaltbegriff in der Forschung noch fehlt und über die Einbeziehung von physischer, psychischer und verbaler Gewalt diskutiert wird. Der Begriff wird erweitert um personelle und strukturelle Ebenen, wobei die Perspektive des Opfers im Vordergrund steht. Mobbing und Bullying werden als spezifische Aspekte der personellen Gewalt in der Schule herausgestellt. Die Diskussion über die Grenzen des Gewaltbegriffs, beispielsweise im familiären Kontext, wird angedeutet.
2.1 Gewalt im Alltag: Dieses Unterkapitel untersucht die Wahrnehmung von Gewalt in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und Kulturen. Es wird gezeigt, dass die Bewertung von Gewalt unterschiedlich ausfällt, je nach Kulturkreis und sozialer Gruppe. Die unterschiedliche Wahrnehmung von Gewalt bei Jungen und Mädchen wird angesprochen, ebenso wie der Konflikt zwischen dem Ideal einer gewaltfreien Erziehung und der Realität. Der Abschnitt betont die Ambivalenz und Komplexität des Gewaltbegriffs im alltäglichen Leben.
2.2 Gewalt in Familien: Dieses Unterkapitel beleuchtet die häufige und oft unterschätzte Gewalt in Familien. Es wird hervorgehoben, wie lange dieses Thema tabuisiert war und wie wichtig die Rolle der Frauenbewegung und Kinderschutzinitiativen bei der Thematisierung ist. Die Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten bei der Definition von Gewalt im familiären Kontext und die langjährige Vernachlässigung des Problems.
2.3 Gewalt gegen Kinder: Hier werden verschiedene Formen von Gewalt gegen Kinder – körperlich, psychisch, sexuell und durch Vernachlässigung – differenziert. Es wird betont, dass Gewalt immer den Körper oder die Seele des Kindes betrifft. Die Definitionen der einzelnen Gewaltformen werden präzisiert und Beispiele genannt, die die unterschiedlichen Ausprägungen verdeutlichen.
3. Gewalttheorie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Ansätzen zur Erklärung von Gewalt. Der Fokus liegt auf der Aggressionsforschung in der Psychologie, die biologische, familiäre, gesellschaftliche und psychische Faktoren berücksichtigt. Die Arbeit thematisiert unterschiedliche Erklärungsansätze für aggressives Verhalten.
4. Ursachen für Gewalt in Schulen: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für Gewalt an Schulen, ohne konkrete Beispiele oder Schlussfolgerungen vorwegzunehmen. Der Fokus liegt auf der systematischen Erforschung möglicher Ursachen und Hintergründe.
5. Nimmt die Gewalt zu?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem aktuellen Trend der Gewalt an Schulen. Es geht um die Einschätzung, ob ein tatsächlicher Anstieg der Gewalt zu verzeichnen ist, ohne jedoch zu konkreten Schlussfolgerungen zu gelangen.
6. Präventionskonzepte: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Konzepte zur Gewaltprävention an Schulen. Es analysiert verschiedene Ansätze und Strategien, ohne konkrete Bewertungen oder Empfehlungen abzugeben.
7. Determinanten der Gewalt: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Faktoren, welche die Entstehung von Gewalt beeinflussen. Die Unterkapitel befassen sich mit dem Umgang mit Konflikten, Resilienz, emotionaler Intelligenz, sozialer Wahrnehmung und der Rolle von Sport und Fair Play als präventive Maßnahmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der einzelnen Determinanten und deren potenziellen Einfluss auf das Gewaltgeschehen.
8. Gewaltprävention aktuell: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Gewaltprävention an Schulen, ohne spezifische Projekte oder Programme zu benennen. Es stellt den aktuellen Forschungsstand und die Debatte um wirksame Maßnahmen dar.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Schule, Gewaltbegriff, Aggressionsforschung, Präventionskonzepte, Resilienz, Emotionale Intelligenz, Soziale Wahrnehmung, Mobbing, Bullying.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltprävention an deutschen Schulen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Gewaltprävention an deutschen Schulen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition von Gewalt, den Ursachen und Theorien, verschiedenen Präventionsansätzen und der aktuellen Situation der Gewaltprävention an Schulen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen im Detail: Definition und Abgrenzung des Gewaltbegriffs (inkl. Gewalt im Alltag, in Familien und gegen Kinder), Gewalttheorien (psychologische, soziologische und erziehungswissenschaftliche Ansätze), Ursachen von Gewalt an Schulen, aktuelle Trends der Gewalt an Schulen, verschiedene Präventionskonzepte, Determinanten der Gewalt (Konfliktlösung, Resilienz, emotionale Intelligenz, soziale Wahrnehmung, Sport und Fair Play) und den aktuellen Stand der Gewaltprävention.
Wie wird der Gewaltbegriff definiert?
Das Dokument betont die fehlende einheitliche Definition von Gewalt in der Forschung. Es diskutiert die Einbeziehung von physischer, psychischer und verbaler Gewalt und erweitert den Begriff um personelle und strukturelle Ebenen. Die Perspektive des Opfers steht dabei im Vordergrund. Mobbing und Bullying werden als spezifische Aspekte der personellen Gewalt in der Schule hervorgehoben. Die Komplexität und Ambivalenz des Gewaltbegriffs, insbesondere im familiären Kontext, wird ebenfalls thematisiert.
Welche Theorien zur Erklärung von Gewalt werden vorgestellt?
Das Dokument behandelt verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Gewalt, mit Schwerpunkt auf der Aggressionsforschung in der Psychologie. Biologische, familiäre, gesellschaftliche und psychische Faktoren werden berücksichtigt, und verschiedene Erklärungsansätze für aggressives Verhalten werden diskutiert.
Welche Präventionskonzepte werden untersucht?
Das Dokument untersucht verschiedene Konzepte zur Gewaltprävention an Schulen, analysiert unterschiedliche Ansätze und Strategien, ohne jedoch konkrete Bewertungen oder Empfehlungen abzugeben. Die Rolle von Faktoren wie Konfliktlösungskompetenz, Resilienz, emotionale Intelligenz, soziale Wahrnehmung und Sport/Fair Play als präventive Maßnahmen wird beleuchtet.
Welche Faktoren beeinflussen die Entstehung von Gewalt? (Determinanten der Gewalt)
Das Dokument nennt folgende Determinanten der Gewalt: Umgang mit Konflikten, Resilienz, emotionale Intelligenz, soziale Wahrnehmung und die Rolle von Sport und Fair Play. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der einzelnen Determinanten und deren potenziellen Einfluss auf das Gewaltgeschehen.
Wie wird die aktuelle Situation der Gewaltprävention dargestellt?
Das Dokument bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Gewaltprävention an Schulen, ohne spezifische Projekte oder Programme zu benennen. Es stellt den aktuellen Forschungsstand und die Debatte um wirksame Maßnahmen dar. Die Frage nach einem tatsächlichen Anstieg der Gewalt wird ebenfalls thematisiert, ohne jedoch zu konkreten Schlussfolgerungen zu gelangen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewaltprävention, Schule, Gewaltbegriff, Aggressionsforschung, Präventionskonzepte, Resilienz, Emotionale Intelligenz, Soziale Wahrnehmung, Mobbing, Bullying.
- Quote paper
- Christoph Reisbrenner (Author), 2009, Gewaltprävention an Schulen. Theorien, Ursachen, wirksame Konzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146635