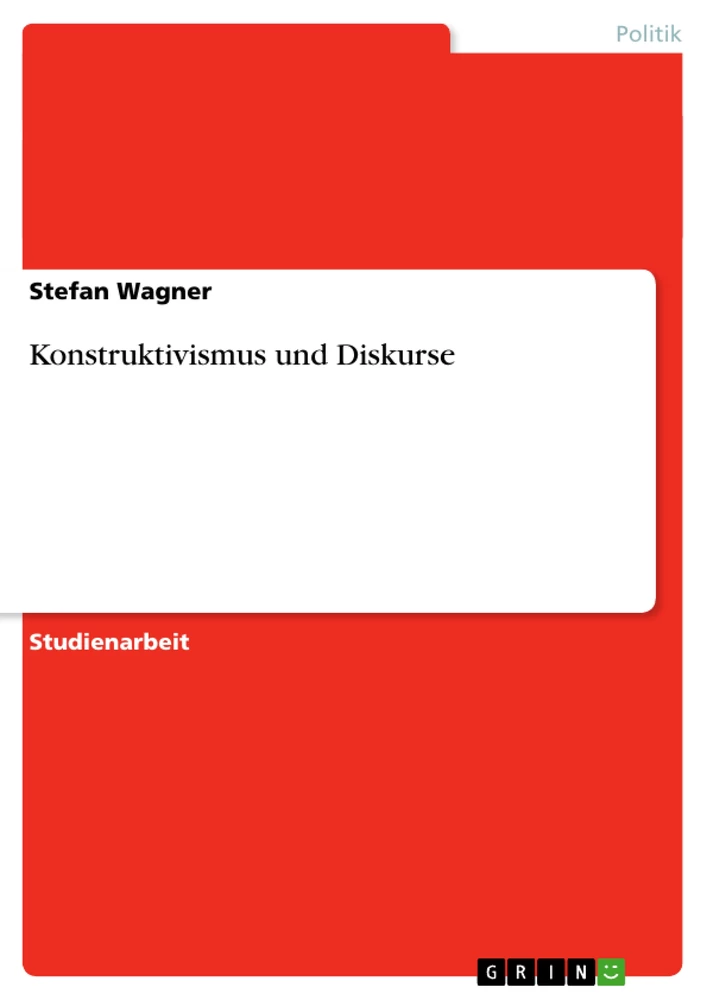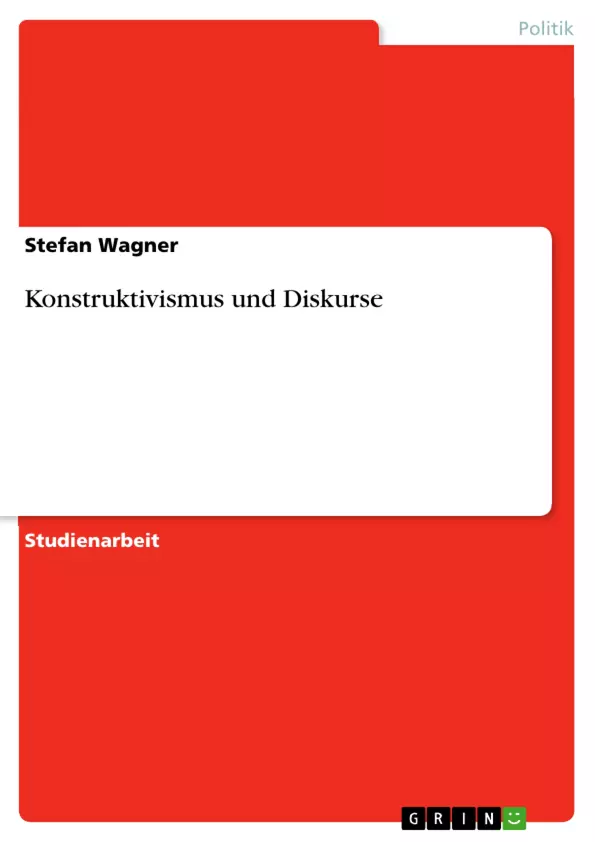„Europäische Außenpolitik“ oder „Außenpolitik der Europäischen Union“? Diese Frage stellt sich anhand des aktuell gegebenen Untersuchungsrahmen und weißt bereits hier darauf hin, dass es möglicherweise Probleme gibt, wenn man die Europäische Union als einheitlichen außenpolitischen Akteur auffassen möchte oder auch bloß die theoretische Möglichkeit zu schaffen sucht zu einem solchen Ziel zu gelangen. Denn Außenpolitik muss sich in Europa mit einem ganzen Set von Akteuren und Organisationen befassen, welche neben ihren intergouvernementalen und supranationalen Einbindungen in zahlreich geschaffenen Institutionen noch immer auf nationaler Ebene parallel eigene Außenpolitiken betreiben, welche in ihren Ausprägungen nicht unter diejenigen beispielsweise der GASP subsumiert werden können.
(...)
In der Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen wurden seit je her und bis heute unterschiedlichste theoretische Ansätze entwickelt und gebraucht, um die aktuellen Entwicklungen fassbar zu machen und möglicherweise Handlungsanweisungen geben zu können. Als es aus neorealistischer Sicht in den Jahren 1989 / 90 zum großen Zusammenbruch des in dieser Theorie als äußerst stabilen bipolaren Systems kam wurden nun neue Überlegungen stärker und der Platz für deren Ansichten war geschaffen. Seither ist der Konstruktivismus eine der führenden Strömungen, welcher, obwohl er nicht beansprucht eine ausgearbeitete Theorie der Internationalen Beziehungen bieten zu können, und er einer Theoriebildung, bei der aus allgemeinen Annahmen Gesetzesaussagen (Hypothesen) abgeleitet werden, eher kritisch gegenübersteht, vor allem aufgrund seiner Offenheit gegenüber Annahmen anderer Theorien sowie der Einbeziehung der lange als „low politics“ verachteten Politikfelder, entscheidende Anstöße zu einem Überdenken der aktuellen Lage geben kann, welche einem zukünftig andersartigen Handeln zu Grunde gelegt werden könnte.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstruktivismus – Grundlegendes und Geschichtliches
- Konstruktivistische Grundbegriffe
- Ideen
- Identitäten
- Normen
- Wirkungsweise konstruktivistischer Ansätze
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit konstruktivistischen Ansätzen in der internationalen Politik. Ziel ist es, den Konstruktivismus als Metatheorie der internationalen Beziehungen zu erklären und seine Anwendung auf die Analyse der Europäischen Union als außenpolitischen Akteur zu untersuchen.
- Soziale Konstruktion von Strukturen und Akteuren
- Rolle von Ideen, Identitäten und Normen in der internationalen Politik
- Unterschiede zwischen konstruktivistischen und neorealistischen Ansätzen
- Einfluss von Kommunikation auf die Gestaltung der internationalen Beziehungen
- Potenziale des Konstruktivismus für die Analyse der europäischen Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Einheitlichkeit der Europäischen Union als außenpolitischer Akteur und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem Zusammenspiel von intergouvernementalen und supranationalen Strukturen ergeben.
- Kapitel 2 bietet einen Überblick über den Konstruktivismus als Metatheorie der internationalen Beziehungen. Hier werden die Grundannahmen, die Entwicklung des Konstruktivismus und seine wichtigsten Vertreter erläutert.
- Kapitel 3 widmet sich den zentralen Begriffen des Konstruktivismus, wie Ideen, Identitäten und Normen. Diese werden im Kontext der internationalen Beziehungen diskutiert und ihre Bedeutung für die Analyse von Macht und Handlungsstrukturen aufgezeigt.
- In Kapitel 4 wird die Wirkungsweise konstruktivistischer Ansätze näher untersucht. Hier wird die Bedeutung von Kommunikation und Interpretationsprozessen für die Gestaltung der internationalen Beziehungen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Internationale Beziehungen, Europäische Union, Außenpolitik, Ideen, Identitäten, Normen, Kommunikation, Sozialkonstruktion, Anarchie, Neorealismus, Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Konstruktivismus in den Internationalen Beziehungen?
Der Konstruktivismus ist ein theoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass internationale Strukturen und Akteursinteressen nicht vorgegeben, sondern durch soziale Interaktion, Ideen und Normen konstruiert sind.
Wie unterscheidet sich der Konstruktivismus vom Neorealismus?
Während der Neorealismus auf materiellen Machtverhältnissen und Anarchie basiert, betont der Konstruktivismus die Bedeutung von Identitäten, Normen und kommunikativen Prozessen.
Welche Rolle spielen Identitäten in der Außenpolitik?
Identitäten bestimmen, wie ein Staat seine Interessen definiert und wer als Freund oder Feind wahrgenommen wird, was direkt sein außenpolitisches Handeln beeinflusst.
Ist die EU ein einheitlicher außenpolitischer Akteur?
Das ist umstritten, da neben supranationalen Institutionen wie der GASP die Mitgliedstaaten weiterhin eigene, oft divergierende nationale Außenpolitiken betreiben.
Was bedeutet "kommunikatives Handeln" nach Habermas in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf Prozesse der Verständigung und Argumentation, durch die Akteure gemeinsame Normen entwickeln und ihre Positionen in der internationalen Politik koordinieren.
- Quote paper
- Stefan Wagner (Author), 2009, Konstruktivismus und Diskurse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146661