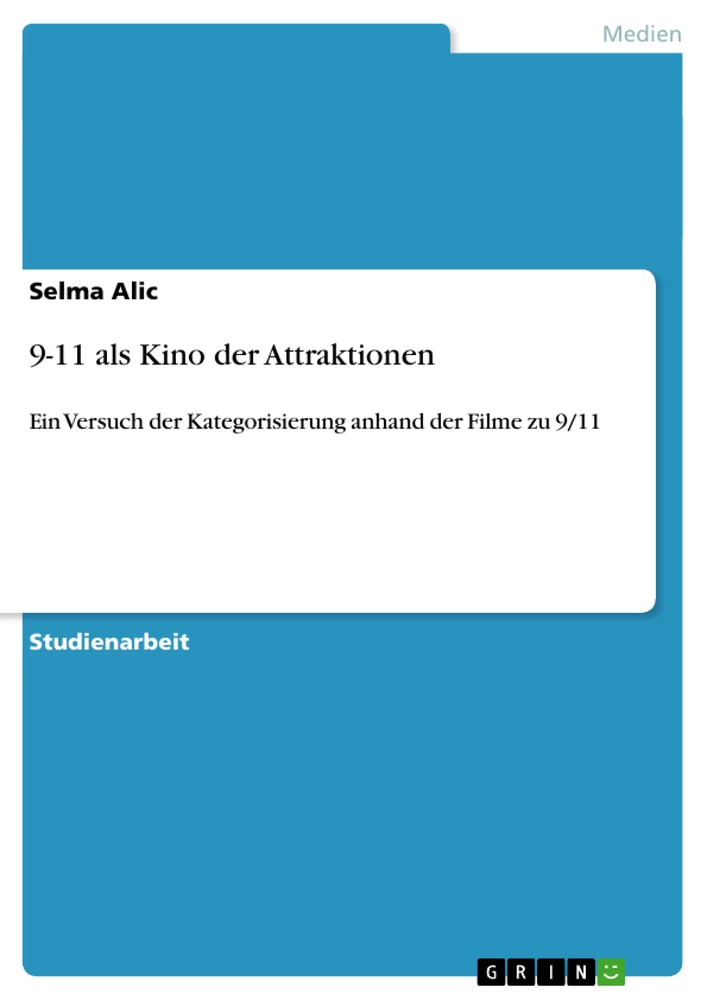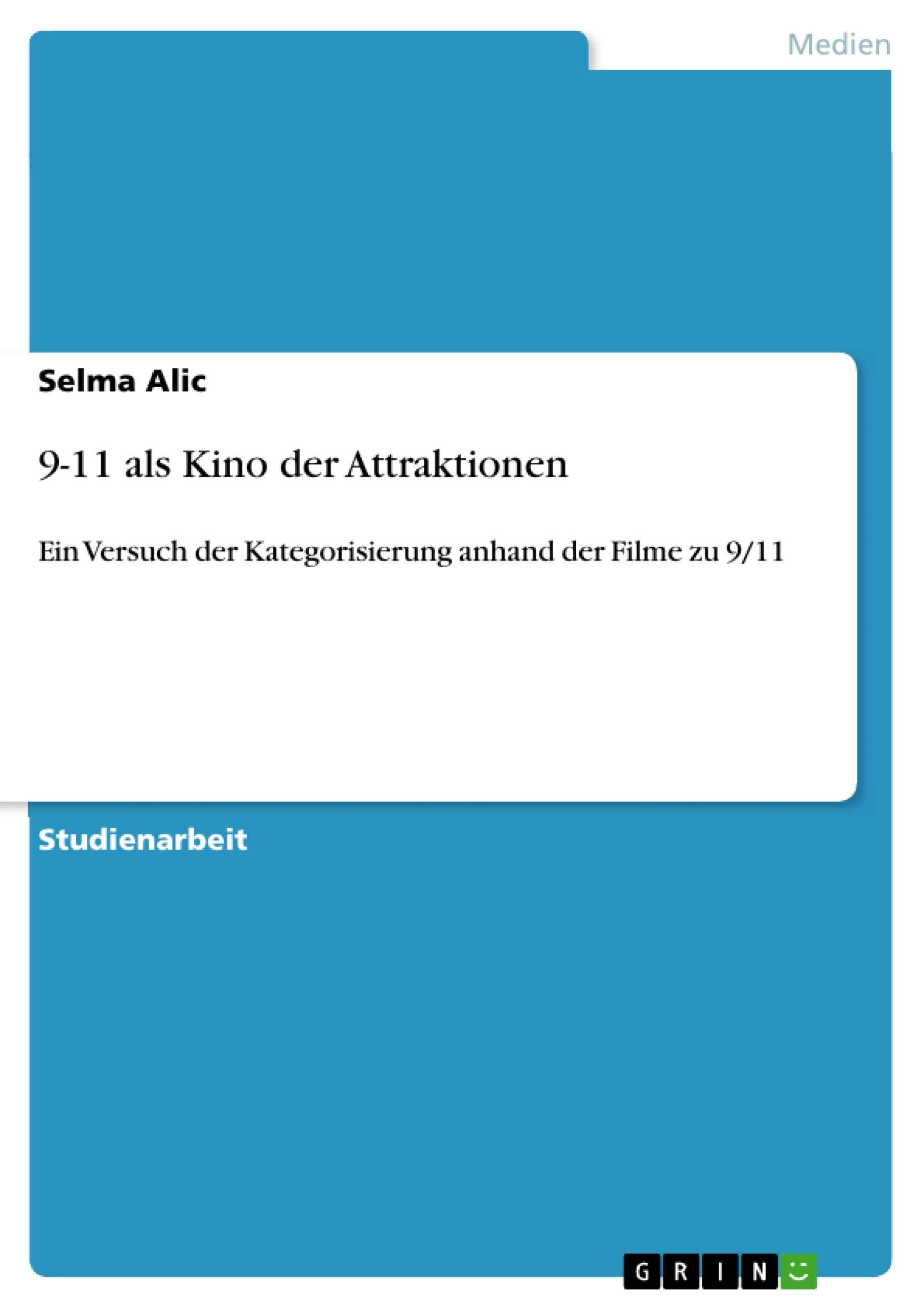Jeder erfahrene Zuschauer hat sich beim analysierenden Rückblick auf einen gesehenen Film schon einmal gefragt: „Was aber war der Zweck dieser Szene? Für die Haupthandlung und die Hauptfigur hat diese Szene doch überhaupt keine Bedeutung.“ Von Kristin Thompson wurden solche, für die Haupthandlung nicht ausschlaggebende Szenen als freie Motive bezeichnet, Michaela Krützen bezeichnet diese wiederum grosso modo als das Kino der Attraktionen. Ohne Zweifel blieb ein solches Kino der Attraktionen, wie der Erfinder des Begriffes selbst schon angemerkt hat, auch nach seiner Ablösung durch das Erzählkino stets ein Bestandteil desselben, denn einerseits war der Zuschauer an dem Kinoapparat selbst, sowie an den exotischen Bildern nicht mehr so fasziniert wie am Anfang, und verlangte zu diesen Bildern auch eine Geschichte. Andererseits musste diese Geschichte, um für den Zuschauer interessant zu sein, spektakulär sein bzw. durch spektakuläre Bilder unterstützt werden. In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst der Begriff „Kino der Attraktionen“ und Krützens Verwendung des Begriffes für den heutigen Film erklärt, um sodann die Bedeutung und den Stellenwert von Thomsons freier Motive als Attraktion in den klassischen Hollywoodfilmen festzuhalten. Es schien, dass vor allem in Katastrophenfilmen ein solches "Kino der Attraktionen" sichtbar sei, weshalb die Auseinandersetzung mit den genannten Theorien auch mittels der Analyse dieses Genres erfolgte. Nach einem Exkurs zum Katastrophenfilm wurde anhand der 9/11 Ereignisse und den darauffolgenden Filmen zu 9/11 die Anwendbarkeit und die Bedeutung des Begriffs „Kino der Attraktionen“ für den Katastrophenfilm und schließlich für die 9/11-Filme untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kino der Attraktionen
- Der Katastrophenfilm
- 9/11 und das Kino der Attraktionen
- Visuelle Neugier
- Figurenbeschreibung und -entwicklung
- Diegese, Voyeurismus und Exhibitionismus
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der 9/11-Filme im Kontext des Kinos der Attraktionen. Sie befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit die Filme zu den Attentaten von 2001 als Spektakelfilme verstanden werden können, die den Zuschauer eher mit visuellen Reizen als mit narrativen Inhalten fesseln.
- Definition des „Kino der Attraktionen“ und dessen Anwendung im heutigen Film
- Analyse der Rolle von „freien Motiven“ im Katastrophenfilm
- Untersuchung der visuellen Elemente in 9/11-Filmen und deren Wirkung auf den Zuschauer
- Bedeutung von Figurenbeschreibung und -entwicklung in 9/11-Filmen im Kontext des Kinos der Attraktionen
- Bedeutung der Diegese, des Voyeurismus und Exhibitionismus in 9/11-Filmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Kinos der Attraktionen und dessen Relevanz für die Analyse von 9/11-Filmen ein. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff „Kino der Attraktionen“ und erläutert, wie er im heutigen Film angewendet werden kann. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Genre des Katastrophenfilms und seinen Besonderheiten. Im vierten Kapitel erfolgt die Analyse von 9/11-Filmen unter dem Aspekt des Kinos der Attraktionen. Hier werden Themen wie visuelle Neugier, Figurenbeschreibung und -entwicklung sowie die Bedeutung der Diegese, des Voyeurismus und Exhibitionismus im Kontext der 9/11-Filme betrachtet.
Schlüsselwörter
Kino der Attraktionen, Katastrophenfilm, 9/11-Filme, freie Motive, visuelle Neugier, Figurenbeschreibung, Diegese, Voyeurismus, Exhibitionismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Kino der Attraktionen"?
Es bezeichnet ein Kino, das den Zuschauer primär durch visuelle Reize, Spektakel und exotische Bilder fesselt, statt durch eine komplexe narrative Handlung.
Wie werden 9/11-Filme in diesem Kontext analysiert?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Filme über die Attentate von 2001 als Spektakelfilme fungieren, die visuelle Neugier befriedigen und den Zuschauer durch spektakuläre Bilder binden.
Was sind "freie Motive" nach Kristin Thompson?
Freie Motive sind Szenen oder Elemente in einem Film, die für die Haupthandlung oder die Entwicklung der Hauptfigur nicht ausschlaggebend sind, aber als Attraktion dienen.
Welche Rolle spielt der Voyeurismus in 9/11-Filmen?
Die Arbeit analysiert, wie die visuelle Aufbereitung der Katastrophe voyeuristische Tendenzen beim Zuschauer anspricht und wie die Diegese des Films darauf reagiert.
Warum ist der Katastrophenfilm ein gutes Beispiel für das Kino der Attraktionen?
Katastrophenfilme setzen stark auf visuelle Effekte und spektakuläre Zerstörungsszenen, was dem Grundgedanken des Kinos der Attraktionen entspricht.
- Citar trabajo
- Selma Alic (Autor), 2009, 9-11 als Kino der Attraktionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146665