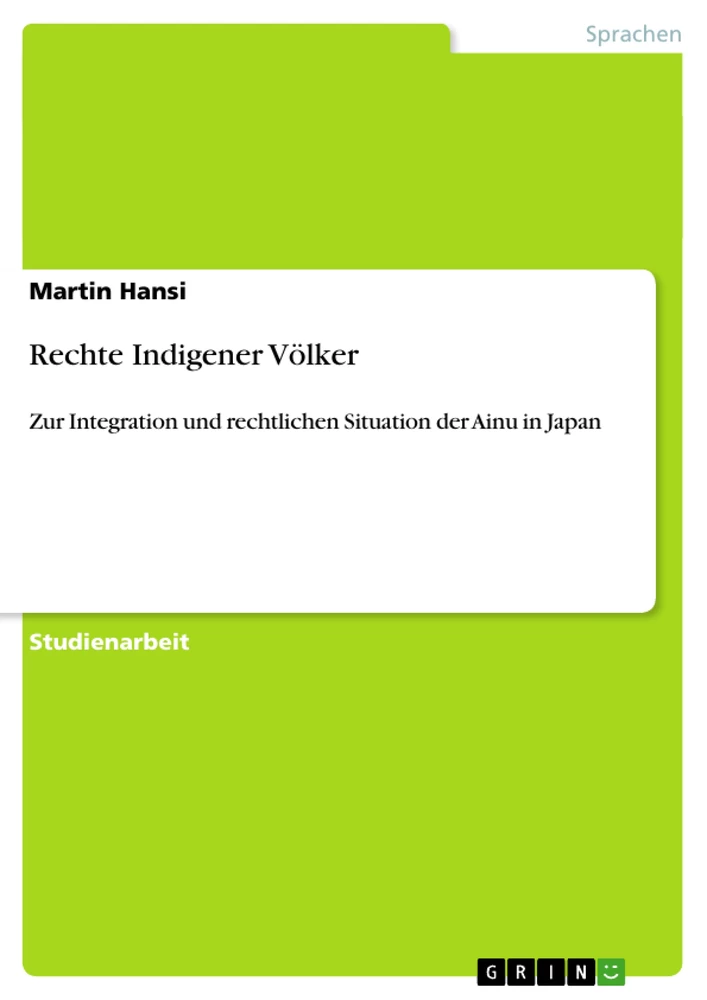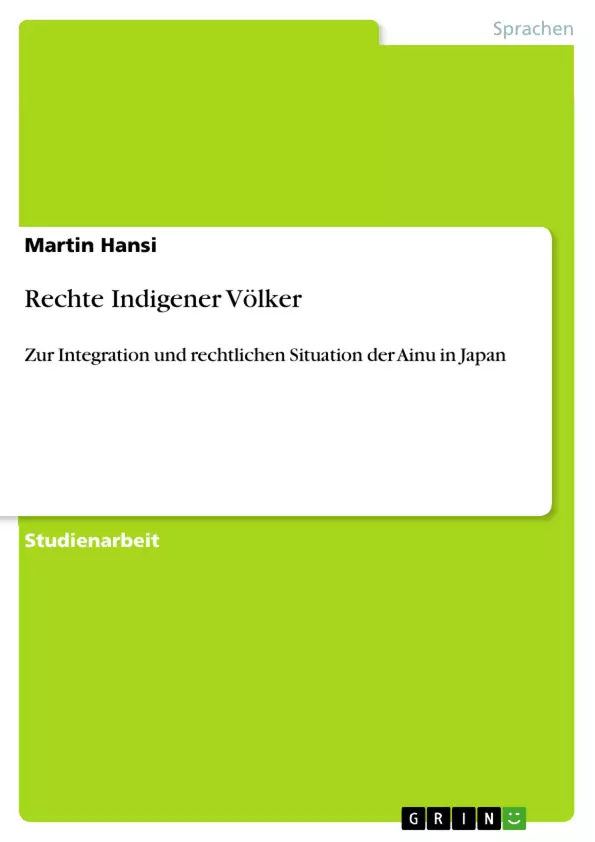Die folgende Arbeit befasst sich mit der Rechtslage der japanischen Ainu aus der Sicht internationaler Rechtsinstrumente. Die Ainu gelten als die ersten Siedler der nördlichen japanischen Inseln, bekommen aber von der Regierung den Status eines indigenen Volkes nicht zugeschrieben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts kämpfen die Ainu auf nationaler und internationaler Ebene um Anerkennung durch den offiziellen Staatsapparat. Eine Anerkennung als indigenes Volk würde den Ainu durch die folgende Ratifizierung diverser internationaler Rechtsinstrumente, Gruppenrechte und spezifische Rechte zum Erhalt ihrer kulturellen Eigenheit einbringen. Kultur, Identität und Sprache der Ainu befinden sich zunehmend einem Auflösungsprozess ausgesetzt, wobei speziell die Sprache, welche als isoliert entstandene Sprache gilt und keine nachweisbaren genealogischen Verbindungen zu anderen Sprachen aufweist, von wissenschaftlicher Seite gesehen sowie als Element kultureller Identität große Bedeutung besitzt.
Im ersten Kapitel der Arbeit werden die grundlegenden Prinzipien und Normen des internationalen Menschenrechtssystems erläutert, die gerade für Minderheiten von zentraler Bedeutung sind. Anschließend wird die von der ILO (International Labour Organization) im Jahre 1989 verfasste Konvention 169 bezüglich der Rechte indigener Völker vorgestellt.
Im Folgekapitel wird aufgezeigt wie die Ainu in die japanische Gesellschaft integriert wurden und wie dabei mit ihrer kulturellen Eigenheit umgegangen worden ist.
Die Rechtslage der Ainu ist das Thema des dritten Kapitels, in welchem ein Hauptaugenmerk darauf gelegt wird, wie Japan die internationalen Rechtsinstrumente umsetzt, beziehungsweise in welcher Art eine Unterzeichnung solcher Dokumente von offizieller Seite als unzumutbar angesehen wird.
Abschließend wird auf zwei besondere Fälle eingegangen in denen Angehörige der Ainu vor Gericht gegen die Regierung Klage erheben. Diese Fälle wurden ausgewählt, da ein regionales Gericht im Rahmen der Entscheidungsfindung die Ainu das erste mal als indigenes Volk angesehen hat und sich durch diese Rechtssprechung im Weiteren positive Entwicklungen für die Ainu ergeben haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Indigene Völker im internationalen Recht
- 1. Das Selbstbestimmungsprinzip
- 2. Normen des Selbstbestimmungsprinzips
- Nichtdiskriminierung
- Kulturelle Integrität
- Natürliche Ressourcen und Land
- Soziale Wohlfahrt und Entwicklung
- Selbstverwaltung/Selbstregierung – Die politische Dimension der Selbstbestimmung
- 3. Die ILO Konvention 169 als zentrales Instrument.
- II. Die Integration der Ainu - Ein Akkulturationsprozess..
- 1. Akkulturation als Teil der Assimilationspolitik.......
- Landwirtschaft
- Bildung und Ehe........
- Utari Kyokai
- 1. Akkulturation als Teil der Assimilationspolitik.......
- III. Zur Rechtssituation der Ainu ......
- 1. Die Ainu im internationalen Recht.......
- 2. Der Nibutani Damm Fall und der Ainu Cultural Promotion Act 1997 …………………………..
- 3. Der Nibutani Prozess als Präzedenzfall
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Situation der japanischen Ainu im Kontext internationaler Rechtsinstrumente. Sie untersucht, wie die Ainu in die japanische Gesellschaft integriert wurden und wie die internationale Rechtsordnung die Rechte indigener Völker im Allgemeinen sowie die Ainu im Speziellen schützt.
- Das Selbstbestimmungsrecht indigener Völker
- Die ILO Konvention 169 und ihre Relevanz für die Ainu
- Die Akkulturation der Ainu und ihre Auswirkungen auf ihre kulturelle Identität
- Die rechtliche Anerkennung der Ainu als indigenes Volk in Japan
- Der Nibutani Damm Fall und seine Bedeutung für die Rechte der Ainu
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der indigenen Rechte im internationalen Kontext. Sie erläutert das Selbstbestimmungsprinzip und seine Normen, die für die Rechte indigener Völker von zentraler Bedeutung sind. Die ILO Konvention 169 wird als zentrales Instrument zur Förderung der Rechte indigener Völker vorgestellt.
Kapitel II befasst sich mit der Integration der Ainu in die japanische Gesellschaft. Es wird analysiert, wie die Ainu in den Akkulturationsprozess eingebunden wurden, insbesondere in Bezug auf Landwirtschaft, Bildung und Ehe. Die Rolle der Utari Kyokai wird dabei ebenfalls betrachtet.
Kapitel III untersucht die Rechtssituation der Ainu in Japan. Es beleuchtet die Relevanz internationaler Rechtsinstrumente für die Ainu und zeigt auf, wie Japan die internationalen Rechtsnormen umsetzt bzw. wie die Unterzeichnung solcher Dokumente von offizieller Seite als unzumutbar angesehen wird. Zwei besondere Fälle, der Nibutani Damm Fall und der Nibutani Prozess, werden näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Indigene Völker, Ainu, Japan, Selbstbestimmung, ILO Konvention 169, Akkulturation, Assimilation, kulturelle Identität, rechtliche Anerkennung, Nibutani Damm Fall, Nibutani Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Ainu und welchen Status haben sie in Japan?
Die Ainu sind die Ureinwohner der nördlichen japanischen Inseln. Lange Zeit verweigerte ihnen die japanische Regierung die offizielle Anerkennung als indigenes Volk.
Was bedeutet die ILO-Konvention 169 für indigene Völker?
Die ILO-Konvention 169 ist ein zentrales internationales Instrument zum Schutz der Rechte indigener Völker, einschließlich Landrechten und kultureller Integrität.
Was war der "Nibutani-Damm-Fall"?
Dies war ein Gerichtsprozess, in dem ein regionales Gericht die Ainu erstmals als indigenes Volk anerkannte, was wichtige rechtliche Entwicklungen anstieß.
Wie beeinflusste die Assimilationspolitik die Kultur der Ainu?
Durch Maßnahmen in Bildung, Landwirtschaft und Ehe wurden die Ainu zur Anpassung gezwungen, was zu einem Auflösungsprozess ihrer Sprache und kulturellen Identität führte.
Warum ist die Sprache der Ainu wissenschaftlich so bedeutend?
Die Ainu-Sprache gilt als isolierte Sprache ohne nachweisbare genealogische Verbindungen zu anderen Sprachen, was sie für Linguisten einzigartig macht.
- Arbeit zitieren
- Martin Hansi (Autor:in), 2009, Rechte Indigener Völker, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146679