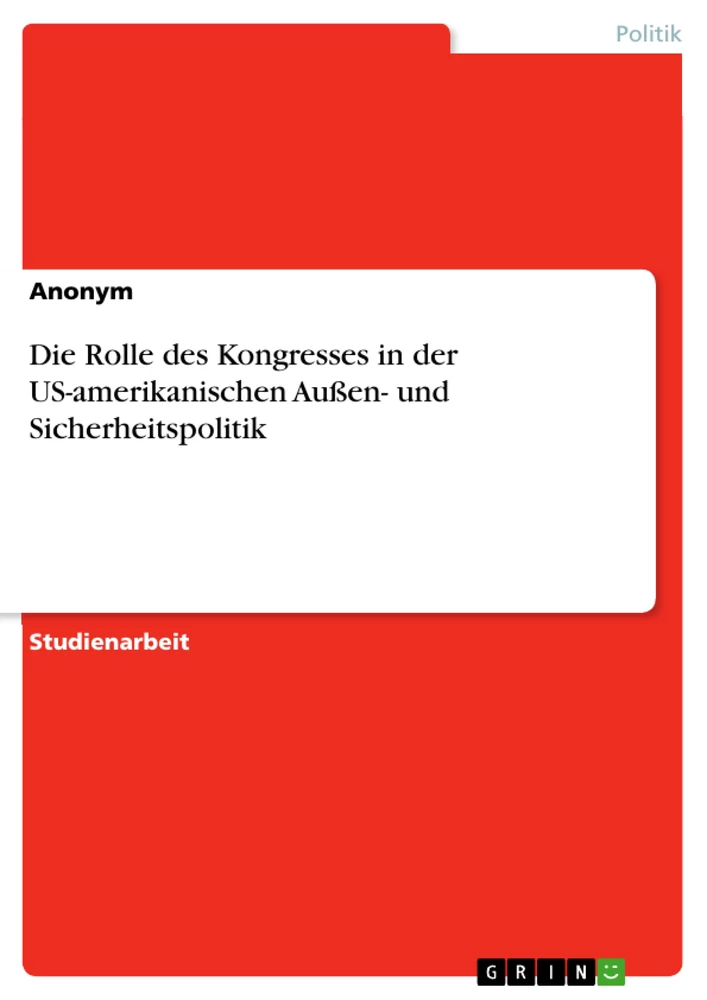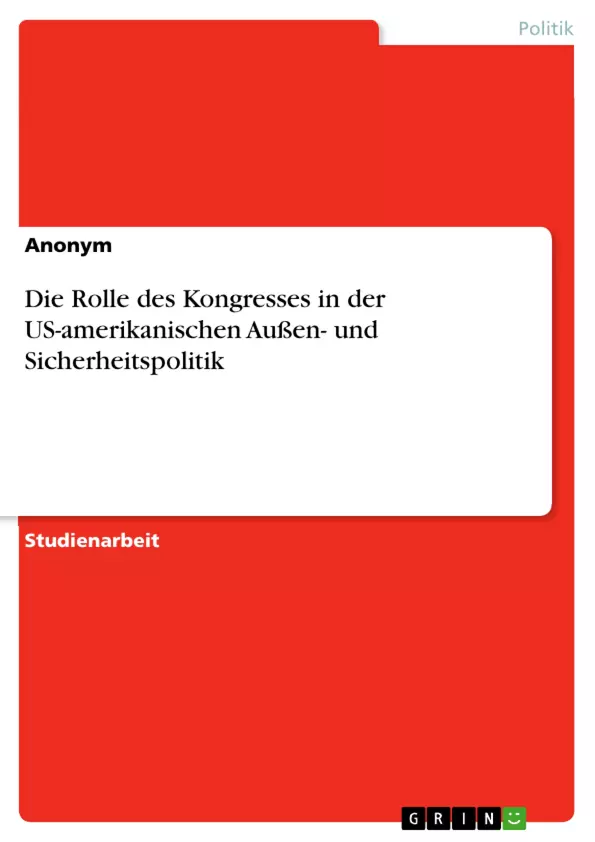Zweihundert Jahre Rivalität um die Kontrolle der Außenpolitik
Der Grundgedanke der Verfassungsväter war es zum einen, die klassische Lehre Montesquieus von einer Teilung der Gewalten zu bemühen und diese – zum anderen – mit einem System der „checks and balances“ zu versehen. Dieses Konzept resultiert aus der tief sitzenden Skepsis der Amerikaner gegen jegliche Art von Machtanhäufung – vor allem auf Seiten der Exekutive. „Diese ist Teil des US-amerikanischen Freiheitsverständnisses, wird genährt aus der Tradition der Graswurzeldemokratie und leitet sich historisch her aus der Ablehnung absolutistischer Tyrannei im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts“ (Lösche 2004: 55). So wurden die Kompetenzen in der Außenpolitik von der Verfassung entweder dem Präsidenten, dem Kongress oder beiden gemeinsam zugewiesen (Jäger/Welz 1998: 420). Dies führte zu verfassungsrechtlichen Unsicherheiten aufgrund der Gewaltenverschränkung und hatte eine Reihe die Außenpolitik betreffende Auseinandersetzungen zur Folge, die von der Judikative in den seltensten Fällen bereinigt werden konnten, da die „political question doctrine“ besagt, dass der Oberste Gerichtshof keine politischen Fragen entscheidet (Jäger/Welz 1998: 420). „Effizienz und Kohärenz wurden zugunsten der wechselseitigen Kontrolle zurückgedrängt“ (Bierling 1992: 27). Somit stieß man im Laufe der Zeit immer wieder auf Fragen der Zuständigkeit in der Außenpolitik, die aus der Verfassung heraus nicht eindeutig genug hervor gingen. „Die amerikanische Konstitution sei, so [der Historiker Edward] Corwin […], „an invitation to struggle for the privilege of directing American foreign policy“.“ (Bierling 1992: 28)
Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst auf die Kompetenzen des Kongresses in den verschiedenen außenpolitischen Bereichen eingegangen werden, wie sie der Legislative ursprünglich von der Verfassung zugewiesen wurden. Anschließend wird unter Berücksichtigung der entsprechenden Meilensteine der außenpolitischen Aktivitäten des Kongresses und deren Effizienz das Kräfteverhältnis und die wechselnde außenpolitische Suprematie zwischen Kongress und Präsident insbesondere seit den 1920er Jahren behandelt.
Als Fazit schließlich soll versucht werden, die Frage zu beantworten, wie das außenpolitische Verhältnis zwischen Kongress und Präsident eingeordnet werden kann und ob dieses „Ringen“ um das Privileg der Außenpolitik wirklich zu jeder Zeit in der amerikanischen Historie als ein solches bewertet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Zweihundert Jahre Rivalität um die Kontrolle der Außenpolitik
- B. Der Kongress in der Außen- und Sicherheitspolitik
- I. Zuständigkeiten in der US-Außenpolitik
- 1. Krieg und Frieden
- 2. Internationale Vereinbarungen
- 3. Kontrolle der Exekutive
- 4. Das Bestätigungsrecht
- II. Der Kongress im Niedergang
- 1. Die verhängnisvolle Außenpolitik des Kongresses in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
- 2. Das Urteil des Supreme Court 1936
- 3. Der Zweite Weltkrieg
- 4. Das Nachkriegsmodell: Kongress und Präsident im außenpolitischen Konsens
- 5. Auf dem Weg zur imperialen Präsidentschaft
- 6. Resümee: Gründe für den Niedergang des Kongresses
- III. Der Kongress im Aufstieg
- 1. Wendepunkt: Vietnamkrieg
- 2. Der Neue Kongress
- I. Zuständigkeiten in der US-Außenpolitik
- C. Fazit: Die Rolle des Kongresses in der Außen- und Sicherheitspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kongress und Präsident in der US-amerikanischen Außenpolitik. Sie beleuchtet die wechselseitige Kontrolle der beiden Institutionen im Hinblick auf Krieg und Frieden, internationale Vereinbarungen und die allgemeine Einflussnahme auf die Exekutive. Dabei werden insbesondere die historischen Entwicklungen seit den 1920er Jahren in den Fokus gerückt, die das Kräfteverhältnis zwischen Kongress und Präsident maßgeblich beeinflusst haben.
- Die verfassungsmässige Kompetenzverteilung zwischen Kongress und Präsident in der Außenpolitik
- Die historische Entwicklung des Einflusses des Kongresses auf die US-Außenpolitik
- Die Rolle des Kongresses in Zeiten des Krieges und der internationalen Krisen
- Die Bedeutung des Senats in der Ratifizierung von internationalen Verträgen
- Die Frage der wechselseitigen Kontrolle und des „Ringen um das Privileg" in der Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Kompetenzen des Kongresses in der US-Außenpolitik, die ihm durch die Verfassung zugestanden werden. Die Kapitel II und III beleuchten die historischen Entwicklungen des Einflusses des Kongresses auf die US-Außenpolitik, angefangen von seiner vermeintlichen Schwäche im Niedergang in den 1920er und 1930er Jahren bis zu seinem Aufstieg im Zuge des Vietnamkriegs. Dabei werden die Ursachen für den Aufstieg und Niedergang des Kongresses im Verhältnis zur Exekutive analysiert. Das Kapitel II befasst sich mit dem „Niedergang" des Kongresses in den 20er und 30er Jahren, während das Kapitel III seinen „Aufstieg" in der Nachkriegszeit behandelt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche US-Außenpolitik, Kongress, Präsident, Krieg und Frieden, internationale Vereinbarungen, Verträge, Gewaltenteilung, „checks and balances", Verfassung, Vietnamkrieg, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie teilen sich Kongress und Präsident die US-Außenpolitik?
Die Verfassung weist Kompetenzen beiden zu. Der Präsident ist Oberbefehlshaber und führt Verhandlungen, während der Kongress das Recht zur Kriegserklärung hat und Verträge ratifizieren muss (Checks and Balances).
Was bedeutet "imperial presidency"?
Der Begriff beschreibt eine Phase, in der der Präsident seine außenpolitischen Machtbefugnisse stark ausweitete und der Kongress zunehmend an Einfluss verlor, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welchen Einfluss hatte der Vietnamkrieg auf das Machtgefüge?
Der Vietnamkrieg war ein Wendepunkt. Aufgrund der massiven Kritik forderte der Kongress seine Kontrollrechte zurück, was unter anderem zur War Powers Resolution von 1973 führte.
Was ist die "political question doctrine"?
Diese besagt, dass der Oberste Gerichtshof politische Streitfragen zwischen Exekutive und Legislative oft nicht entscheidet, was das ständige Ringen um die außenpolitische Führung befeuert.
Welche Rolle spielt der Senat bei internationalen Vereinbarungen?
Vom Präsidenten unterzeichnete Verträge benötigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat, um rechtskräftig zu werden. Dies gibt dem Kongress ein mächtiges Instrument zur Blockade oder Gestaltung der Außenpolitik.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2008, Die Rolle des Kongresses in der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146706