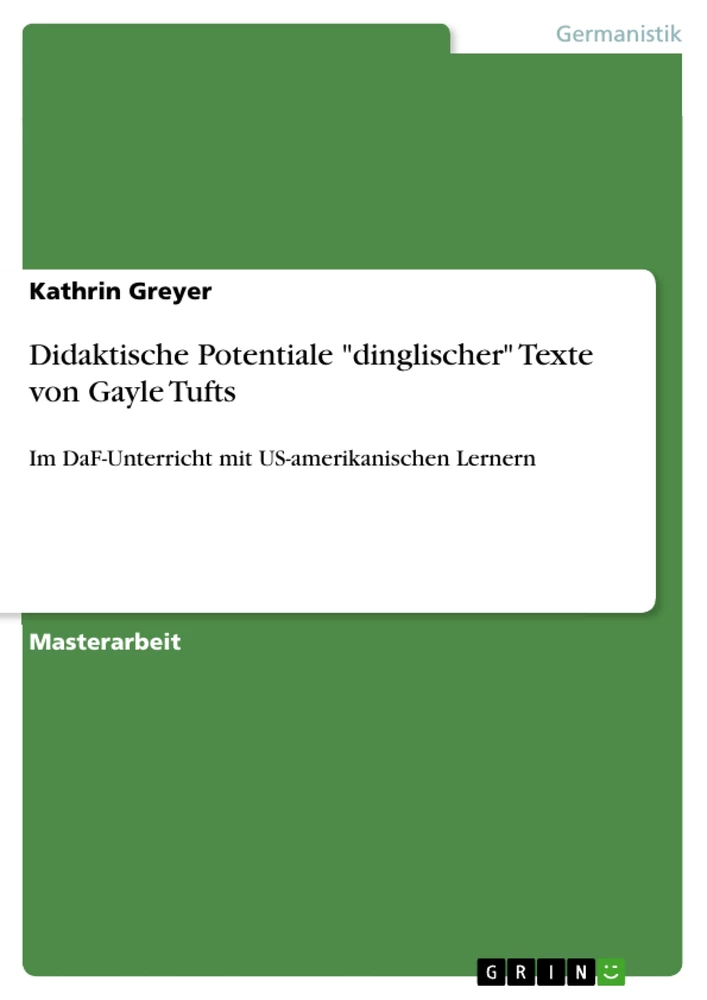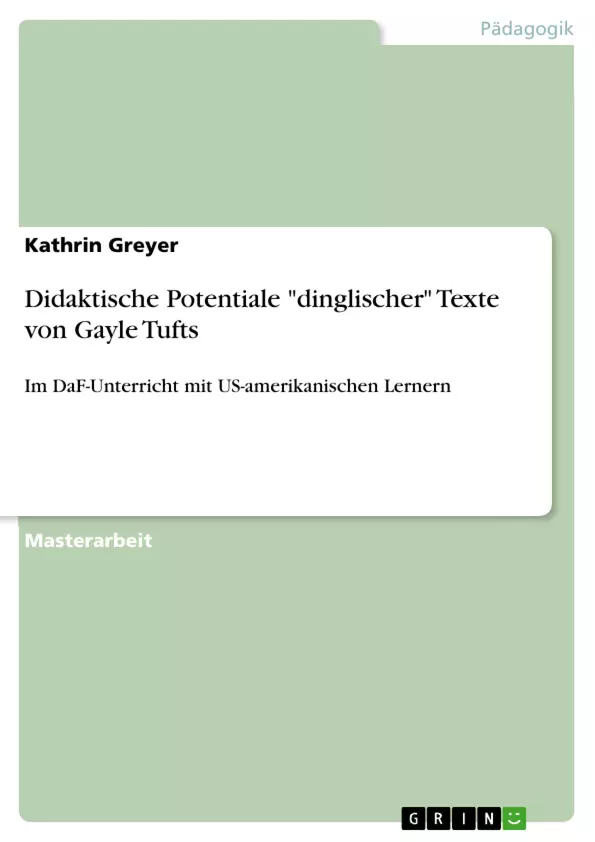In der gegenwärtigen Literatur finden sich zur Verwendung zweisprachiger Texte im „Deutsch als Fremdsprache“ - Unterricht nur wenige Anregungen und noch weniger Untersuchungen. Es existieren keine Ausführungen bezüglich der positiven oder negativen Eignung der Texte Tufts’ für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Durch den Einsatz ausgewählter Tufts-Texte könnten die Lerner jedoch theoretisch dazu angeregt werden, über ihre Eigen- und Fremdwahrnehmung zu reflektieren. Lernerinterne Erfahrungen und Einsichten sowohl in die deutsche als auch die eigene Sprache und Kultur können mit denen Tufts’ verglichen werden, indem neben der Analyse kunstsprachlicher Elemente des „Dinglischen“ auch dessen Inhalt thematisiert wird.
Die inhaltliche Komponente der Texte Tufts’ wird durch die Verwendung des „Dinglischen“ als Kommunikationsform besonders hervorgehoben. Auf diese Weise verschwimmen die Grenzen zwischen Deutsch und Englisch sowohl auf sprachlicher als auch auf kultureller Ebene zu einer emotionalen Menschlichkeit, die sich über definierte Sprach- und Kulturgrenzen hinwegsetzt und die Leser ihrer eigenen, eng definierten Nationalität enthebt. So gestaltet Tufts eine wahrhaft multikulturelle Atmosphäre und schafft damit die Voraussetzung für individuelle, sprachliche und kulturelle Reflexionen.
Das zentrale Anliegen dieser Arbeit ist es, die Qualität des „Dinglischen“ als Kunstsprache herauszuarbeiten und didaktische Einsatzmöglichkeiten derselben vorzuschlagen und zu rechtfertigen. Dabei scheint es wichtig, nicht nur auf die inhaltlichen und strukturellen Besonderheiten der Texte Tufts’ einzugehen, sondern auch die emotionalen und damit motivationalen Potentiale dieser Texte vor dem Hintergrund eines lernerzentrierten Unterrichts zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- VORBEMERKUNGEN
- TUFTS' REKONSTRUIERTE SPRACHLERNBIOGRAPHIE
- INDIVIDUELLE UND GESELLSCHAFTLICHE MEHRSPRACHIGKEIT.
- ,,DINGLISCH“: KUNSTSPRACHE UND INTERLANGUAGE
- DIE INTERLANGUAGE-HYPOTHESE UND „DINGLISCH“.
- Begriffsbestimmung..
- Prozesse in Interlanguages....
- Fossilisierung und systemische Variabilität
- „DENGLISCH“ VERSUS „DINGLISCH“ - EIN DIFFERENZIERUNGSVERSUCH
- TUFTS',,DINGLISCH“ ALS HYbride KunstSPRACHE
- ,,DINGLISCH“ ALS INTERLANGUAGE - EIN ANALYSEVERSUCH.
- DIDAKTISCHE POTENTIALE
- LERNERMOTIVATION UND FEHLERTOLERANZ
- Lerneremotionen.....
- Erfolg trotz Fehler..
- TRAINING DER SPRACHLICHEN GRUNDKOMPETENZEN
- TRAINING SOZIALER UND INTERKULTURELLER SCHLÜSSELKOMPETENZEN
- INHALTLICHE EIGNUNG - KULTURVERGLEICHENDE LANDESKUNDE.
- STRUKTURELLE EIGNUNG
- Satzbau und Wortwahl..
- ,,Denglisch“ versus „Dinglisch“: - ein Didaktisierungsvorschlag
- Storytelling.………………………..\n
- ,,DINGLISCH“ IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT - EIN FAZIT
- AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die didaktischen Potentiale des „Dinglischen“, wie es in den Texten von Gayle Tufts verwendet wird, für den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht mit US-amerikanischen Lernern.
- Rekonstruktion von Tufts' Sprachlernbiografie und Einordnung ihres „Dinglischen“ als Kunstsprache und Interlanguage
- Analyse der didaktischen Potentiale des „Dinglischen“ in Bezug auf Lernermotivation, Fehlertoleranz und Training sprachlicher und sozialer Kompetenzen
- Bewertung der inhaltlichen und strukturellen Eignung der Texte Tufts' für den DaF-Unterricht, insbesondere im Hinblick auf kulturvergleichende Landeskunde
- Diskussion der Möglichkeiten, „Dinglische“ Texte im Unterricht einzusetzen, um ein Bewusstsein für sprachliche und kulturelle Unterschiede zu schaffen
- Verbindung der Erkenntnisse mit der aktuellen Diskussion über bilingualen Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Rekonstruktion von Tufts' Sprachlernbiographie, die auf ihren veröffentlichten Texten basiert. Anhand dieser Analyse wird ihr „Dinglisch“ als Interlanguage und Kunstsprache charakterisiert. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Interlanguage-Hypothese und des Begriffs „Dinglisch“ dargestellt. Dabei wird auch auf die Unterschiede zwischen „Dinglisch“ und „Denglisch“ eingegangen. Die didaktischen Potentiale des „Dinglischen“ werden im dritten Kapitel beleuchtet. Hierbei werden die Themen Lernermotivation, Fehlertoleranz, Training sprachlicher Kompetenzen und die Nutzung des „Dinglischen“ für interkulturelles Lernen behandelt. Schließlich werden die strukturellen Eignungen der „Dinglischen“ Texte für den DaF-Unterricht analysiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf weitere Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
„Dinglisch“, Interlanguage, Kunstsprache, Didaktik, Deutsch als Fremdsprache, Lernermotivation, Fehlertoleranz, interkulturelles Lernen, Landeskunde, bilingualer Fremdsprachenunterricht, Gayle Tufts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Dinglisch“ im Kontext von Gayle Tufts?
Dinglisch ist eine von Gayle Tufts genutzte Kunstsprache, die Deutsch und Englisch mischt und linguistisch als „Interlanguage“ (Zwischensprache) analysiert werden kann.
Wie kann Dinglisch im DaF-Unterricht eingesetzt werden?
Die Texte können Lerner dazu anregen, über Eigen- und Fremdwahrnehmung zu reflektieren und sprachliche Strukturen beider Sprachen spielerisch zu vergleichen.
Fördert Dinglisch die Fehlertoleranz beim Sprachenlernen?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass Tufts’ Texte zeigen, wie Kommunikation trotz Fehlern gelingen kann, was die Motivation und emotionale Sicherheit der Lerner stärkt.
Was ist der Unterschied zwischen „Denglisch“ und „Dinglisch“?
Die Arbeit bietet einen Differenzierungsversuch: Während Denglisch oft als Sprachverfall kritisiert wird, ist Dinglisch eine kreative, hybride Kunstsprache mit didaktischem Potenzial.
Eignen sich die Texte für US-amerikanische Deutschlerner?
Besonders für US-Lerner bieten die Texte eine hohe Identifikationsmöglichkeit, da sie Tufts’ eigene Sprachlernbiografie und den Kulturvergleich thematisieren.
- Citation du texte
- Kathrin Greyer (Auteur), 2007, Didaktische Potentiale "dinglischer" Texte von Gayle Tufts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146735