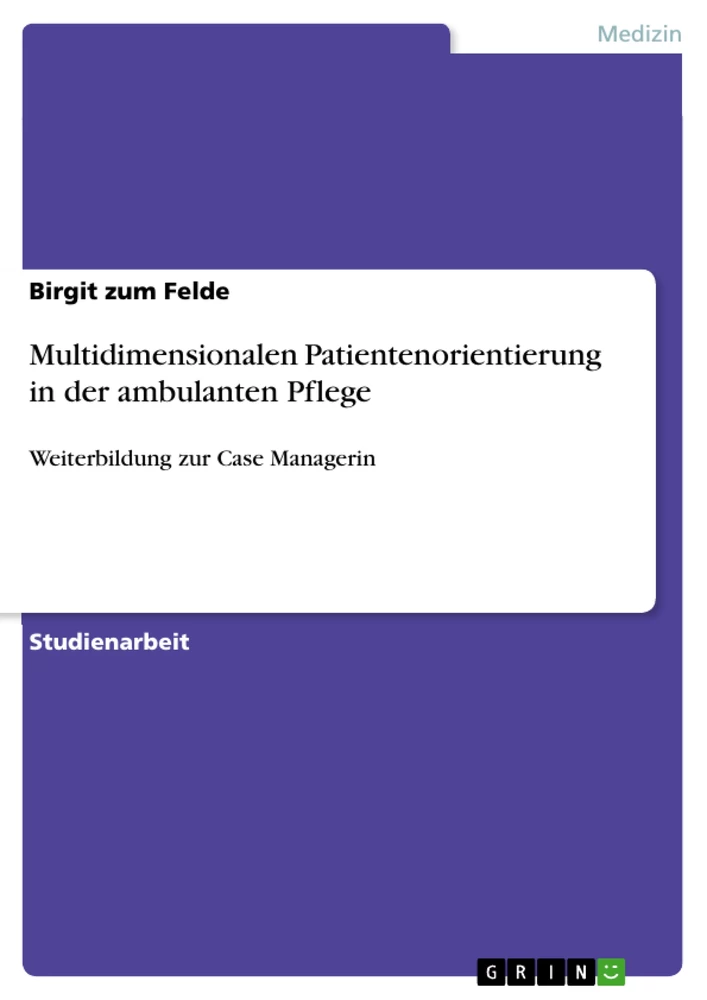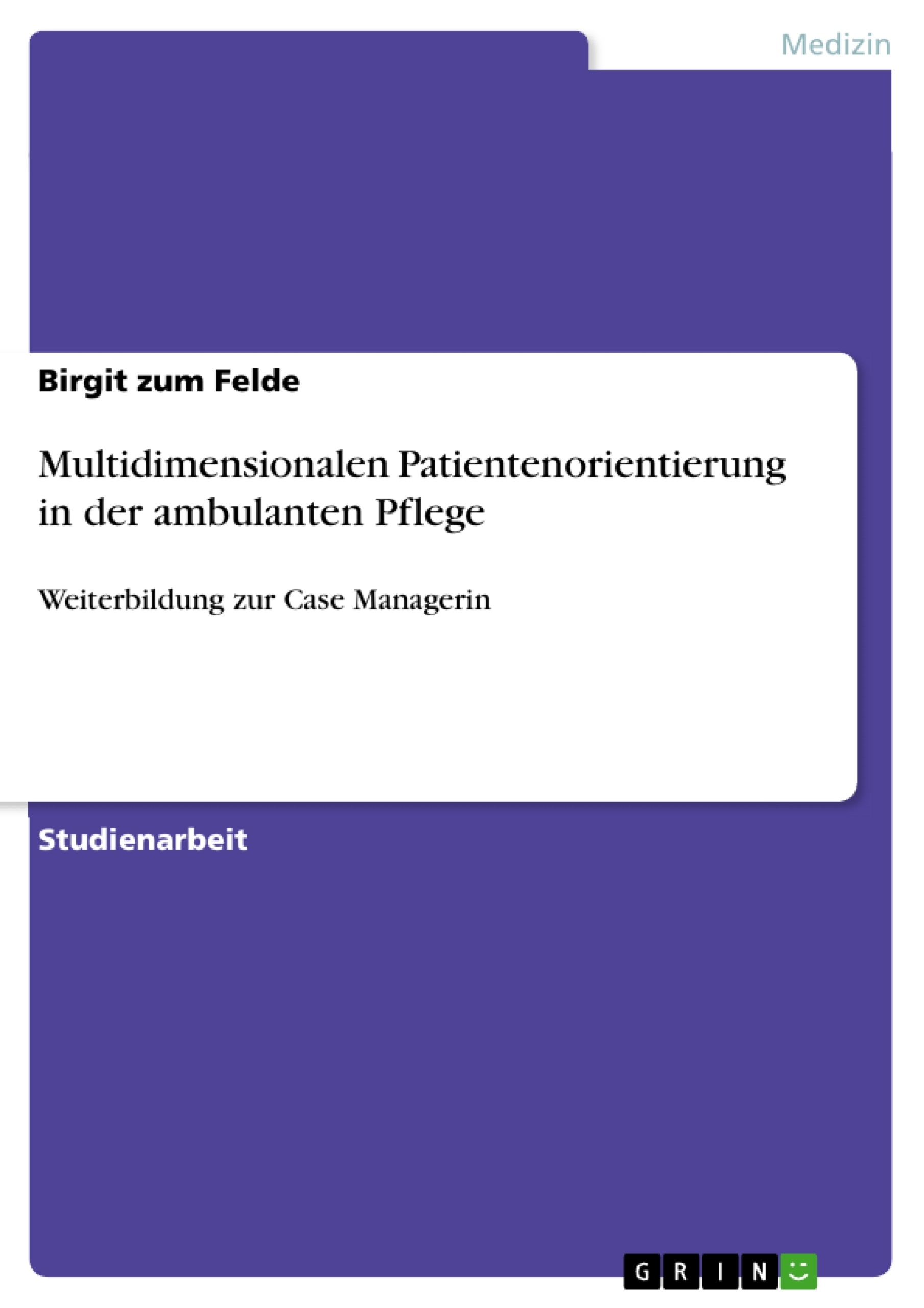Bei dem Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung gibt es verschiedene Stufen von der Patientenignorierung bis hin zur Patientenorientierung. Die Patientenignorierung zeichnet sich im Besonderen durch die reine Ablauforientierung aus. In der Hausarbeit wird zunächst der Arbeitsbereich in dem die Untersuchung durchgeführt wurde vorgestellt. Danach wird das Modell der multidimensionalen Patientenorientierung ausführlich und anhand von Beispielen vorgestellt. Im weiteren Verlauf wird ein Fallbeispiel aus der Praxis beschrieben und ausgewertet. Am Ende kommt es zu einer Bewertung und Empfehlung für die Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung
- 2.1 Ablauforientierung
- 2.2 Verrichtungsorientierung
- 2.3 Symptomorientierung
- 2.4 Krankheitsorientierung
- 2.5 Verhaltensorientierung
- 2.6 Erlebnis-, Existenz- und Begegnungsorientierung
- 2.7 Handlungsorientierung
- 2.7.1 Biographiearbeit
- 2.7.2 Validation
- 2.7.3 Psychobiographisches Modell nach Prof. Erwin Böhm
- 2.7.4 DMC = Dementia Care Mapping
- 2.8 Verständigungsorientierung
- 2.8.1 Kognitive Kompetenz
- 2.8.2 Sprachlich-kommunikative Kompetenz
- 2.8.3 Soziale Kompetenz
- 2.8.4 Moralisches Bewusstsein und moralische Urteilsfähigkeit
- 3. Kompetenzstufen
- 3.1 Modell Dreyfus/Dreyfus
- 3.1.1 Das Novizenstadium
- 3.1.2 Fortgeschrittener Anfänger
- 3.1.3 Kompetenz
- 3.1.4 Gewandtheit
- 3.1.5 Experte
- 3.2 Das Dreyfus Modell übertragen auf die Pflege
- 3.2.1 Neuling/Anfänger
- 3.2.2 Fortgeschrittener Anfänger
- 3.2.3 Kompetente Pflegekraft
- 3.2.4 Erfahrene Pflegekraft
- 3.2.5 Pflegeexperte
- 3.1 Modell Dreyfus/Dreyfus
- 4. Bereiche der Pflegepraxis
- 5. Beschreibung der Pflegekraft
- 5.1 Beschreibung der Kundin
- 5.2 Beschreibung der Situation
- 6. Analyse hinsichtlich des Grades der Patientenorientierung
- 6.1 Analyse der Kompetenzstufe
- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.1 Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung in der Pflege. Sie analysiert verschiedene Aspekte der Patientenorientierung und untersucht, wie sich diese in der Praxis umsetzen lassen.
- Das Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung
- Verschiedene Stufen der Patientenorientierung
- Die Bedeutung von Kompetenzstufen in der Pflege
- Analyse eines Praxisbeispiels im Bereich der ambulanten Pflege
- Relevanz von Schlüsselqualifikationen für die Pflegekraft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt den Leser in die Thematik der multidimensionalen Patientenorientierung ein. Es beschreibt den Kontext der Arbeit und die Ziele, die mit dieser Arbeit verfolgt werden.
- Kapitel 2: Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung: Dieses Kapitel erläutert das Konzept der multidimensionalen Patientenorientierung. Es werden verschiedene Ansätze und Dimensionen der Patientenorientierung vorgestellt, die von der Ablauforientierung bis hin zur Handlungs- und Verständigungsorientierung reichen.
- Kapitel 3: Kompetenzstufen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema der Kompetenzstufen in der Pflege. Es wird das Modell von Dreyfus/Dreyfus vorgestellt und auf die Pflegepraxis übertragen. Es werden verschiedene Kompetenzstufen der Pflegekräfte erläutert, vom Novizen bis zum Experten.
- Kapitel 4: Bereiche der Pflegepraxis: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Bereiche der Pflegepraxis und zeigt auf, wie die Patientenorientierung in diesen Bereichen umgesetzt werden kann.
- Kapitel 5: Beschreibung der Pflegekraft: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel aus der ambulanten Pflege. Es werden die Kundin und die Situation in der Pflege beschrieben.
- Kapitel 6: Analyse hinsichtlich des Grades der Patientenorientierung: Dieses Kapitel analysiert den Grad der Patientenorientierung im Praxisbeispiel. Es wird die Kompetenzstufe der Pflegekraft anhand des 5-Stufen-Modells von Patricia Benner und Karin Wittneben analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind multidimensionale Patientenorientierung, Kompetenzstufen, Pflegepraxis, ambulante Pflege, Schlüsselqualifikationen, 5-Stufen-Modell, Patricia Benner, Karin Wittneben, Dreyfus/Dreyfus Modell.
- Citation du texte
- Birgit zum Felde (Auteur), 2008, Multidimensionalen Patientenorientierung in der ambulanten Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146759