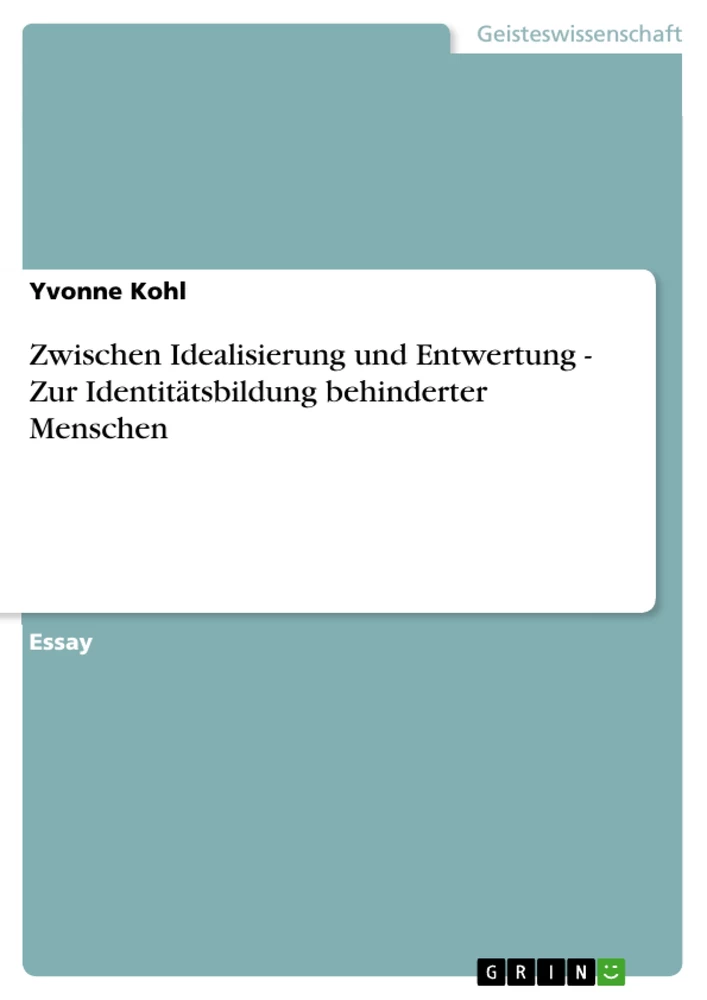Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und Akzeptanz des eigenen Körpers von Menschen mit Behinderungen wirft viele Fragen auf. Wie meistern die Menschen den Übergang von eigenen befremdlichen Gefühlen sich selbst gegenüber bis hin zur Akzeptanz und Annahme? Wie gehen sie damit um, wenn sie feststellen, dass sie einer chronischen Krankheit unterliegen, Opfer eines Unfalls sind und mit daraus resultierenden Folgen zu kämpfen haben. Wie stellt sich ihre Sichtweise dar, hinsichtlich einer angeborenen Einschränkung, die oftmals von außen einer negativen Stigmatisierung unterliegt? Welche Prozesse sind dafür verantwortlich, dass sie sich gegenüber gesellschaftlichen Dogmen und Herausforderungen emanzipieren. Eine "positive Identitätsfindung" ist die Herausforderung, der sich in diesem Text gewidmet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Idealisierung und Entwertung
- Identitätsbildung und Behinderung
- Stigmatisierung und gesellschaftliche Wahrnehmung
- Wertetransformation und Akzeptanz
- Emanzipation und Teilhabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Identitätsbildung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere die Herausforderungen und Konflikte, die im Spannungsfeld zwischen Idealisierung und Entwertung entstehen. Ziel ist es, die komplexen Prozesse der Selbstfindung und -akzeptanz zu beleuchten und gängige gesellschaftliche Missverständnisse zu thematisieren.
- Konfliktbehaftete Identitätsbildung bei Menschen mit Behinderungen
- Stigmatisierung und der Einfluss gesellschaftlicher Normen
- Die Rolle von Idealisierung und Entwertung in der Selbstwahrnehmung
- Wertetransformation als Weg zur Akzeptanz und Selbstbestimmung
- Emanzipation und die Bedeutung von Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
Zwischen Idealisierung und Entwertung: Dieser einleitende Abschnitt führt in die Thematik der Identitätsbildung bei Menschen mit Behinderungen ein. Er stellt die zentralen Fragen nach dem Umgang mit eigenen Gefühlen, der Akzeptanz der eigenen Behinderung und den Prozessen der Emanzipation von gesellschaftlichen Vorurteilen. Der Text betont die Bedeutung einer positiven Identitätsfindung als Herausforderung. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Modellen und empirischen Befunden.
Identitätsbildung und Behinderung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Konzepte der Identitätsbildung, insbesondere die krisenhafte Identitätsbildung nach Erikson und den Gegenentwurf einer Passungsarbeit. Es wird argumentiert, dass diese traditionellen Modelle nicht ausreichend die Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen abbilden und die stereotypischen Erwartungen der Gesellschaft oft eine Barriere für eine positive Identitätsentwicklung darstellen. Der Abschnitt verdeutlicht die Notwendigkeit spezifischerer Ansätze zur Betrachtung der Identitätsentwicklung von Menschen mit Behinderungen.
Stigmatisierung und gesellschaftliche Wahrnehmung: Dieser Teil befasst sich mit dem Konzept des Stigmas nach Goffman und dessen Bedeutung im Kontext von Behinderung. Er verdeutlicht, wie gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen die Wahrnehmung von Behinderung beeinflussen und zu Diskrepanzen zwischen virtueller und aktueller sozialer Identität führen. Der Abschnitt beleuchtet, wie negative Stereotype und Mythen die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderungen beeinträchtigen und zu Ausgrenzung und sozialer Isolation führen können. Es werden historische Beispiele angeführt, um den langfristigen Einfluss solcher Stigmatisierungen aufzuzeigen.
Wertetransformation und Akzeptanz: Das Kapitel widmet sich der Theorie des "value change" nach Beatrice Wright. Der Schwerpunkt liegt auf der Akzeptanz der Behinderung als Grundlage für eine positive Identitätsentwicklung. Es wird argumentiert, dass die Transformation von Werten und Prioritäten notwendig ist, um Minderwertigkeitsgefühle, Scham und Angst abzubauen. Das Kapitel betont die Bedeutung von Anstrengung und Engagement anstatt alleiniger Leistungsfähigkeit und die Möglichkeit, die Behinderung selbst als neuen Wert zu integrieren. Jedoch wird auch die Schwierigkeit und der Idealismus dieser Vorstellung angesprochen, da gesellschaftliche Normen und Wertschätzung eng miteinander verwoben sind.
Emanzipation und Teilhabe: Der letzte beschriebene Abschnitt des Textes behandelt die emanzipierte Identität von Menschen mit Behinderungen. Er beschreibt den Prozess der Abgrenzung von gesellschaftlichen Erwartungen und den Aufbau einer Identität, die über die Behinderung hinausgeht. Die Bedeutung von Anerkennung und Selbstbestimmung wird betont. Jedoch wird auch kritisch hinterfragt, inwieweit die angestrebte Autonomie durch die Abhängigkeit von Anerkennung durch nicht-behinderte Menschen eingeschränkt werden kann. Der Text plädiert für eine Veränderung gesellschaftlicher Grundauffassungen und Normen, um eine echte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Identitätsbildung, Behinderung, Stigmatisierung, gesellschaftliche Normen, Wertetransformation, Akzeptanz, Emanzipation, Teilhabe, Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl, Idealisierung, Entwertung, Goffman, Wright.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Identitätsbildung von Menschen mit Behinderungen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der Identitätsbildung von Menschen mit Behinderungen. Er analysiert die Herausforderungen und Konflikte, die im Spannungsfeld zwischen Idealisierung und Entwertung entstehen, und beleuchtet die komplexen Prozesse der Selbstfindung und -akzeptanz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Der Text behandelt zentrale Themen wie konfliktbehaftete Identitätsbildung, Stigmatisierung durch gesellschaftliche Normen, den Einfluss von Idealisierung und Entwertung auf die Selbstwahrnehmung, Wertetransformation als Weg zur Akzeptanz und Selbstbestimmung sowie Emanzipation und die Bedeutung von Teilhabe.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: "Zwischen Idealisierung und Entwertung" (Einführung in die Thematik), "Identitätsbildung und Behinderung" (Analyse von Identitätsbildungskonzepten im Kontext von Behinderung), "Stigmatisierung und gesellschaftliche Wahrnehmung" (der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Stereotype), "Wertetransformation und Akzeptanz" (Akzeptanz der Behinderung als Grundlage positiver Identitätsentwicklung) und "Emanzipation und Teilhabe" (Emanzipation von gesellschaftlichen Erwartungen und Bedeutung von Teilhabe).
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Der Text bezieht sich auf verschiedene theoretische Modelle, darunter die krisenhafte Identitätsbildung nach Erikson, das Konzept der Passungsarbeit, Goffmans Stigmatisierungs-Theorie und Wrights Theorie des "value change".
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text betont die Notwendigkeit spezifischerer Ansätze zur Betrachtung der Identitätsentwicklung von Menschen mit Behinderungen. Er zeigt auf, wie gesellschaftliche Normen und Stereotype die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl negativ beeinflussen können und plädiert für eine Wertetransformation und eine Veränderung gesellschaftlicher Grundauffassungen, um eine echte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Identitätsbildung, Behinderung, Stigmatisierung, gesellschaftliche Normen, Wertetransformation, Akzeptanz, Emanzipation, Teilhabe, Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl, Idealisierung, Entwertung, Goffman, Wright.
Für wen ist der Text gedacht?
Der Text ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Thematik der Identitätsbildung von Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen möchte. Die Informationen dienen der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Die Informationen in diesem FAQ basieren auf einer Textvorschau. Der vollständige Text ist separat erhältlich.
- Citar trabajo
- Yvonne Kohl (Autor), 2010, Zwischen Idealisierung und Entwertung - Zur Identitätsbildung behinderter Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146884