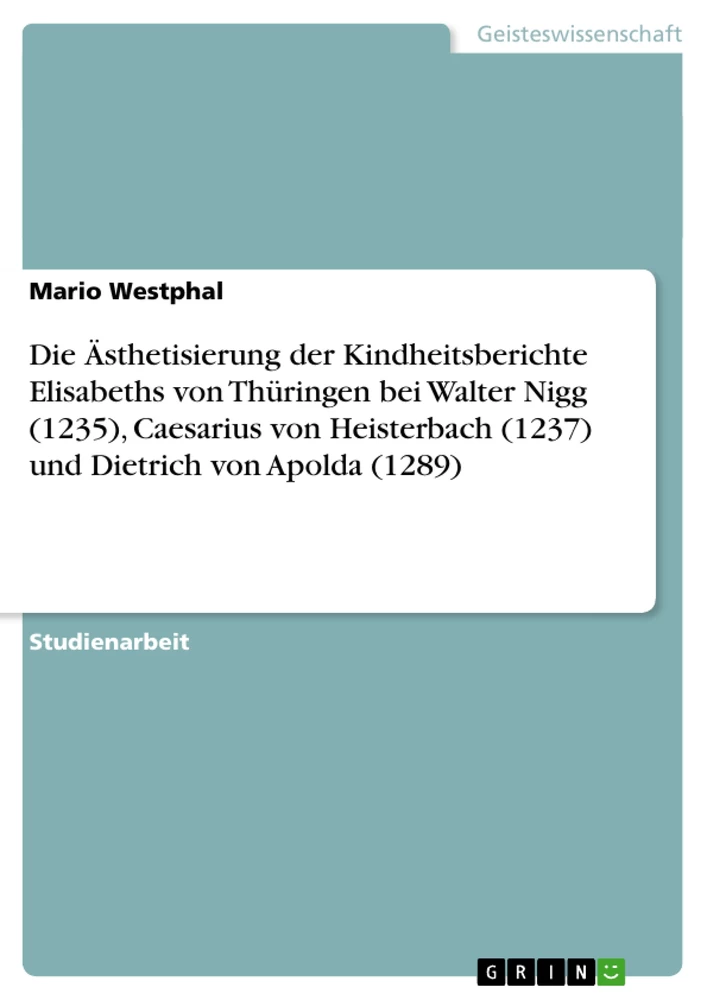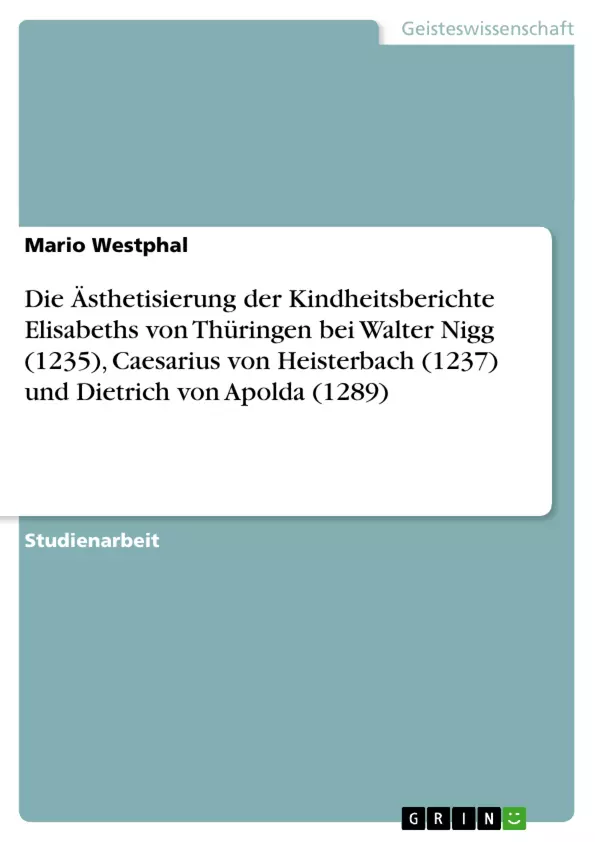Heiligenviten waren im Mittelalter keine Seltenheit und spielten für den Heiligsprechungsprozess eines Menschen eine wichtige Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie verschiedene Autoren die Lebensgeschichte Elisabeths von Thüringen (1207-1231) verfassten. Dafür wird auf den Begriff der "Ästhetisierung" von Anja Besand und Martin Seel zurückgegriffen, welche zu Beginn der Arbeit vorgestellt und für den Zweck derselben bereitet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Die Begriffe „Ästhetik“ und „Ästhetisierung“
- Die Kindheitserzählung bei Walter Nigg (1235)
- Allgemeines zur Kindheitserzählung Walter Niggs
- Biografische Daten zu Konrad von Marburg
- „Über den Lebenswandel der sel. Elisabeth als Kind, junges Mädchen und Jungfrau“
- Die Kindheitserzählung bei Caesarius von Heisterbach (1236)
- Zur Biografie von Caesarius von Heisterbach
- Elisabeths Kindheit aus der Sicht Heisterbach
- Die Kindheitserzählung bei Dietrich von Apolda (1289)
- Zur Biografie von Dietrich von Apolda
- „Von Elisabeths wundersamer, unschuldiger Kindheit“
- Zusammenfassung und Rückschlüsse
- Literaturliste
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Ästhetisierung der Kindheitsberichte Elisabeths von Thüringen in den Werken von Walter Nigg (1235), Caesarius von Heisterbach (1237) und Dietrich von Apolda (1289). Sie untersucht, wie die Autoren die Kindheit Elisabeths darstellen und welche Intentionen sie dabei verfolgen. Die Arbeit betrachtet die politischen Hintergründe und die Biografien der Autoren, um die Ästhetisierung der Kindheitsberichte besser zu verstehen.
- Die Entwicklung der Kindheitsgeschichte Elisabeths von Thüringen
- Die Intentionen der Autoren bei der Darstellung der Kindheit Elisabeths
- Die Rolle der Ästhetisierung in der Heiligenvita
- Die politischen Hintergründe der Kindheitsberichte
- Die Biografien der Autoren und ihre Einfluss auf die Darstellung der Kindheit Elisabeths
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Begriffe „Ästhetik“ und „Ästhetisierung“ und zeigt, wie diese im Kontext der Kindheitsberichte Elisabeths von Thüringen relevant sind. Das zweite Kapitel analysiert die Kindheitserzählung von Walter Nigg (1235) und beleuchtet die biografischen Daten von Konrad von Marburg, der eine wichtige Rolle im Heiligsprechungsprozess Elisabeths spielte. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kindheitserzählung von Caesarius von Heisterbach (1236) und stellt die Biografie von Caesarius von Heisterbach vor. Das vierte Kapitel untersucht die Kindheitserzählung von Dietrich von Apolda (1289) und beleuchtet die Biografie von Dietrich von Apolda.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ästhetisierung, die Kindheitsgeschichte, die Heiligenvita, Elisabeth von Thüringen, Walter Nigg, Caesarius von Heisterbach, Dietrich von Apolda, politische Hintergründe, Biografien, Intentionen, Heiligsprechungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Elisabeth von Thüringen?
Elisabeth von Thüringen (1207-1231) war eine ungarische Prinzessin und Landgräfin von Thüringen, die für ihre Wohltätigkeit bekannt wurde und kurz nach ihrem Tod heiliggesprochen wurde.
Was bedeutet "Ästhetisierung" in Bezug auf Heiligenviten?
In dieser Arbeit meint Ästhetisierung die bewusste literarische Gestaltung und Überhöhung von Lebensberichten, um bestimmte religiöse oder politische Botschaften zu vermitteln.
Welche Autoren werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit analysiert die Berichte von Walter Nigg (1235), Caesarius von Heisterbach (1237) und Dietrich von Apolda (1289).
Welche Rolle spielte Konrad von Marburg?
Konrad von Marburg war Elisabeths Beichtvater und eine zentrale Figur in ihrem Heiligsprechungsprozess. Sein Einfluss auf ihre Lebensgeschichte wird in der Arbeit beleuchtet.
Warum sind die Kindheitsberichte für die Forschung relevant?
Die Darstellungen der "wundersamen Kindheit" dienten dazu, die spätere Heiligkeit bereits früh zu legitimieren und politische Interessen der jeweiligen Orden oder Regionen zu stützen.
- Citar trabajo
- Mario Westphal (Autor), 2007, Die Ästhetisierung der Kindheitsberichte Elisabeths von Thüringen bei Walter Nigg (1235), Caesarius von Heisterbach (1237) und Dietrich von Apolda (1289), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146915