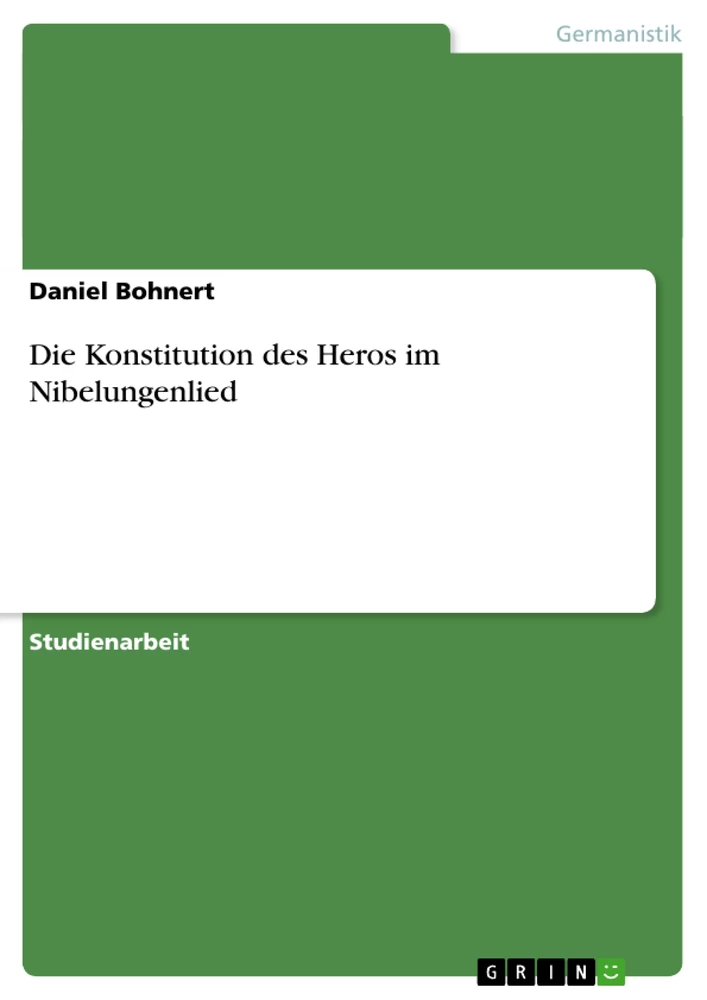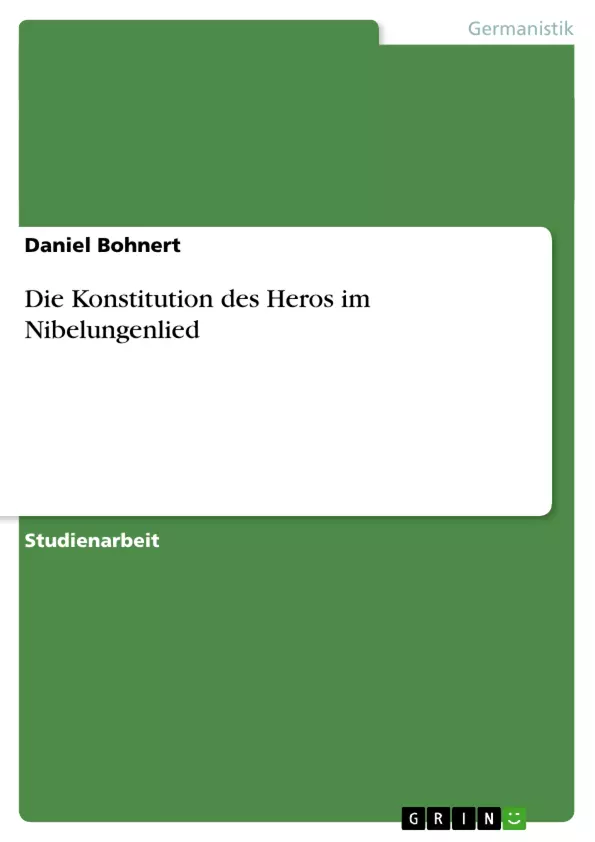Die heroic ages sind in der Regel Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, welche Helden eine Bühne offerieren. Die heroische Überlieferung knüpft an fiktive historische Ereignisse, welchen eine fundamentale Bedeutung für die Genese einer Gemeinschaft zugesprochen werden oder einmal wurden, reduziert diese auf elementare menschliche Konflikte und Affekte und überführt sie in traditionelle Erzählschemata. Das Essentielle ist, dass Heldensage auf die kollektiven Erinnerungen einer Gemeinschaft rekurriert und damit die formative Funktion erfüllt, Identität zu stiften. Daraus ergibt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Held und Kollektiv. Dient der Heros verbindlichen gesellschaftlichen Regulativen? Oder ist er gerade keinem ethischen Normen- und Wertesystem verpflichtet? Die eingangs dargestellte Situation am Wormser Königshof verweist bereits auf einen rücksichtslosen, ungebundenen und selbstmächtigen Helden. Hingegen scheint es den Burgunden zu gelingen den übermütigen Siegfried zunächst innerhalb der höfischen Welt zu zähmen. In diesem Zuge ist die Signifikanz des bereits angedeuteten Antagonismus zwischen heroischem und höfischem Diskurs zu untersuchen. Welche Spannungen erzeugt dieser Chiasmus? Welche Bedeutung haben die offensichtlichen Brüche innerhalb des Epos? Und schließlich bleibt zu klären, inwiefern die Konstitution des Heroischen im Nibelungenlied im Zusammenhang mit dem “entsetzlichen Untergang” steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Diskrepanzen innerhalb der höfisch-idealisierten Ordnung
- Gratwanderungen: Ein Blick in die Forschungsgeschichte
- Der Antagonismus zwischen Heros und höfischer Ordnung
- "diese degene müezen verliesen den lîp.": Die Aporie des Heroischen
- Konkretisierung der Heldenkonzeption im Nibelungenlied
- Resümee: Die Degeneration der höfisch-idealisierten Gesellschaft
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Konstitution des Heroischen im Nibelungenlied und analysiert die Rolle des Helden im Kontext der höfisch-idealisierten Ordnung. Sie befasst sich mit der Frage, wie der Held in das gesellschaftliche Gefüge eingebunden ist und welche Spannungen zwischen heroischem und höfischem Diskurs entstehen.
- Die Konstitution des Heroischen im Nibelungenlied
- Der Antagonismus zwischen Heros und höfischer Ordnung
- Die Aporie des Heroischen
- Die Degeneration der höfisch-idealisierten Gesellschaft
- Die Rezeption des Nibelungenliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Heroischen im Nibelungenlied vor und beleuchtet die Diskrepanzen zwischen dem Helden und der höfisch-idealisierten Ordnung. Sie führt in die Forschungsgeschichte ein und zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf das Heldenepos. Das zweite Kapitel beleuchtet die Forschungsgeschichte des Nibelungenliedes und diskutiert die unterschiedlichen Ansätze zur Interpretation des Epos. Das dritte Kapitel analysiert den Antagonismus zwischen dem Helden und der höfischen Ordnung und untersucht die Spannungen, die durch diese Konfrontation entstehen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Aporie des Heroischen und analysiert die Ambivalenz des Heldenbildes. Das fünfte Kapitel untersucht die Konkretisierung der Heldenkonzeption im Nibelungenlied und analysiert die spezifischen Eigenschaften des Helden. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und beleuchtet die Degeneration der höfisch-idealisierten Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Helden, das Nibelungenlied, die höfisch-idealisierte Ordnung, den Antagonismus, die Aporie des Heroischen, die Degeneration der Gesellschaft, die Forschungsgeschichte und die Rezeption des Epos.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Untersuchung zum Nibelungenlied?
Die Arbeit analysiert die Konstitution des Heroischen und den Antagonismus zwischen dem rücksichtslosen Helden (z. B. Siegfried) und der höfisch-idealisierten Ordnung.
Welche Funktion hat die Heldensage für eine Gemeinschaft?
Die Heldensage rekurriert auf kollektive Erinnerungen und erfüllt eine formative Funktion, indem sie Identität für die Gemeinschaft stiftet.
Was versteht man unter der "Aporie des Heroischen"?
Damit ist die Ambivalenz und Unlösbarkeit der Spannungen gemeint, die entstehen, wenn heroische Tugenden mit den Regeln der höfischen Gesellschaft kollidieren.
Wie endet die Konfrontation zwischen Heldentum und höfischer Welt?
Die Untersuchung beleuchtet die "Degeneration" der höfischen Gesellschaft, die letztlich im "entsetzlichen Untergang" der Nibelungen mündet.
Dient der Held im Nibelungenlied ethischen Normen?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob der Heros an gesellschaftliche Regulative gebunden ist oder ob er als selbstmächtiger Akteur außerhalb dieser Systeme steht.
- Citar trabajo
- Daniel Bohnert (Autor), 2009, Die Konstitution des Heros im Nibelungenlied, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146960