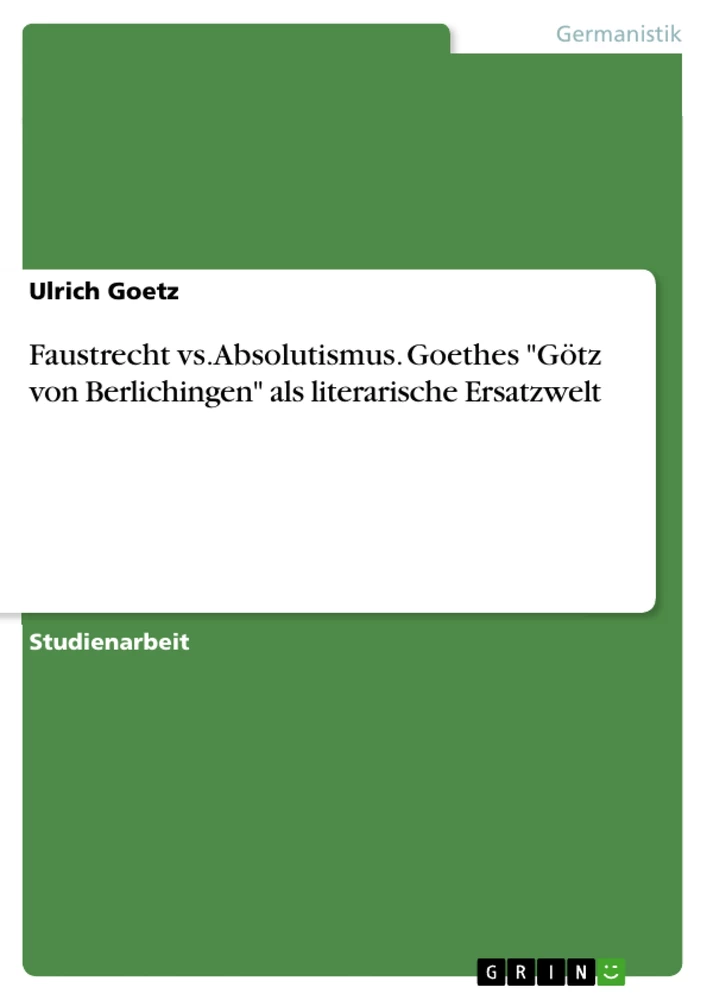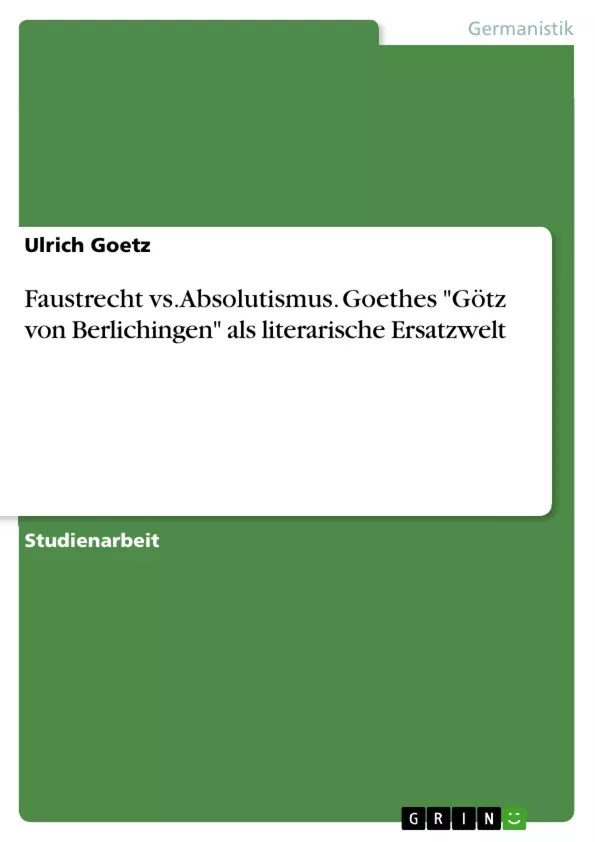Mit der Publikation des Götz von Berlichingen (1773) legt Goethe nicht nur sein dramatisches Debüt vor; er leitet damit zugleich die Epoche des Sturm und Drang ein. Das Stück bricht mit den gängigen Konventionen seiner Zeit und erfüllt eine wichtige Funktion hinsichtlich der sozialen Umbrüche, welche Goethes Generation unmittelbar betreffen. Walter Hinderer entwickelt in diesem Kontext die These einer literarischen Ersatzwelt:
„Wenn sich von Wieland und Herder über Goethe und Lenz bis hin zu Schiller ein ästhetisches Programm zu einer Art psychischen und politischen Diätetik herausbildet, so handelt es sich hier zweifelsohne um Projektionen, die reale Defizite abdecken sollen. Der Bürger konnte zwar Verdienste erwerben und seinen Geist ausbilden, wie Goethe in Wilhelm Meister erklärte, aber seine Persönlichkeit ging verloren in einer Welt, in der ausschließlich der Adel die Öffentlichkeit repräsentierte. Deshalb wurden Theater und Literatur für diese Generation zu einer Ersatzwelt.“
Indem Goethe sein Debüt veröffentlicht, leistet er Pionierarbeit, was das Konstruieren besagter Ersatzwelten betrifft. Zugleich geht er mit dem Verfassen des Götz über einen reinen Eskapismus hinaus, denn er koppelt seine Ersatzwelt an die radikalindividualistische Interpretation des spätmittelalterlichen „Faustrechts“ durch den Juristen Justus Möser.
Das Ziel dieser Arbeit besteht folglich darin, die Relation zwischen Hinderers Ersatzwelt-These und der Allegorie des „Faustrechts“ auszudifferenzieren, um eine brauchbare Erklärung für die unkonventionelle Struktur und den bahnbrechenden Erfolg von Goethes Debüt zu liefern.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HAUPTTEIL
- Der junge Goethe: Ein Musterbeispiel kreativer Intelligenz
- Vom,,Muttersöhnchen“ zum „Meister“: Goethe als Genie
- Goethes Reflexion
- Goethes Ausspielen seiner eigenen Stärken
- Goethes sinnvolles Bewältigen von Erfahrung
- Shakespeare, Biographisches und Autobiographisches
- Justus Mösers Von dem Faustrecht als ideologische Richtlinie
- Auswirkung der ideologischen Richtlinie auf die Dramaturgie des Götz
- Die Genese des Erfolgs
- Der junge Goethe: Ein Musterbeispiel kreativer Intelligenz
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Goethes Drama Götz von Berlichingen und untersucht die Beziehung zwischen der literarischen Ersatzwelt, die Goethe in seinem Debütwerk schafft, und der ideologischen Richtlinie des „Faustrechts“, die der Jurist Justus Möser propagiert. Ziel ist es, die unkonventionelle Struktur und den bahnbrechenden Erfolg des Götz zu erklären, indem die Verbindung zwischen Hinderers Ersatzwelt-These und der Allegorie des „Faustrechts“ analysiert wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Goethe-Biographie von Karlheinz Schulz und des Stückes selbst, wobei der Geniebegriff und das Modell der „kreativen Intelligenz“ von Howard Gardner herangezogen werden.
- Die literarische Ersatzwelt als Reaktion auf soziale Missstände
- Die Rolle des „Faustrechts“ als ideologische Richtlinie
- Goethes kreative Intelligenz und seine Entwicklung zum „Meister“
- Die Bedeutung von Reflexion, Stärken ausspielen und Erfahrungsbewältigung für Goethes Schaffen
- Die Genese des Erfolgs von Götz von Berlichingen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goethes Götz von Berlichingen als literarisches Debüt und Wegbereiter des Sturm und Drang vor. Sie führt die These von Walter Hinderer ein, der das Drama als literarische Ersatzwelt interpretiert, die auf die sozialen Defizite der Zeit reagiert. Der Götz wird als Ausdruck eines radikalindividualistischen „Faustrechts“ verstanden, das ein Ideal der „Selbsthilfe“ vermittelt und an die Zeitgenossen Goethes gerichtet ist, die die absolutistischen Machtstrukturen ablehnen.
Der Hauptteil beginnt mit einer Analyse des jungen Goethe als Musterbeispiel kreativer Intelligenz. Es wird gezeigt, wie Goethe durch seine misslungenen Imitationen konventioneller Literatur gezwungen war, sein Schreibtalent in einer neuen Form von Dramaturgie zum Ausdruck zu bringen. Seine kreative Synthese aus Fiktion, historischen Ereignissen, autobiographischen Versatzstücken und der unkonventionellen Rechtsauffassung von Justus Möser erschloss ihm ein neues Publikum, das in literarischen Ersatzwelten eine Kompensation für soziale Missstände suchte. Die Analyse stützt sich auf die Goethe-Biographie von Karlheinz Schulz und das Entwicklungsmodell des „Meisters“ von Howard Gardner.
Im weiteren Verlauf des Hauptteils werden die Einflüsse von Shakespeare, die biographischen und autobiographischen Elemente im Götz sowie die ideologische Richtlinie des „Faustrechts“ von Justus Möser untersucht. Es wird gezeigt, wie die Dramaturgie des Götz von dieser ideologischen Richtlinie geprägt ist und wie sie ein Ideal der Freiheit und Unabhängigkeit vermittelt. Schließlich wird die Genese des Erfolgs von Götz von Berlichingen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Götz von Berlichingen, Sturm und Drang, literarische Ersatzwelt, Faustrecht, Justus Möser, kreative Intelligenz, Howard Gardner, Karlheinz Schulz, Freiheit, Unabhängigkeit, soziale Missstände, absolutistische Machtstrukturen, Dramaturgie, Genese des Erfolgs.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt "Götz von Berlichingen" als literarische Ersatzwelt?
Nach Walter Hinderer schufen Theater und Literatur für das Bürgertum eine Welt, in der Persönlichkeit und Freiheit möglich waren, da der Adel die reale Öffentlichkeit dominierte.
Welche Rolle spielt das "Faustrecht" im Stück?
Goethe nutzt das spätmittelalterliche Faustrecht als Allegorie für Radikalindividualismus und Selbsthilfe gegen absolutistische Machtstrukturen.
Wie beeinflusste Justus Möser Goethes Debüt?
Mösers Interpretation des Faustrechts diente Goethe als ideologische Richtlinie für die unkonventionelle Dramaturgie seines Stücks.
Was kennzeichnet Goethes "kreative Intelligenz" in dieser Phase?
Goethe bewältigte persönliche Erfahrungen durch eine Synthese aus Fiktion, Geschichte und Autobiographie, was zum bahnbrechenden Erfolg des Werks führte.
Warum war der "Götz" so erfolgreich beim zeitgenössischen Publikum?
Das Stück brach mit Konventionen und bot eine Identifikationsfigur für die Generation des Sturm und Drang, die nach Freiheit und Unabhängigkeit strebte.
- Quote paper
- Ulrich Goetz (Author), 2010, Faustrecht vs. Absolutismus. Goethes "Götz von Berlichingen" als literarische Ersatzwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146981