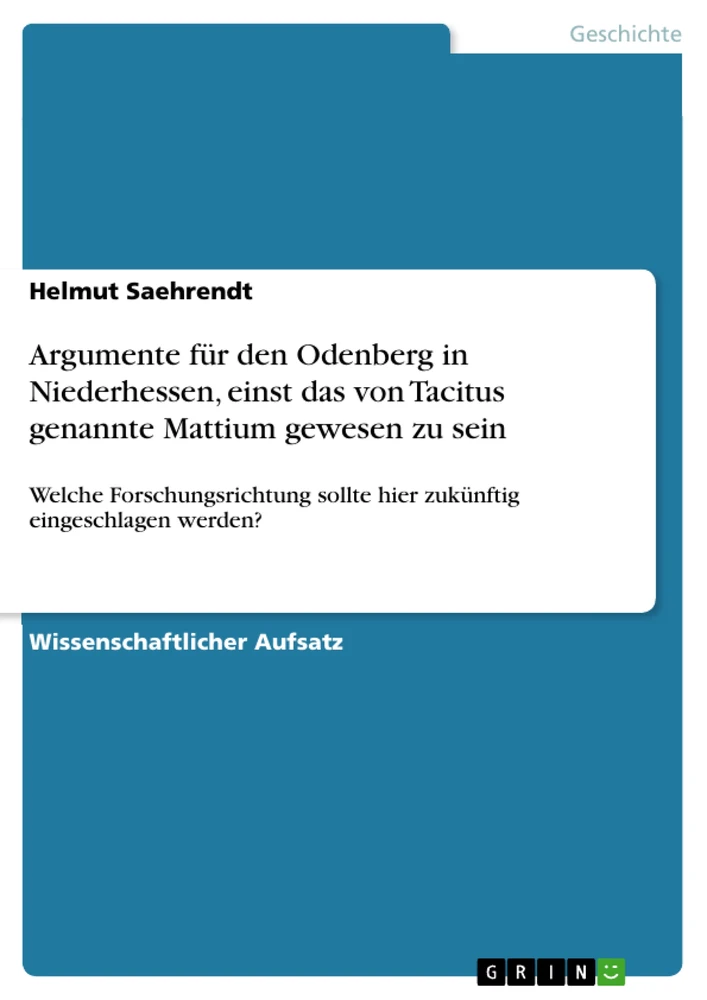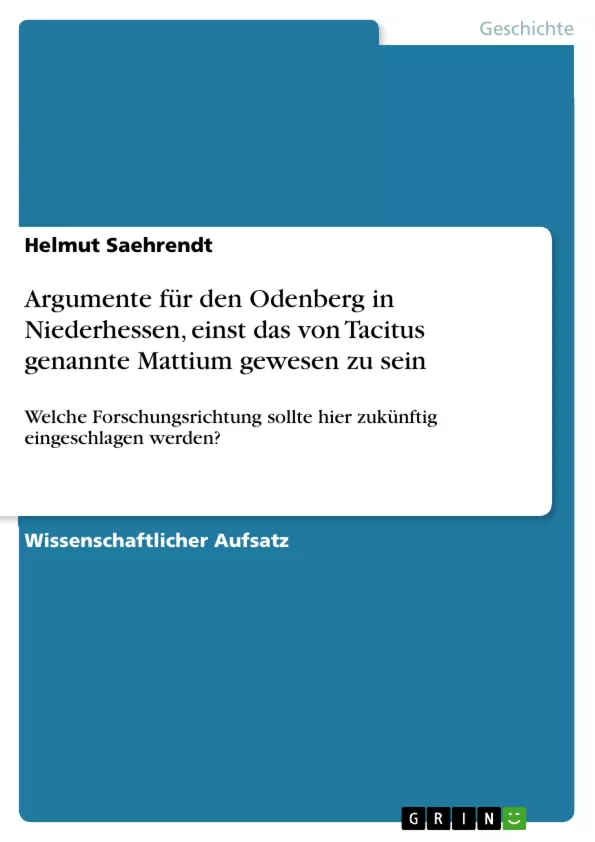Die Forschung um Mattium, eines wohl flächigen Heiligtums der Chatten im heutigen Nordhessen, ist ungemein interessant, da hier viele Bereiche und darunter auch sehr unterschiedlich geartete angesprochen werden und in den Folgerungen dann zusammenwirken. Sie findet schon seit über 200 Jahren, wenn auch mit Unterbrechungen, statt. Der Autor, der einen Überblick über die entsprechenden Diskussionen hat, beabsichtigt jetzt keineswegs diese systematisch schriftlich und zusammenfassend darzustellen. Das würde voraussichtlich in der Regel den Leser nur ermüden. Stattdessen geht er in der vorliegenden Studie der Frage nach, ob der heutige Odenberg in der Nähe des niederhessischen Städtchens Gudensberg der Ort dieses Mattiums gewesen sein kann. Dabei verwendet er Argumente aus der bisherigen öffentlichen Diskussion, aber auch eigene, die in der Vergangenheit noch nicht genannt worden sind. Er lässt keinen Zweifel daran, dass weitere diesbezügliche Forschungen am Odenberg erforderlich sind. Und nennt hierfür auch konkrete Beispiele.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Argumente für die Identifizierung des Odenbergs in Niederhessen als das von Tacitus erwähnte Mattium. Die Zielsetzung ist es, die bestehenden Forschungsansätze zu beleuchten und zukünftige Forschungsrichtungen aufzuzeigen.
- Die Schlacht im Teutoburger Wald und ihre Folgen
- Die römischen Aktivitäten in Germanien nach der Varusschlacht
- Die Lokalisierung von Mattium durch Tacitus
- Die archäologische und sprachwissenschaftliche Evidenz
- Zukünftige Forschungsansätze zur Lokalisierung von Mattium
Hinweis des Autors
Der Autor der im Grin-Verlag erschienenen Studie „Argumente für den Odenberg in Niederhessen, einst das von Tacitus genannte Mattium gewesen zu sein.“ legt Wert auf die Feststellung, dass er es nicht als seine Aufgabe ansah, etwa Themenbereiche wie die im Folgenden genannten in gewisser Ausführlichkeit und Vollständigkeit darzustellen oder gar zu diskutieren:
- Verlauf des gesamten Feldzuges des römischen Feldherren Germanicus 15 n. Chr. in Germanien.
- Sprachwissenschaftliche Analysen der Namen alter in der Gegend des nordhessischen Gudensberg gelegener Siedlungen im Hinblick auf den Namen Mattium.
- Die in langen Zeiträumen erfolgten Diskussionen bei der Suche nach Mattium in Althessen stattgefundenen Erörterungen darstellen, also auch andere Ortsvorstellungen für Mattium.
Der Verfasser der Studie, Helmut Saehrendt, hat Bereiche dieser Art nur dann mit der Entnahme von Einzelheiten verwendet, wenn diese seiner Meinung nach etwas zu der konkreten Frage aussagen, ob der Odenberg der Ort des genannten Mattiums gewesen sein könnte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. und ihren Schauplatz bei Kalkriese. Sie schildert den Verlauf der Schlacht, die strategischen Fehler der Römer unter Varus und die Folgen für das römische Reich. Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und benennt die Problematik der Lokalisierung von Mattium, einem von Tacitus erwähnten chattischen Hauptort. Sie betont die Bedeutung der präzisen Ortsbestimmung für die weitere Forschung zur römischen Besetzung Germaniens.
2. Hauptteil: Der Hauptteil konzentriert sich auf den Feldzug Germanicus' im Jahr 15 n. Chr. und dessen Bedeutung für die Lokalisierung von Mattium. Der Text analysiert die knappe Beschreibung Tacitus' und die damit verbundenen Herausforderungen für die heutige Forschung. Er diskutiert den Verlauf des Feldzugs, den Kampf gegen die Chatten und die Zerstörung von Mattium. Der Abschnitt beleuchtet die Schwierigkeiten der Quelleninterpretation und die Bedeutung der sprachwissenschaftlichen und archäologischen Analysen von Ortsnamen in der Umgebung des heutigen Gudensberg. Es werden mögliche Kandidaten für Mattium anhand der geographischen Lage und der antiken Überlieferung präsentiert.
Schlüsselwörter
Mattium, Tacitus, Germanicus, Varusschlacht, Chatten, Odenberg, Niederhessen, Römer, Germanien, Archäologie, Ortsnamenforschung, Regionalgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Lokalisierung von Mattium
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich mit der Lokalisierung von Mattium, einem von Tacitus erwähnten chattischen Hauptort in Niederhessen. Er untersucht die Argumente für die Identifizierung des Odenbergs als Mattium und beleuchtet bestehende Forschungsansätze, um zukünftige Forschungsrichtungen aufzuzeigen.
Welche Aspekte werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Varusschlacht und ihre Folgen, die römischen Aktivitäten in Germanien nach der Varusschlacht, Tacitus' Beschreibung von Mattium und die damit verbundenen Herausforderungen für die heutige Forschung, archäologische und sprachwissenschaftliche Evidenz sowie mögliche zukünftige Forschungsansätze zur Lokalisierung von Mattium. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Feldzug Germanicus' und der Analyse der Quellen, um Kandidaten für die Lage von Mattium zu präsentieren.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text stützt sich primär auf die Schriften von Tacitus und analysiert dessen knappe Beschreibung von Mattium und dem Verlauf des Feldzugs Germanicus'. Zusätzlich werden archäologische und sprachwissenschaftliche Analysen von Ortsnamen in der Umgebung des heutigen Gudensberg herangezogen.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Lokalisierung von Mattium angesprochen?
Der Text hebt die Schwierigkeiten der Quelleninterpretation hervor, die durch die knappe und teilweise mehrdeutige Beschreibung Tacitus' entstehen. Die geographische Lage und die antike Überlieferung bieten mehrere mögliche Kandidaten für Mattium, was die Lokalisierung erschwert.
Welche Methoden werden zur Lokalisierung von Mattium angewendet?
Der Text beschreibt den Einsatz von archäologischen und sprachwissenschaftlichen Methoden, insbesondere die Analyse von Ortsnamen, um die Lage von Mattium einzugrenzen. Die geographische Lage der möglichen Kandidaten wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text zieht keine definitive Schlussfolgerung zur Lokalisierung von Mattium, sondern beleuchtet die bestehenden Debatten und zeigt zukünftige Forschungsrichtungen auf. Er präsentiert verschiedene mögliche Kandidaten und betont die Notwendigkeit weiterer interdisziplinärer Forschung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Mattium, Tacitus, Germanicus, Varusschlacht, Chatten, Odenberg, Niederhessen, Römer, Germanien, Archäologie, Ortsnamenforschung, Regionalgeschichte.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in drei Kapitel gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Fazit (letzteres ist im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten).
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Wissenschaftler und Studenten der Geschichtswissenschaft, Archäologie, und der Sprachwissenschaft, insbesondere für diejenigen, die sich mit der römischen Besetzung Germaniens und der Geschichte der Chatten beschäftigen.
- Citation du texte
- Helmut Saehrendt (Auteur), 2024, Argumente für den Odenberg in Niederhessen, einst das von Tacitus genannte Mattium gewesen zu sein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1470264