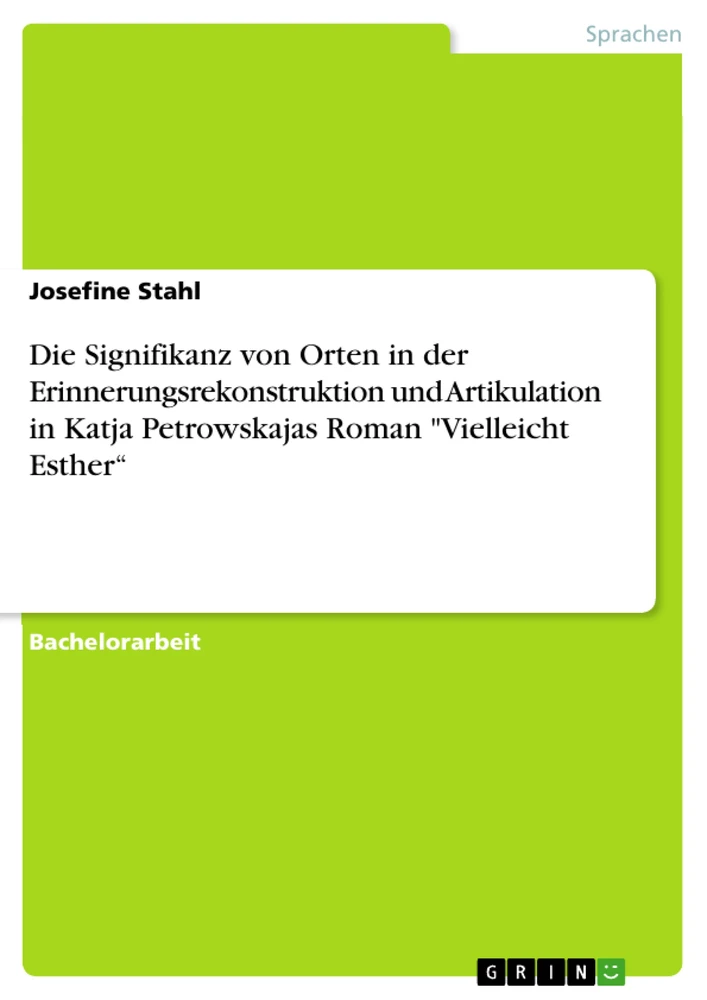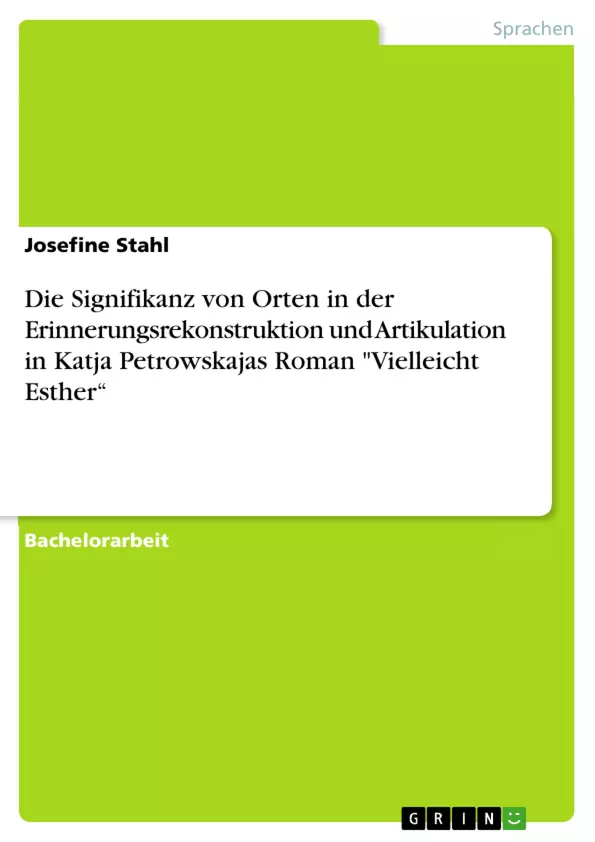Diese Arbeit untersucht die Elemente der Erinnerungstheorien genauer, und wie sie dazu führen, dass Katja Petrowskajas Roman „Vielleicht Esther“ von 2014 als „Postmemory“ nach der Theorie von Marianne Hirsch gelesen werden kann.
In dem dieser Bachelorarbeit zugrunde liegenden autobiografischen Roman über die Geschichte einer jüdischen Familie während des Holocaust sind Elemente der Theorien von Postmemory, Erinnerungsräumen und kontaminierter Landschaften wie von Marianne Hirsch, Aleida Assmann und Martin Pollack weitläufig vorzufinden.
Marianne Hirschs Theorie der Postmemory konzentriert sich auf den Effekt der Identifikation, den die Erinnerungen der Generation von Holocaustüberlebenden auf die nachfolgenden Generationen haben. Über Erzählungen, Fotografien und andere Memorabilien sowie eigener Recherchen und Reisen an die Orte entsteht in den Kinder- und Enkelgenerationen der Überlebenden eine eigene Erinnerung an die traumatischen Erlebnissen des Holocaust, die Hirsch als Postmemory bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Postmemory und „Vielleicht Esther“
- Postmemory und Fotos am Beispiel von Warschau
- Bahnhöfe und Züge
- Autofiktion nach dem Vergessen
- Kontaminierte Landschaften in Kiew
- Erinnerungsräume und -perspektiven von Berlin aus
- Zusammenfassung
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle von Orten in der Erinnerungsrekonstruktion und -artikulation in Katja Petrowskajas Roman „Vielleicht Esther“. Sie untersucht, wie die Theorie der Postmemory, insbesondere im Zusammenhang mit Fotografien, Erinnerungsräumen und kontaminierten Landschaften, zum Verständnis des Romans beiträgt.
- Postmemory als Mittel der Erinnerungsverarbeitung in der Nachfolgegeneration
- Die Bedeutung von Orten in der Rekonstruktion von Familiengeschichten
- Die Rolle von Fotografien als Erinnerungsanker
- Die Auswirkungen des Holocaust auf die folgende Generation
- Die Fragmenthaftigkeit der Erinnerung und die Suche nach Verbindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit und die Relevanz der Theorie der Postmemory für die Analyse von „Vielleicht Esther“ ein.
Das Kapitel „Postmemory und „Vielleicht Esther““ untersucht die Theorie der Postmemory und ihre Anwendung auf den Roman. Es wird insbesondere auf die Bedeutung von Fotografien als Erinnerungsanker sowie die Rolle der Orte in der Rekonstruktion der Familiengeschichte eingegangen.
Das Kapitel „Erinnerungsräume und -perspektiven von Berlin aus“ analysiert die Rolle von Berlin als Erinnerungsort im Roman.
Schlüsselwörter
Postmemory, Erinnerungsräume, kontaminierte Landschaften, Holocaust, Familiengeschichte, Fotografien, Orte, Trauma, Erinnerungsrekonstruktion, Artikulation, „Vielleicht Esther“, Katja Petrowskaja.
- Citation du texte
- Josefine Stahl (Auteur), 2020, Die Signifikanz von Orten in der Erinnerungsrekonstruktion und Artikulation in Katja Petrowskajas Roman "Vielleicht Esther“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1471195