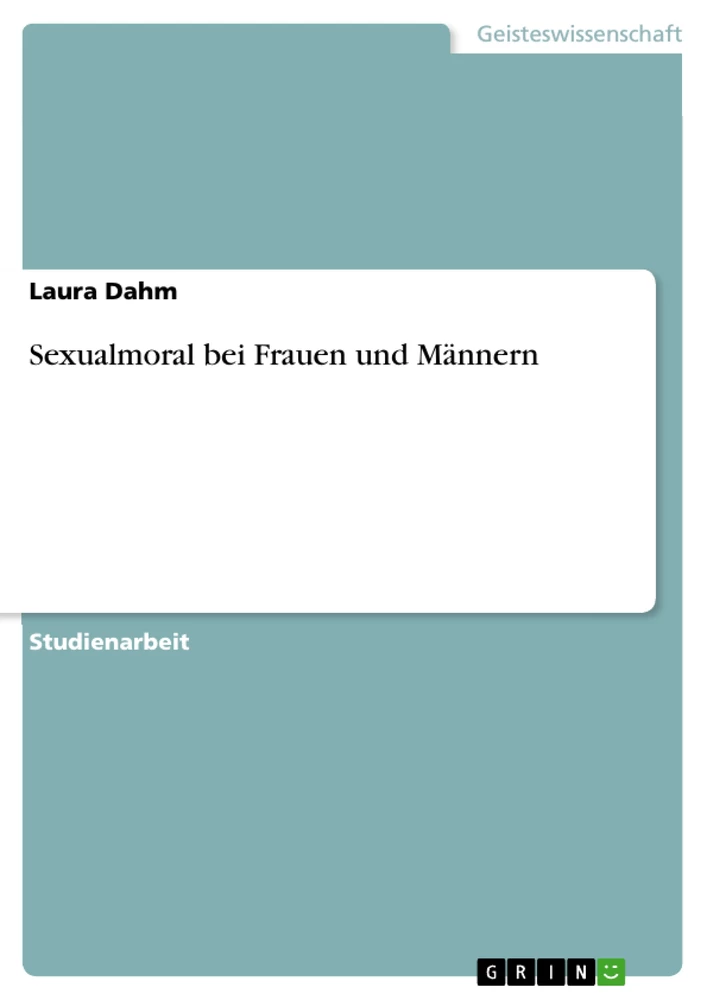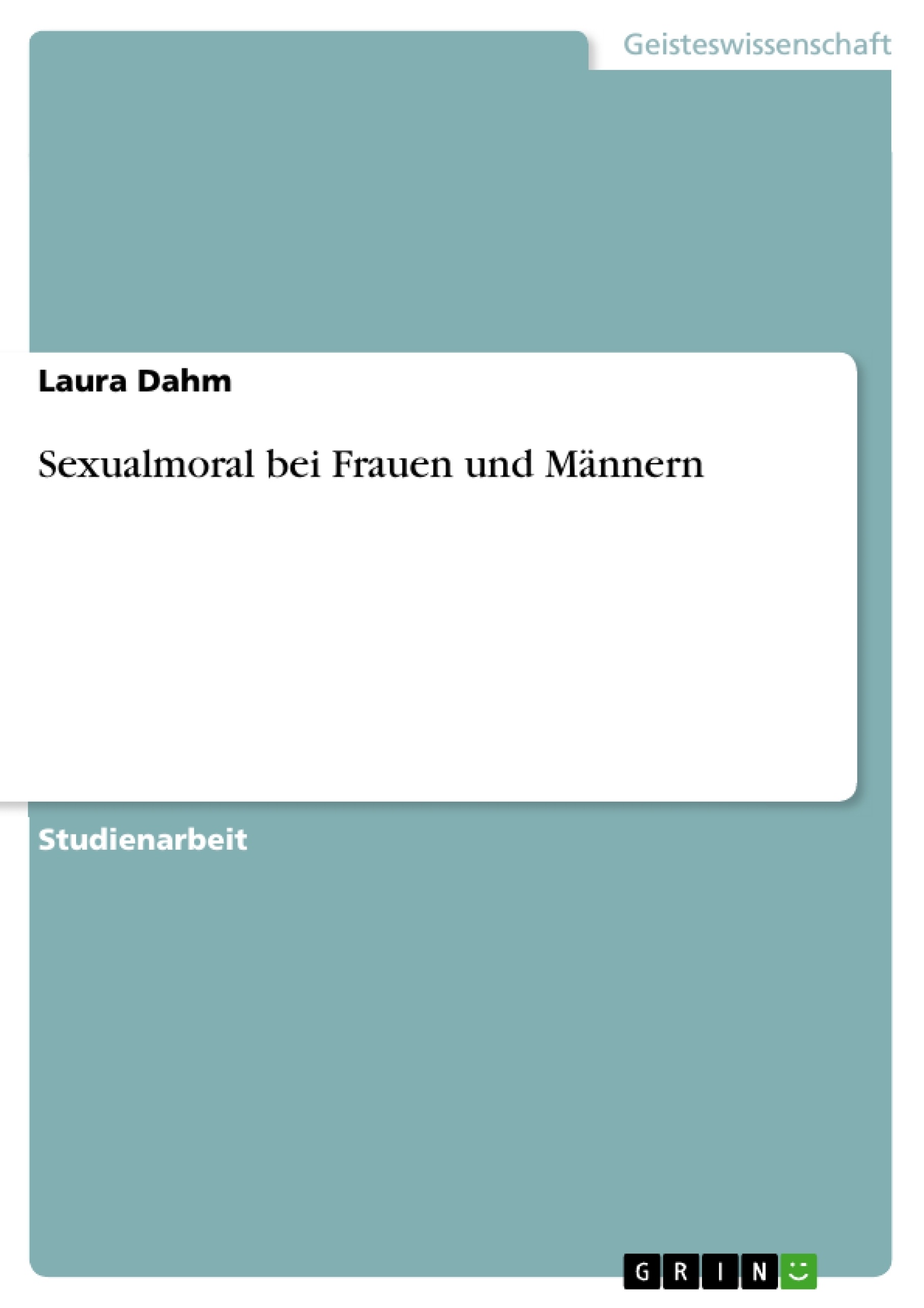Um das Thema „Frauen - Männer - Sexualmoral“ einzugrenzen, bezieht sich die folgende Arbeit auf nur drei Aspekte dieses breiten Themenspektrums. Gemein ist ihnen der historische Hintergrund, denn sowohl die „...Weiblichen Erfahrungen um Körperlichkeit und Sexualität...“ (von Silke Göttsch), als auch „...Sexualmoral und Ehrenhändel...“ (von Carola Lipp) sowie der Rügebrauch in Form des Strohkranzes (von Hans Moser) werden im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Bedingungen des 17., 18. und 19. Jahrhunderts untersucht. Aus den Quellen von Brücheregister, Gerichtsprotokollen, Statistiken, Polizeiprotokollen, Gerichtsordnungen, Statutensammlungen, Polizei- oder Allgemeinen Dorfordnungen, Jahresabrechnungen (Strafeinnahmen), Stadt- und Marktkammerechnungen, herrschaftlichen Verordnungen und Befehlen, Kirchenbuchvermerken, aufklärerischer Reiseliteratur und Kopulationsbüchern lassen sich Informationen über damalige Lebensverhältnisse, Moralvorstellungen, Ehrbegriffe und Sanktionsmaßnahmen gewinnen. Insgesamt kann man ein Bild von Sexualmoral der letzten Jahrhunderte aus den Angaben extrahieren.
Insbesondere ledige Mütter stellen einen zentralen gesellschaftlichen Konfliktfall dar. Aber auch alle anderen Frauen der Unterschicht sind aggressiven und ritualisierten Formen sexueller Beziehungen ausgesetzt, wie es Göttsch für das Milieu ländlicher Dienstbotinnen belegt. In der Sicht auf den weiblichen Körper drücken sich soziale Verhältnisse aus (vgl. Lipp 1994, S. 325). Damit wird sich das erste Kapitel befassen.
Im zweiten Kapitel soll Sexualmoral und Ehrenhändel im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts beschrieben werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem rechtlichen Aspekt der Heiratsbeschränkungen und deren Konsequenzen für die Frauen. Im dritten Kapitel schließlich geht es um den Rügebrauch des Strohkranztragens, von welchem nicht-jungfräuliche Bräute betroffen sind. Die Rüge dient als Mittel, „...andere wegen des Angriffs auf die Ehre zu tadeln...“ (Schempf, 1994, S. 364). Rügebräuche stellen dabei die selbständige Rechtsausübung einer Gruppe dar, ohne oder gar gegen die obrigkeitliche Justiz (vgl. Schempf 1994, S. 366).
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Weibliche Erfahrungen um Körperlichkeit und Sexualität
- 1.1. Die Quellen
- 1.2. Der brauchtümliche Kontext
- 1.3. Sittlichkeitsvorstellungen und moralischer Verruf
- 1.4. Die Situationen
- 1.5. Eheversprechen
- 1.6. Die sozialen Verhältnisse
- 2. Sexualmoral und Ehrenhändel im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts
- 2.1. Normsystem und Alltagsverhalten
- 2.2. Ehrenklagen und Unzucht
- 2.3. Heiratsbeschränkungen und weibliche Lebensperspektiven
- 2.4. Konkubinate
- 3. Jungfernkranz und Strohkränze
- 3.1. Die Rolle des Strohkränzes
- 3.2. Zum Begriff des Strohkränzes
- 3.3. Verschiedene Anwendungen des Strohkränzes
- 3.4. Bestrafung von Unzucht
- 3.5. Häufigkeit der Leichtfertigkeitdelikte
- 3.6. Die Reformen der Aufklärung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Sexualmoral im 17., 18. und 19. Jahrhundert, indem sie sich auf drei Aspekte konzentriert: Weibliche Erfahrungen um Körperlichkeit und Sexualität, Sexualmoral und Ehrenhändel im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts sowie den Rügebrauch des Strohkränzes. Die Arbeit analysiert, wie gesellschaftliche Bedingungen die Wahrnehmung von Geschlecht, Körperlichkeit und Sexualität prägten und welche Normen, Moralvorstellungen und Sanktionsmaßnahmen sich daraus ergaben.
- Weibliche Erfahrungen um Körperlichkeit und Sexualität im Kontext gesellschaftlicher Normen und Moralvorstellungen
- Sexualmoral und Ehrenhändel im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts, insbesondere im Hinblick auf Heiratsbeschränkungen und deren Folgen für Frauen
- Der Rügebrauch des Strohkränzes als Mittel zur öffentlichen Stigmatisierung von nicht-jungfräulichen Bräuten
- Die Rolle von Rügebräuchen als selbständige Rechtsausübung in ländlichen Gesellschaften
- Die Auswirkungen von Aufklärung und Reform auf die Sexualmoral und die Rolle der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich den weiblichen Erfahrungen um Körperlichkeit und Sexualität. Es analysiert die Quellen, die zur Erforschung dieser Thematik herangezogen werden, wie z.B. Bücherregister und Gerichtsprotokolle. Außerdem untersucht es den brauchtümlichen Kontext, in dem Sexualität eine wichtige Rolle spielte, und die Sittlichkeitsvorstellungen der ländlichen Bevölkerung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Sexualmoral und Ehrenhändel im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Normen und das Alltagsverhalten der Arbeiterklasse, insbesondere die Rolle von Ehrenklagen und Unzucht sowie die Auswirkungen von Heiratsbeschränkungen auf die Lebensperspektiven von Frauen.
Das dritte Kapitel behandelt den Rügebrauch des Strohkränzes. Es untersucht die Rolle und Bedeutung des Strohkränzes, seine verschiedenen Anwendungen und die Bestrafung von Unzucht. Es zeigt außerdem die Häufigkeit von Leichtfertigkeitdelikten und die Auswirkungen von Reformen der Aufklärung auf die Sexualmoral.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Arbeit sind: Sexualmoral, Körperlichkeit, Geschlechterrollen, Frauenforschung, Sittlichkeit, Brauchtum, Rügebräuche, Strohkränze, Ehrenhändel, Arbeitermilieu, Heiratsbeschränkungen, Unzucht, Aufklärung, historische Quellen, Sozialgeschichte, Normverstoß, Rechtsprechung, Geschlechterbeziehungen, Recht und Sitte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde die Sexualmoral im 17. bis 19. Jahrhundert kontrolliert?
Die Kontrolle erfolgte durch eine Mischung aus obrigkeitlicher Justiz (Gerichtsprotokolle) und sozialen Rügebräuchen wie dem Tragen des Strohkranzes.
Was symbolisierte der Strohkranz?
Der Strohkranz war ein Mittel der öffentlichen Stigmatisierung für nicht-jungfräuliche Bräute und diente dazu, Angriffe auf die gesellschaftliche Ehre zu tadeln.
Welche Konsequenzen hatten Heiratsbeschränkungen für Frauen?
Besonders im Arbeitermilieu des 19. Jahrhunderts führten rechtliche Beschränkungen zu unsicheren Lebensperspektiven, Konkubinaten und sozialen Ehrenhändeln.
Welche Rolle spielten ledige Mütter in der damaligen Gesellschaft?
Ledige Mütter stellten einen zentralen Konfliktfall dar und waren oft aggressiven, ritualisierten Formen der Ausgrenzung und Bestrafung ausgesetzt.
Wie veränderte die Aufklärung die Sicht auf die Sexualmoral?
Die Aufklärung brachte Reformen hervor, die versuchten, drakonische Rügebräuche und Strafen abzumildern und die sozialen Verhältnisse rationaler zu ordnen.
- Quote paper
- Laura Dahm (Author), 1999, Sexualmoral bei Frauen und Männern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14711