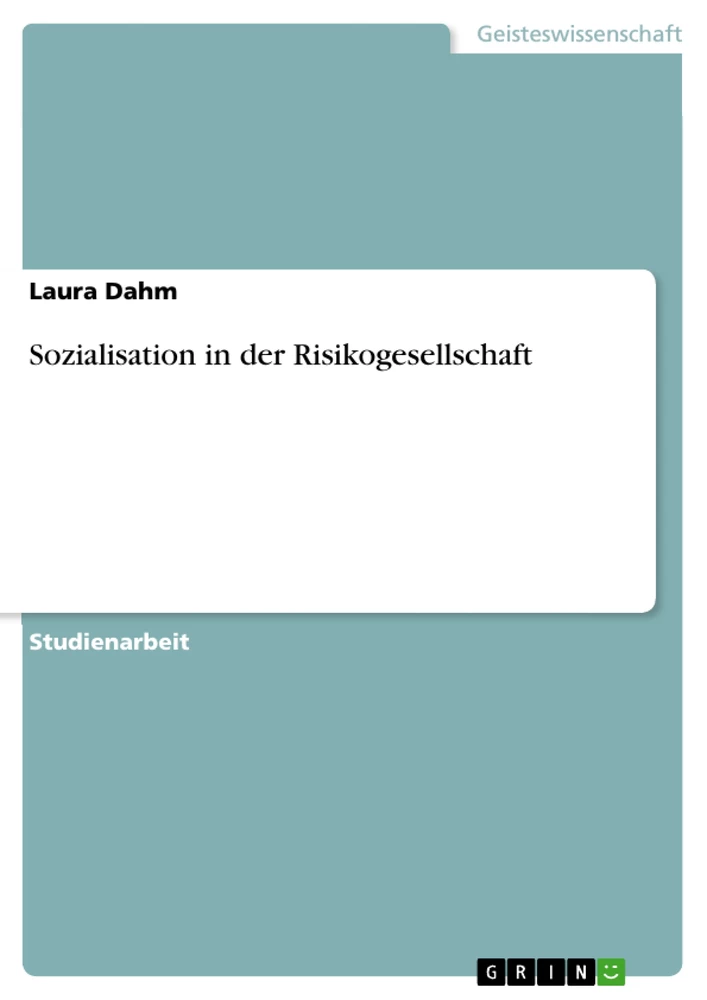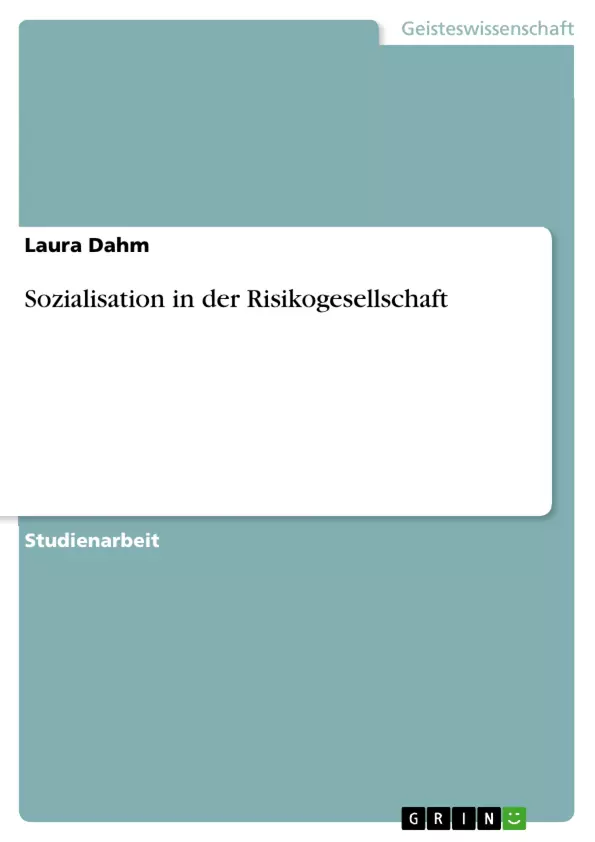Unsere heutige Gesellschaft ermöglicht zum einen Individualisierung und die damit verbundenen Chancen, die eigene Entwicklung frei zu planen. Die Selbstverwirklichung wird zu einem zentralen Anliegen. Die Kehrseite von der Freisetzung aus traditionellen Sozialformen und der Enttraditionalisierung kann soziale Isolierung und Verhaltensunsicherheit sein. Zusätzlich ist der einzelne ständig Entscheidungszwängen ausgesetzt, die ihn überfordern können, auch weil immer die Gefahr besteht, an der Realisierung eigener Pläne zu scheitern. Hinzu kommt, daß die voranschreitende Institutionalisierung und Standardisierung der Lebenslagen die Einflußmöglichkeiten des einzelnen einengt und damit die Selbständigkeit unmöglich macht.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Kapitel geht es einführend um die Jugendphase, deren Strukturwandel (1.1.), und um die Individualisierung mit ihren Auswirkungen auf die jugendliche Subjektentwicklung (1.2.). Im nächsten, theoriegeleiteten Abschnitt wird zunächst ein Sozialisationskonzept vorgestellt (2.1.), und anschließend eine streßtheoretische Konzeption von Mansel wiedergegeben (2.2.), die die primäre Bewertung der globalen Risiken (2.2.1.), die sekundäre Bewertung bzgl. der Bewältigungskompetenzen (2.2.2.), die Neubewertung der Situation (2.2.3.), die problemorientierten und emotionszentrierten Bewältigungsstrategien (2.2.4.), die Bedeutung von Emotionen (2.2.5.) und die Formen problematischer Belastungsregulation (2.2.6.) enthält. Auf der Grundlage dieser theoretischen Konzeptionen schließt Mansel eine empirische Untersuchung an, die ich hier anhand eines Beispiels, nämlich der Sensibilisierung und Angst angesichts gesellschaftlich produzierter Risikolagen (3.) referieren werde. Dabei geht es um die Bedeutsamkeit der Risiken im Vergleich (3.1.), die Strategien Jugendlicher zur Reduktion der Angst (3.2.) und um die Wahrnehmung makrosozialer Verunsicherungspotentiale und problematische Formen der Belastungsregulation (3.3.).
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Gesellschaftliche Veränderungen des Jugendalters
- 1.1. Strukturwandel der Jugendphase
- 1.2. Individualisierung und jugendliche Subjektentwicklung
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen: Sozialisations- und Streßkonzepte im Rahmen gesellschaftlich produzierter Risikolagen
- 2.1. Sozialisationskonzepte
- 2.2. Streßtheoretische Konzeptionen
- 2.2.1. Primäre Bewertung von gesellschaftlich produzierten Bedrohungspotentialen
- 2.2.2. Sekundäre Bewertung der individuellen Bewältigungskompetenzen und der verfügbaren sozialen Ressourcen
- 2.2.3. Neubewertung der Rahmenbedingungen des Aufwachsens und der gesellschaftlichen Entwicklung
- 2.2.4. Problemorientierte und emotionszentrierte Bewältigungsstrategien
- 2.2.5. Die Bedeutung von Emotionen im Rahmen der Streßentstehung und Streßverarbeitung
- 2.2.6. Interiorisierende und exteriorisierende Formen problematischer Belastungsregulation als Streßfolgen
- 2.3. Abwehrmechanismen: Verleugnung der Gefahren und Verdrängung der Ängste
- 3. Empirische Evidenzen: Sensibilisierung und Angst angesichts gesellschaftlich produzierter Risikolagen
- 3.1. Die Bedeutsamkeit der unterschiedlichen gesellschaftlich produzierten Risiken im Vergleich
- 3.2. Strategien Jugendlicher zur Reduktion der Verunsicherung und der Angst vor Makrosozialen Risiken
- 3.3. Wahrnehmung makrosozialer Verunsicherungspotentiale und problematische Formen der Belastungsregulation
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Bedingungen der „Risikogesellschaft“ die Sozialisation heranwachsender Generationen beeinflussen. Im Fokus steht die Sensibilisierung von Jugendlichen für gesellschaftlich produzierte Risikolagen, die Wahrnehmung und Bewertung dieser Risiken sowie die daraus resultierenden Streßprozesse und Bewältigungsstrategien.
- Strukturwandel der Jugendphase und die Auswirkungen der Individualisierung
- Sozialisationskonzepte und Streßtheoretische Konzeptionen im Kontext der Risikogesellschaft
- Empirische Evidenzen zur Sensibilisierung und Angst von Jugendlichen angesichts globaler Risiken
- Die Bedeutung von Emotionen und problematischen Formen der Belastungsregulation
- Strategien Jugendlicher zur Reduktion von Verunsicherung und Angst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Veränderungen der Jugendphase im Kontext der Individualisierung und Risikogesellschaft. Die Kapitel 1.1. und 1.2. behandeln den Strukturwandel der Jugendphase und die Auswirkungen der Individualisierung auf die jugendliche Subjektentwicklung. Das zweite Kapitel widmet sich theoretischen Konzepten, die zur Analyse des Themas relevant sind. Hierbei werden zunächst Sozialisationskonzepte vorgestellt, bevor im Anschluss eine Streßtheoretische Konzeption von Mansel erläutert wird, die sich mit der Bewertung von Risiken, Bewältigungskompetenzen und der Rolle von Emotionen befasst. Das dritte Kapitel präsentiert empirische Evidenzen zur Sensibilisierung und Angst von Jugendlichen angesichts gesellschaftlich produzierter Risikolagen. Es werden die Bedeutsamkeit der Risiken im Vergleich, Strategien zur Reduktion von Angst und die Wahrnehmung von Verunsicherungspotentialen und problematischen Formen der Belastungsregulation behandelt.
Schlüsselwörter
Risikogesellschaft, Sozialisation, Individualisierung, Jugendphase, Streß, Bewältigungsstrategien, Sensibilisierung, Angst, globale Risiken, Belastungsregulation, Emotionen, empirische Evidenzen.
- Quote paper
- Laura Dahm (Author), 1999, Sozialisation in der Risikogesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14712