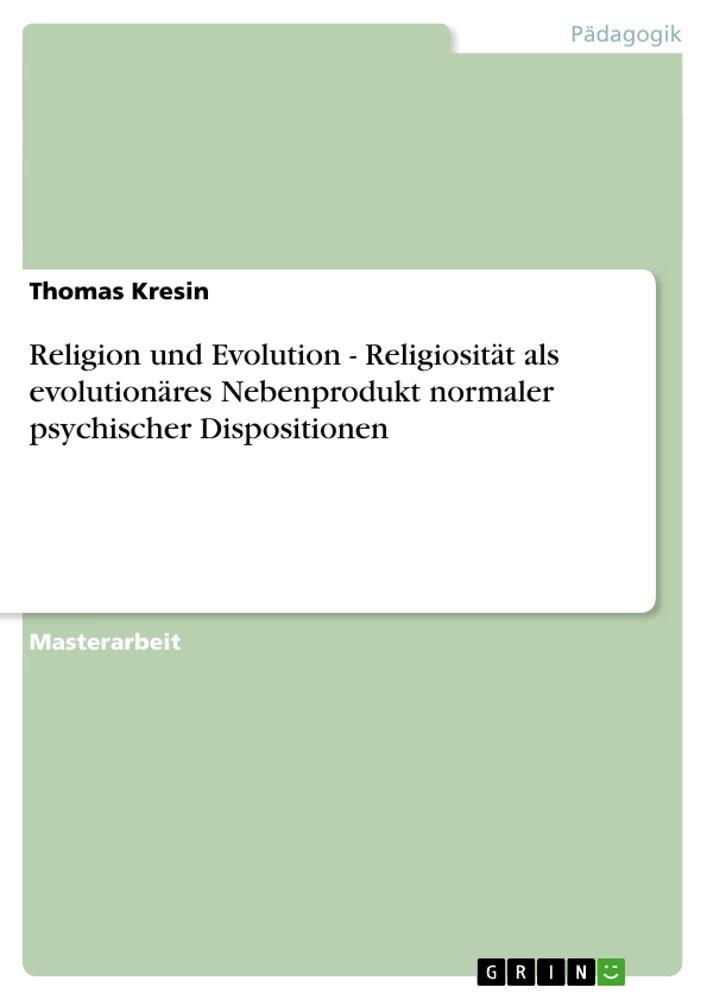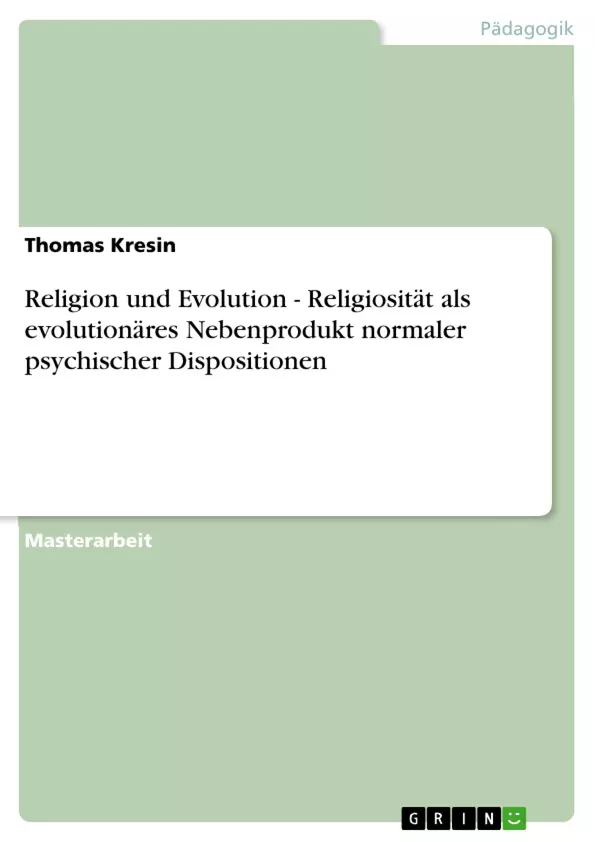Praktisch überall auf der Welt gibt es Religionen in vielfältigen Formen. Paradoxerweise
scheint es gerade am Anfang des neuen Jahrtausends, „eines Zeitalters beispielloser
wissenschaftlicher und technologischer Aufgeklärtheit“1, zu einer erneuten Blütezeit
irrationaler Glaubensüberzeugungen zu kommen. Fragt man jedoch nach dem Grund der
Existenz von Religionen, so wird man mit den unterschiedlichsten Ansichten konfrontiert: sie
erklären die Welt, spenden Trost, sichern die gesellschaftliche Ordnung oder liefern ein
moralisches Leitbild. All diese Ansichten sind jedoch falsch und können das Warum nicht in
hinreichender Weise erklären. Wenn die ehemals unergründlichen Rätsel der Welt nach und
nach von den Naturwissenschaften gelöst werden, warum wenden sich Gläubige dann nicht
von ihrer Religion ab, zumal sich nicht der geringste Beweis für ihre Glaubensinhalte finden
lässt? Wenn Religion Trost spendet, warum haben dann gläubige Menschen meist mehr Angst
vor dem Tod als Atheisten?2 Wenn Religion die Moral einer Gesellschaft garantiert, warum
sind dann Länder mit hohem Atheismusanteil die sozialsten und wohltätigsten?3 Vielleicht
deshalb, wie David Hume seinerzeit argumentierte, weil Religion „nicht einmal eine Form des
Wissens, sondern eher eine komplexe Art des Gefühls [ist]“4. Volkstümliche Erklärungen für
die Existenz von Religionen sind wohl eben aus diesem Grund post-hoc-Rationalisierungen,
weil den Menschen entgegen ihren eigenen Überzeugungen überhaupt nicht klar ist, warum
sie eigentlich glauben. Sie tun es einfach. Vielleicht wurzelt die „bemerkenswerte
Hartnäckigkeit der Religion in etwas viel Tieferem, Einfacherem“5 als beispielsweise
Verdrängung, wie Freud sie beschrieb, oder psychischer Abhängigkeit und ängstlicher
Selbsttäuschung, wie Nietzsche glaubte.
Aus darwinistischer Sicht stellt sich die Frage, welchen Nutzen Religiosität einem
Organismus bringen könnte. Ein Grundprinzip der Evolutionstheorie besagt, dass alles, was
heute existiert, nur deshalb existiert, weil es sich einst aufgrund eines Selektionsvorteils
behaupten konnte. Demnach müsste auch Religiosität eine Funktion erfüllen und per se
irgendeinen Vorteil innehaben, der religiösen Menschen die Weitergabe ihrer Gene
erleichtert. Da die natürliche Selektion auf der Basis von Individuen arbeitet, ist es jedoch
fraglich, worin der individuelle Selektionsvorteil von Religiosität bestehen sollte...für die vollständige Einleitung siehe Kommentar
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Begriffsklärung
- Die Evolution des Geistes
- Spezialisierte Systeme versus Mehrzweckintelligenz
- Urmenschen und Affen
- Vom gemeinsamen Vorfahren zu Homo sapiens
- Homo sapiens und kognitive Fluidität
- Die Organisation des menschlichen Gehirns
- Der mentale Unterbau
- Wissenserwerb und ontologische Kategorien
- Die Erkenntnissysteme des Gehirns
- Intuitives Wissen
- Animismus und intuitiver Theismus
- Warum sind Religionen, wie sie sind?
- Die gute religiöse Idee
- Das Rezept religiöser Vorstellungen
- Die Attraktivität religiöser Vorstellungen
- False positives
- Bedürfnisse und Schlussfolgerungen
- Moral und Religion
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Ursprung religiöser Ideen und untersucht, warum Menschen empfänglich für Vorstellungen von übernatürlichen Akteuren sind. Sie beleuchtet die mentalen Prozesse, die diesen Vorstellungen Überzeugungskraft verleihen, und analysiert, wodurch sich eine religiöse Idee auszeichnet. Die Arbeit argumentiert, dass nicht jedes Verhalten einen Selektionsvorteil haben muss und dass Religiosität ein Nebenprodukt evolutionärer Entwicklungen sein kann.
- Die Evolution des Geistes und die Architektur des menschlichen Gehirns
- Die Rolle kognitiver Prozesse und mentaler Dispositionen bei der Entwicklung von Glaubensüberzeugungen
- Die Entstehung und Attraktivität religiöser Vorstellungen
- Die Frage nach dem Selektionsvorteil von Religiosität
- Die Verbindung zwischen Religiosität und Moral
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Problematik der Religiosität ein. Sie beleuchtet die verschiedenen Ansichten zur Existenz von Religionen und hinterfragt die traditionelle Sichtweise, die Religion als eine Form von Wissen betrachtet. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Religiosität im Kontext der Arbeit definiert und von Religion abgegrenzt. Im dritten Kapitel wird ein Überblick über die Evolution des Geistes gegeben, insbesondere mit Fokus auf die Theorie der kognitiven Fluidität. Das vierte Kapitel analysiert die Organisation des menschlichen Gehirns und beleuchtet verschiedene Aspekte der Funktionsweise unseres Geistes, die für die Aneignung religiöser Vorstellungen relevant sind. Kapitel fünf widmet sich schließlich religiösen Vorstellungen und untersucht, welcher Art sie sind und wie sie Bedeutung erlangen.
Schlüsselwörter
Religiosität, Evolution, Geist, Kognitive Fluidität, Religion, Übernatürliche Akteure, Glaubensüberzeugungen, Selektionsvorteil, Moral, Anthropologie, Kognitive Psychologie, Archäologie, Neurologie, Entwicklungspsychologie
Häufig gestellte Fragen
Ist Religiosität ein evolutionärer Vorteil?
Die Arbeit argumentiert, dass Religiosität eher ein Nebenprodukt ("Spandrel") normaler psychischer Dispositionen ist und nicht zwingend selbst einen Selektionsvorteil bieten muss.
Was bedeutet "kognitive Fluidität" im Kontext der Evolution?
Es bezeichnet die Fähigkeit des menschlichen Geistes, Wissen aus verschiedenen spezialisierten Systemen (z.B. soziale Intelligenz und Naturwissen) miteinander zu verknüpfen.
Warum sind religiöse Ideen so attraktiv für den menschlichen Geist?
Religiöse Vorstellungen nutzen oft "intuitives Wissen" und ergänzen es um minimale Verletzungen ontologischer Kategorien, was sie leicht merkbar und überzeugend macht.
Was versteht man unter "False Positives" in der Religionspsychologie?
Es ist die Tendenz des Gehirns, hinter Ereignissen absichtsvolle Akteure zu vermuten (Hyperactive Agency Detection), was die Basis für den Glauben an Götter oder Geister bildet.
Garantierte Religion die Moral einer Gesellschaft?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch und weist darauf hin, dass Moral oft unabhängig von religiösen Überzeugungen in der menschlichen Evolution verankert ist.
- Citar trabajo
- Thomas Kresin (Autor), 2009, Religion und Evolution - Religiosität als evolutionäres Nebenprodukt normaler psychischer Dispositionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/147238